Im Kino
Anhalt am Irdischen
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer, Nikolaus Perneczky
02.02.2011. Ein Film, der Sprünge macht, und Töne und Bilder findet, die dauerhaft in Erinnerung bleiben, das ist Joao Pedro Rodrigues' Drag-Queen-Drama "To Die Like a Man". Einen Blick wert ist auch "I Killed My Mother", in dem der erst zwanzigjährige Frankokanadier Xavier Dolan in wilden Bildern von heftigsten Auseinandersetzungen eines schwulen Heranwachsenden mit seiner Mutter erzählt.
Wie man sich an einen Film erinnert, ist nicht im Voraus berechenbar. Auch oder gerade dann, wenn er mit Intensitäten großzügig ausgestattet ist: Momentan überwältigt, besinnt man sich später nicht selten eines Besseren. Im vollen Bewusstsein dieser Schwierigkeit geht der Rezensent - keine zehn Minuten nach dem Ende des Films - jede Wette ein: Joao Pedro Rodrigues' "Morrer Como Um Homem" verursacht bleibende Erinnerungen.
Schon die Eröffnung dieser episodisch voranschreitenden Erzählung um die alternde Drag Queen Tonia stellt den ungebrochenen, ja ungestümen Gestaltungswillen heraus, der den ganzen Film auszeichnet. Soldaten streifen durch einen nächtlichen Wald, ihr Zweck ist geheimnisvoll. Zwei unter ihnen, die sich vom Rest der Gruppe entfernt haben, tauschen erst Zärtlichkeiten aus und geraten dann in Streit. Ein Schuss fällt. Das klandestine Geschehen ist undurchsichtig nicht nur seinem Sinn nach, sondern auch durch das dichte Gestrüpp hindurch, das die Sicht darauf erschwert. Für die Mühe, den langsamen Fahrten durch die Dunkelheit, aus der vereinzelt, zwischen zwei Ästen, ein Gesicht oder ein Unterarm hervorlugen, den Beginn einer Geschichte abzutrotzen, ist das betörende Chiaroscuro dieser Nacht Belohnung genug.
Es gehört zu den erinnerungswürdigen Qualitäten von "Morrer Como Um Homem", dass mit dieser Beschreibung so gut wie nichts gesagt ist. Vielleicht so: Rodrigues wird in den nächsten zwei Stunden nichts unversucht lassen. Er wird von einer Tonalität in die andere springen und von einer Szene zur übernächsten. Er wird das Bild beherrschen, aber auf so unerwartete und ständig neue Weise, dass die bis zur Pedanterie gewollten Bildkompositionen an keiner Stelle in Erstarrung münden. Er wird disparate Motive so dicht ineinander weben, dass am Schluss nicht mehr einwandfrei zu klären ist, was zuerst war: Transsubstantiation oder Geschlechtsumwandlung. Wenn es etwas gibt, dass Rodrigues' Vorgehen im Innersten zusammenhält, so muss es wohl das klassische Bildformat 4:3 sein: Aus ihm lassen sich alle filmischen Verfahren, die hier zusammenkommen, ableiten.
Längs dieser Formatvorgabe entwirft Rodrigues eine Ästhetik des schmalen Formats als Gefäß existenzieller Beengtheit. Die vielen Nah- und Detailaufnahmen von Tonias Welt sind randvoll gefüllt mit Menschen und Dingen. Dass es aus dieser Welt keinen Ausweg gibt, dafür mag auch ihre eigenwillige Räumlichkeit einstehen. Anstatt in die Tiefe sich vom Betrachter zu entfernen, überlagern die Gegenstände sich häufig wie in dem Aquarium, das Tonias Lover Rosario aus Frustration zerschlägt.

Aber auch in den panoramatischen Schwenks und Lateralbewegungen, die das ganz anders geartete Verhältnis Tonias zur Natur etablieren, schlägt sich das Format nieder. Weil seine horizontale Reichweite so gering ist, kommt der Sucher nie zur Ruhe. Figuren setzen der unaufhörlichen Bewegung der Kamera ihre eigenen Vektoren entgegen, tauchen überraschend auf oder unter. Wenn dann einmal doch Stille einkehrt - wie in einer Szene gegen Ende des Films, die einen entscheidenden Umschlag markiert - dann wirkt dies umso nachdrücklicher als Freistellung des Bilds. Auf einer Waldlichtung, wo Tonia und ihre Freunde sich niedergelassen haben, rastet es für einige Minuten ein und nimmt, zu den Klängen von Baby Dees "Calvary", allmählich eine rötliche Tönung an.
Vom Kalvarienberg führt ein direkter Weg zu den erhabenen Winkeln, aus denen der Film auf die Leiden der gläubigen Christin Tonia herabblickt. Ob es eine höhere Macht gibt, deren Mitleid sich in diesem Blickpunkt vermittelt, lässt Rodrigues unbeantwortet. Nicht nur bleibt den erhöhten Einstellungen - im Gegensatz etwa zum luftgetragenen God?s Eye in zahllosen Hollywoodfilmen der letzten Jahre - stets ein Anhalt am Irdischen, an einem Ast oder einem Häuserdach, sondern sie finden in stark untersichtigen Aufnahmen im doppelten Wortsinn: niedriger Körper eine starke, ausgleichende Entsprechung. In beiden Fällen verharrt das Bild oft länger als seine Figuren, von denen es sich dadurch tendenziell loslöst. Als wollte es sagen: Geschichten und ihr Personal kommen und gehen, der Geist und das Fleisch bleiben.
Nikolaus Perneczky
***

Zum Abschied wirft Hubert seiner Mutter mancherlei an den Kopf: Sie benehme sich wie eine Alzheimerkranke, ihre Kleidung sei scheußlich, schlimmer noch die Tiermustertapeten an den Wänden des Hauses, in dem sie bis dahin gemeinsam lebten. Nun aber schickt seine Mutter den siebzehnjährigen Hubert ins Internat, irgendwo auf dem Land, abseits von Montreal, der Stadt, in der der Sohn sich, außerhalb der eigenen vier Wände zumindest, zuhause fühlt. Ständige Streitereien, deutlich und heftig, Huberts Flucht eines Nachts führen dazu, dass die Mutter sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als ihn von sich zu stoßen.
Hubert hasst seine Mutter, oft genug sagt er ihr das direkt ins Gesicht: "Ich hasse dich". Im Unterricht schwindelt er der Lehrerin vor, dass er seinen Vater seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, dass seine Mutter nicht mehr lebt. (Der Titel des Films benennt also keine Realität, nur einen Hasswunschtraum.) Die nimmt das, als sie davon hört, nicht gut auf. Die Lehrerin allerdings wird zur Vertrauten Huberts, der schöne Gedichte schreibt und sich auch als Maler versucht, ein Jackson Pollock der Zimmerwand. Seit zwei Monaten lebt er vor der Abreise ins Internat in einer Beziehung mit Antonin, seine Mutter weiß lang nichts davon, erfährt es im Solarium durch Zufall - er hat ihr ja nicht mal erzählt, dass er schwul ist.
Hubert liebt seine Mutter, aber nicht, wie man seine Mutter eigentlich lieben sollte. Er würde jeden töten, der ihr etwas antut, aber es gibt hundert andere Menschen, die ihm wichtiger sind. Das sagt er in seine Videokamera, die Bilder sieht man zwischen den anderen Bildern von Zeit zu Zeit in Schwarz-Weiß. Überhaupt ist "I Killed My Mother" ein ziemlicher Bildersalat, der beweist, dass Regisseur Xavier Dolan einschlägige Vorbilder (Godard, Wong Kar-Wei) und viele Einfälle hat. Einmal setzt er Hubert und die Lehrerin auf eine Bank vor modern geschwungenem buntem Hintergrund ins Cafe und es sieht sehr nach einer Fingerübung im Imitat des frühen Godard aus.
Extravagant ist auch eine Dialog-Szenenauflösung, die in dieser Einstellung sinnlos wiederholt, was in einer Streitsituation mit der Mutter zuvor durchaus interessant war. Auf gewöhnliche Schuss/Gegenschuss-Aufnahmen verzichtet Dolan in der Regel. Im Raum und im Schnitt platziert er seine Figuren gerne nebeneinander. Am Tisch mit der Mutter, im Cafe mit der Lehrerin separiert er Bild für Bild Hubert und seine Gesprächspartnerin. Im Dialogwechsel steckt er sie abwechselnd in den Einzelknast eines Bildkaders, in dem der/die direkt daneben sitzende andere nicht zu sehen ist. Wie so manches, was mehr aus der Luft gegriffener Einfall als gefundene Form ist in diesem Film, wird das zur Manier.

Auf der anderen Seite: "I Killed My Mother" hat Energie, Wucht, Tempo, überzeugend schmerzhafte Dialoge. Dolan, der Erfahrung als Schauspieler hat, dosiert seine Verzweiflungen, seine Selbstmitleid- und seine Hassanfälle gekonnt. So tanzen der narzisstische Sohn und seine verständnislose Mutter - die später am Telefon auch einen hinreißenden Wutanfall hat - ihren Pas de Deux der Entfremdung mit Bravour.
Und ein Faktum gibt es, das immer etwas zu sehr auf die Tube drückende Bilddurcheinander, das die allzu vielen Einfälle, die von der Geschichte ablenken, statt sie zu zentrieren, doch mehr als entschuldigt: Xavier Dolan war siebzehn, als er seine mutmaßlich stark aus dem eigenen Leben gegriffene Geschichte als Drehbuch aufschrieb. Er war zwanzig, als der Film in die Kinos kam. Auf den Festivals wurde er gefeiert, auch der Nachfolger "Les amours imaginaires" war im letzten Jahr in Cannes ein Erfolg. Hierzulande dauert es ja gern etwas länger, bis man interessante Werke noch nicht so bekannter Filmemacher zu sehen bekommt. Man darf also schon froh sein, dass sich Xavier Dolan, von dem sich viele noch Großes erhoffen, dem deutschen Kinozuschauer überhaupt vorstellen darf.
Ekkehard Knörer
To Die Like a Man. Portugal / Frankreich 2009 - Originaltitel: Morrer Como Um Homem - Regie: Joao Pedro Rodrigues - Darsteller: Fernando Santos, Alexander David, Chandra Malatitch, Jenny Larrue, Cindy Scrash
I Killed My Mother. Kanada 2009 - Originaltitel: J'ai tue ma mere - Regie: Xavier Dolan - Darsteller: Anne Dorval, Xavier Dolan, Suzanne Clement, François Arnaud, Patricia Tulasne, Niels Schneider, Monique Spaziani, Pierre Chagnon
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens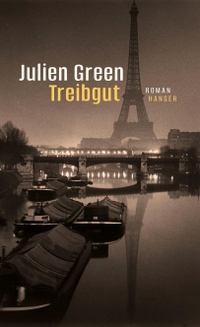 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut