Im Kino
Da oben ist Gott
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Ekkehard Knörer
15.06.2011. Allem Raunen und Kitsch zum Trotz ein überwältigender Film, der die Welt durch fast reine Wahrnehmung neu verzaubert: Terrence Malicks Kindheits- und Kosmos-Epos "The Tree of Life". Im sehr viel kleineren Rahmen versöhnen Nobuhiro Suwa und Hippolyte Girardot in ihrem Film "Yuki & Nina" die Welt der Kinder und Erwachsenen in der Form der filmischen Wirklichkeit.
Eine der ersten Einstellungen zeigt einen Jungen auf einer Schaukel, genauer gesagt zeigt sie den Jungen direkt in der Schaukelbewegung, sie zeigt den letzten Stoß, der dem Jungen versetzt wird und dann, wie er auf der Schaukel nach vorne drängt, dann nach oben, gen Himmel. Zwei, drei Einstellungen später nimmt die Kamera die Bewegung der Schaukel auf, sie schwingt durch die Luft, wird für einen Moment Teil eines Kinderspiels, wird selbst angestoßen, aktiviert. Oft schneidet Malick auf diese Weise direkt in die Bewegung, sowohl in die einer Figur als auch in die der Kamera. Es gibt einige Bewegungsmuster im FIlm, die sich wiederholen und ständig variiert werden: das Schaukeln, das Kreiseln, der Blick / Schwenk nach oben, direkt gen Himmel oder entlang des Stamms eines Baumes, dazwischen gibt es chaotischere, ungeordnete Erkundungen: Sequenzen, in denen sich der Film vom eigenen Montagefluss mitreißen zu lassen scheint, Affekte, die die Kamera produziert und von denen sie gleichzeitig selbst infiziert wird.
Es scheint, dafür sprechen die Reaktionen in Cannes (und auch im perlentaucher-Kollegenkreis), durchaus möglich zu sein, "The Tree of Life" als Ganzes abzulehnen; eine solche komplette Zurückweisung nachzuvollziehen fällt mir schwer, üben doch diese Bilderfolgen - immer neue Annäherungen an eine durch kein konventionalisiertes Bewusststein vorstrukturierte und deshalb noch einmal neu verzauberte Welt - bereits für sich selbst, vor ihrer Aufladung mit Phylogenese, Familienroman oder Metaphysik eine ungeheure Faszination aus, schon ob ihres Wagemuts, ihrer formalen Freiheit. Manche Passage gerade in der ersten Stunde des Films sieht fast so aus, als hätte der große Experimentalfilmer Stan Brakhage für einmal versucht, einen Film mit Figuren und einer fiktionalen Ebene zu drehen.

Was der Film dann mit und neben diesen Bildern macht, ist eine andere Sache. Im Kern ist "The Tree of Life" ein Erinnerungsfilm. Auf der einen Seite gibt es einen Mann fortgeschrittenen Alters (Sean Penn), der gelegentlich auftaucht und zwischen verspiegelten Hochhäusern eine unterdefinierte psychologische Krise zu bearbeiten scheint, auf der anderen Seite entwirft der Film ein Familien- und Jungenderzählung aus dem Texas der Fünfziger Jahre: drei Söhne, von denen einer vor dem Erreichen des Erwachsenenalters stirbt, eine fast ins Außerweltlich-Engelhafte idealisierte, dabei aber schwache Mutter (Jessica Chastain), ein dominanter, brutaler Vater (Brad Pitt). Insoweit man den Film auf eine ihm zugrunde liegende lineare Zeitachse zurechtbiegen möchte, ist die Penn-Figur die Erzählgegenwart und der restliche Film seine Jugenderinnerung.
Aber die beiden Ebenen sind miteinander radikal inkommensurabel, fügen sich nie zur Klammer einer kohärenten Biografie, sie scheinen sozusagen ihre Wertigkeiten vertauscht zu haben: Die vermeintliche Gegenwart wirkt wie eine substanzlose, dystopische Projektion, wie eine halluzinatorische Abschweifung, die auch stets sehr schnell wieder zerfällt, keine eigene Präsenz zu haben scheint, während die Fünfziger-Jahre-Szenerie als etwas Unmittelbares, Unvermitteltes erscheinen, als eine reine Wahrnehmung fast, die keinerlei Distanzierung erlaubt und die mehr und mehr zum Ganzen dieses Films wird. Die ambivalente Macht des Vaters, die hilflose Liebe der Mutter, immer wieder die Spiele, das Toben der Jungen durch die Natur. Erinnerung funktioniert in "The Tree of Life" nicht im Sinne einer Rückversicherung, sondern im Sinne eines Erinnerungsstroms, der alles mit sich reißt und der keine gefestigte Erkenntnisposition (kein mit sich selbst identisches Subjekt der Erinnerung) zulassen kann.

"The Tree of Life" geht nicht in einer derartigen Phänomenologie von Erinnerung auf und die Probleme, die der Film durchaus hat, leiten sich aus seiner vielleicht tatsächlich allzu expansiven Anlage ab, die nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, dass Terrence Malick, der öffentlichkeitsscheue Außenseiter des amerikanischen Kinos, an dem Projekt mehrere Jahrzehnte lang gearbeitet hat. Allerdings: Die vieldiskutierte "Schöpfungsgeschichte" nimmt weit weniger Raum im Film ein, als man angesichts vieler Kritiken meinen könnte, die ist nach einer Viertelstunde Überwältigungskitsch - aber selbst da gibt es Momente echter Schönheit, nicht zuletzt in der Begegnung der beiden schon jetzt berüchtigten Dinosaurier - auch schon wieder vorbei. Und die nur in sehr allgemeiner Weise allgegenwärtige Religiosität des Films ist von einer Art, mit der sich auch unbelehrbare Atheisten - wie der Rezensent einer ist - anfreunden können sollten: "Da oben ist Gott" sagt eine Stimme, dann folgt ein Schnitt auf den Himmel, danach eine der schönsten Montagesequenzen des Films, eine weitere jubilatorische Evokation von Kindheit, von Momenten des Glücks.
Es ist ein auf einem naiven, pantheistischen Weltbild aufbauender, von keiner Amtskirche kanalisierter Glaube, der da immer wieder auf- und angerufen, aber eben nie gepredigt wird. Auch derartige Momente des spirituellen Glücks - der "Gnade", um mit dem Film zu sprechen - sind immer schon bedroht, brüchig, von Gewalt durchsetzt; auch sind sie immer schon begrenzt und eingezäunt, so wie der Vater eine unsichtbare Linie durch die Wiese vor dem Haus zieht: hier ist unsere Seite, drüben beginnt der Garten des Nachbarn. Die Wiese ist den ganzen Film über gleichzeitig Ort einer Immanenzerfahrung an der Natur und Kriegsschauplatz für die Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn. Der Film gewinnt an dieser kargen, stellenweise fast kahlen Wiese, die immer wieder bearbeitet, von Unkraut befreit, bewässert werden muss, eine Härte, eine Widerständigkeit, die sich tief in den wunderschönen Bildern einnistet und die verhindert, dass sie zu leicht kommensurablen Postkarten mit Eso-Flair werden. Die Gefahr besteht durchaus; man besuche nur einmal die fürchterliche Website zum Film.
Auch die Musik schwingt sich gelegentlich zu bedenklichen pastoralen Höhen auf, aber sie ist nur ein Element der Tonspur. Es gibt daneben eine ganze Gruppe von Voice-Over-Stimmen. Die erst einmal körperlosen Stimmen, die den Film weitaus stärker prägen als jeder Direktton, sind mal direkt einzelnen Figuren zuzuordnen (dem erwachsenen Sohn, dem jungen Sohn und seinen Brüdern, der Mutter, aber schließlich bekommt auch der Vater eine, auch den lässt Malick nicht außen vor; allerdings: aus welcher Zeit, aus welcher Perspektive sprechen die Figuren?), mal scheinen sie eine Subjektivität zu artikulieren, die in keiner Figur, vielleicht überhaupt in keinem menschlichen Register mehr aufgeht. Die Sätze, die die Stimmen sprechen, haben, auch wenn sie häufig Personalpronomina verwenden, in gewisser Weise weder Sender noch Empfänger, vor allem keinen direkten Adressaten, sind keine Mitteilungen, definieren sich nicht über einen Informationswert. Nicht alle, aber sehr viele artikulieren Erfahrungen von Verlust und existentieller Verzweiflung: "Wann habe ich Dich verloren?" oder auch "Ich kann nicht handeln, wie ich möchte; ich hasse, was ich mache." Man muss mit Malicks New-Age-Metaphysik nicht bis zum kitschig-symbolistischen Ende mitgehen, um von der unbedingten, gewissermaßen vorkommunikativen Intimität solcher Sätze und von den Bildern, mit denen sie kommunizieren, berührt zu werden.
Lukas Foerster
***

Frontal im Bild: Mutter und Tochter. Sie stehen, sie reden, sie bewegen sich schräg nach links auf die Kamera zu, bis nah, sehr nah heran, so nah, dass die Mutter nach links weg aus dem Rahmen des Bildes verschwindet. Für einen Moment, einen entscheidenden Moment, füllt so groß nur die Tochter, Yuki, das Bild. Dann entlässt diese Einstellung auch sie Richtung Off. Es ist nicht verkehrt, diese Szene emblematisch zu nehmen. "Yuki & Nina", der Film, für den der japanische Meisterregisseur Nobuhiro Suwa und der französische Schauspieler Hippolyte Girardot gemeinsam verantwortlich zeichnen, ist eine einzige Solidaritätserklärung mit seinen beiden Heldinnen im Grundschulalter, Nina und Yuki (Arielle Moutel und Noe Sampy).
Auf ihrer Höhe bewegt sich die Kamera, ihre Perspektive nimmt ihr stellvertretender Blick wieder und wieder ein. Etwa wenn Yuki im Hochbett liegt und man im Hintergrund durch die geöffnete Tür den Streit ihrer Eltern so hört, wie sie ihn hört: Man weiß nicht ganz genau, worum es geht; dass sie streiten, dass das für Yuki schwer zu ertragen ist, ist aber klar. Yukis Eltern sind dabei, sich zu trennen. Die Mutter (Tsuyu Shimizu) will zurück nach Japan und möchte, dass Yuki mitkommt. Der Vater (Hippolyte Girardot) ist mal verständnisvoll, mal besoffen und insgesamt etwas aus dem Ruder. Aber um ihn geht es nicht und nicht um die Mutter.
Yuki und Nina, die Freundinnen, unternehmen einen letzten Versuch, die Trennung zu verhindern. Nina kennt sich in der Angelegenheit übrigens aus, auch ihre Eltern leben nicht mehr zusammen. Gemeinsam basteln sie einen Brief mit allerlei Worten und Schmuck und Bric-a-Brac, der Zauberkraft haben soll. Als Yukis Mutter ihn dann bekommt, wird sie von Weinkrämpfen geschüttelt. Ganz so hat Yuki sich das dann auch wieder nicht vorgestellt. Gerade das ist ein wichtiger Punkt, der an der Frage der Trennung der Eltern zum harten Fels wird, an dem sich die Sphären scheiden: Die Kinder und die Erwachsenen leben in zwei sehr verschiedenen Welten. Es gibt nur Fragmente einer gemeinsamen Sprache, sehr unterschiedlich werden die Probleme in den eigenen Verständniskreis hinein prozessiert.

In aller Einfachheit wird das von Suwas hier erstmals völlig unprätentiösen und doch im Vergleich mit den Vorgängerfilmen nicht weniger präzisen und einleuchtenden Einstellungen ausbuchstabiert. Er kann einzelne Bilder und Bewegungsfolgen so rahmen, dass die Welt der einen neben der Welt der anderen steht und der Kampf um eine Begegnungs- und Überschneidungsfläche ebenfalls sichtbar wird. Im Stadtraum Paris wie in den Innenansichten, in Yukis Loft und der beengteren Wohnung von Nina.
Bis der gordische Knoten der Raum-, Blick-, Perspektiv- und Aufteilungsfragen durchschlagen wird. Yuki und Nina reißen aus. Fahren, eine tolle Zugfahrt am Wald lang, aufs Land. Bauen sich erst ein Zelt im Haus von Ninas Vater, nehmen nochmal reißaus und gelangen in einen Wald wie aus einem Märchen. Was dann geschieht, darf man nicht im Detail erzählen, zu bezaubernd ist es in seiner schlagartigen Überzeugungskraft. Den ganz anderen Raum, der eröffnet wird, filmt Suwa, als wäre gar nichts dabei. Der Schnitt auf Yuki ganz klein am Waldrand ist ein Meisterstück - und die ganze Sequenz erinnert ein wenig an Hayao Miyazakis Anime "Chihiros Reise ins Zauberland".
Am Ende wird der Gang in den Wald ein Übergangsritus gewesen sein, in dem die unabweisbare Realität in Gestalt ganz realistisch genommener Imagination ihren Auftritt hat. Gleich darauf wechselt der Film ins anders realistische Register, mit sehr verwackelten Videocam-Bildern aus der neuen Welt: Yuki ist nun am anderen Ort, lebt mit ihrer Mutter in Japan, hat eine neue Freundin gefunden, schickt Videobotschaften an Nina und bekommt welche von ihr. Kein großes Drama. Und eine letzte Geste der totalen Solidarität mit der Erlebniswelt des Kindes. Der Film gibt, weil er es kann, der zuvor (wie) von der Einbildung Yukis heraufbeschworenen Szene nachträglich - sanft und freundlich bekräftigend - den Stempel ungeträumter Wirklichkeit. Eigentlich muss man es anders sagen: Er lässt sich von seiner Protagonistin die eigenen Bilder heraufimaginieren. Ihre Fantasie wird die seine, ist dieser Film, der die beide befremdende Unähnlichkeit von Kinder- und Erwachsenenwelt mit Hilfe der faszinierenden Bruchlosigkeit der eigenen Registerwechsel in sich aufhebt und also in den Grenzen des Möglichen sogar versöhnt.
Ekkehard Knörer
The Tree of Life. USA 2011 - Regie: Terrence Malick - Darsteller: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Fiona Shaw, McCracken, Laramie Eppler, Tye Sheridan, Joanna Going, Jackson Hurst, Crystal Mantecon, Kimberly Whalen, Zach Irsik, Will Wallace
Yuki & Nina. Frankreich / Japan 2009 - Regie: Nobuhiro Suwa, Hippolyte Girardot - Darsteller: Noe Sampy, Arielle Moutel, Tsuyu Shimizu, Hippolyte Girardot, Marilyne Canto
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens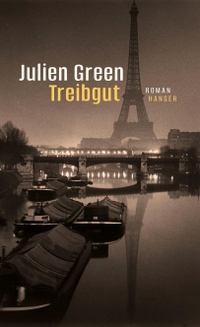 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut