Im Kino
Spiel mit falschen Fährten
Die Filmkolumne. Von Nicolai Bühnemann, Michael Kienzl
20.03.2019. Jordan Peele schickt in seinem smarten Horrorfilm "Wir" eine Doppelgängerarmee mit Scheren in einen blutigen Klassenkampf gegen das Bürgertum. In Tilman Singers "Luz" weiß man dagegen nie, wer Mensch und wer Medium ist.
Fast am Anfang von "Wir" machen die Wilsons einen Ausflug nach Santa Cruz. Als im Radio der 90er-Hip-Hop-Hit "I Got 5 On It" läuft, grooven die Eltern in ungewohntem Einklang mit ihrer Teenager-Tochter - bis der jüngere Sohn mit der Frage, ob es denn in dem Song um Drogen gehe, die Idylle stört. Der Comedien und Regisseur Jordan Peele lässt sich aufmerksam auf die familieneigene Dynamik ein und beweist nebenbei noch, wie gut er in seinen besten Momenten Situationskomik inszenieren kann.
Die Szene veranschaulicht aber auch, wie wichtig popkulturelle Referenzen in Peeles Kino sind. In "Wir" wimmelt es nur so von filmischen Bezügen; sie finden sich auf T-Shirts ("Jaws"), in den Dialogen ("Home Alone") und tauchen vor allem immer wieder als Versatzstücke der Handlung auf. Peeles zweite Regiearbeit weiß ohne Frage um die Geschichte des Horrorkinos und zeigt das auch gerne. Dabei geht es allerdings nie darum, ganz in eines der angeschnittenen Subgenres einzutauchen, sondern darum, ein Mosaik zu schaffen, das erst durch seinen Mix zur Vollendung kommt.
Lange ist nicht klar, wo der Film eigentlich hin will. Nach einem unheimlichen, in den 80ern angesiedelten Prolog, in dem die junge Adelaide - die spätere Wilson-Mutter - bei einem Jahrmarktbesuch auf eine Doppelgängerin trifft, folgt erst einmal ein Vorspann mit weißen Kaninchen und einem Score, der verdächtig nach Jerry Goldsmiths satanischer Musik aus "The Omen" klingt. Das Spiel mit Erwartungshaltungen und falschen Fährten bleibt Programm: Mittlerweile in der Gegenwart angekommen, verbringen die Wilsons ihren Urlaub in ihrem Ferienhaus, als plötzlich eine Familie in der Auffahrt steht, die wie eine hässliche Kopie der Hauptfiguren aussieht - und Teil einer aus dem Untergrund kommenden Doppelgänger-Armee ist, die ihre Ebenbilder mit Scheren aus dem Weg räumen will. In einer Erzählung, in der Wendungen zum Grundprinzip gehören, ist es dann nur ein kurzer Schritt von der Invasion des Heims zum Weltuntergangsszenario.

Nach Peeles gefeiertem Regiedebüt "Get Out" dürfte sich "Wir" für manchen Zuschauer wie eine Enttäuschung anfühlen; wie ein typischer Zweitlingsfilm, der den aus dem Vorgänger erwachsenden Erwartungen nicht gerecht wird, weil er nichts Angefangenes anständig zu Ende bringen kann. Die Konzentration und Geradlinigkeit, mit der Peeles "Get Out" in satirischem Tonfall sehr konkret vom Rassismus eines scheinbar aufgeklärten Bürgertums erzählte, weicht einer langsamen, zerstreuten und streckenweise regelrecht unökonomischen Erzählweise. Allerdings erweist sich "Wir" gerade deshalb als der interessantere, vielleicht sogar der bessere Film. Der klassische Spannungsaufbau von "Get Out" und die Klarheit seiner politischen These waren vielleicht eher als gesellschaftlicher Kommentar und weniger als Horrorfilm interessant. "Wir" dagegen ist als Genrefilm anarchischer, unorthodoxer und letztlich auch vieldeutiger.

Allegorisches Potenzial ist durchaus angelegt: Die roten Overalls der bösen Doppelgänger erinnern an die Uniformen von Guantanomo-Häftlingen, die Gesellschaftshierarchie zwischen unten und oben ist durchaus buchtstäblich zu verstehen und der zweideutige Originaltitel "Us" legt nahe, dass es hier nicht nur um das Böse in uns, sondern auch um ein konkretes und brutal geteiltes Land geht. All dies sind letztlich aber lose Metaphern, die sich nie ganz greifen lassen. Was bleibt, ist vor allem ein blutiger Klassenkampf und die Gewissheit, dass soziale Rollen in erster Linie erlernt sind - wobei es eine interessante Randnotiz ist, dass die Hautfarbe der Wilsons zwar nie thematisiert wird, ihre bürgerliche Herkunft aber umso mehr.
Peele verbindet seine eher aus dem Indiekino kommende Smartness mit einer Liebe für den Quatsch im Genre. Dabei gelingt ihm überwiegend die Gratwanderung, einen mitreißenden Überlebenskampf zu inszenieren und sich zugleich immer ein wenig ironisch selbst zu beäugen. Man muss Peeles Faible für demonstrativ augenzwinkernde Scherze nicht teilen, aber die Balance aus Komik und Ernst, Experiment und Erzählfluss, beherrscht er über weite Strecken ziemlich beeindruckend. Da mögen manche Entwicklungen und Zusammenhänge im Nachhinein abenteuerlich erscheinen, aber sie fühlen sich doch immer richtig an.
Michael Kienzl
Wir - USA 2019 - Regie: Jordan Peele - Darsteller: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex - Laufzeit: 116 Minuten.
*

Der in schummriges Neonlicht gehüllte Eingangsbereich einer Polizeiwache ist leer, bis auf einen Beamten, der an der Rezeption auf seinen Computerbildschirm starrt. Die erste Einstellung, statisch und über drei Minuten lang, akzentuiert die Leere dieses Schauplatzes, das durch und durch Unwirtliche an ihm. Durch die Tür, rechts im Bild, kommt eine junge Frau, klein, zierlich, mit hängenden Schultern, wie in sich zusammengefallen. Die Jeans und das T-Shirt verwaschen, ein abgerissenes Basecap verkehrt herum auf dem Kopf. Sie zieht eine Dose aus einem Getränkeautomat, trinkt sie leer, dann schreit sie den Mann an der Rezeption auf Spanisch an, ob er sein ganzes Leben so verbringen möchte.
Nach dem Vorspann befinden wir uns in einer zwielichtigen Bar. Vermutlich aus einem Fernseher, der nicht im Bild ist, plärrt es auf Spanisch in den Raum. So wie der auf 16mm gedrehte Film die Körnung und die Verschmutzungen des Materials bewusst als stilistische Mittel einsetzt, so gehören auch Störgeräusche zu seiner Atmosphäre, die sich gemeinsam mit den unheimlichen Synthesizer-Melodien von Simon Waskow schwer über die Bilder legen. Am Tresen sitzen Nora (Julia Riedler) und der Polizei-Psychiater Dr. Rossini (Jan Bluthardt). Sie spricht ihn an, setzt sich zu ihm. Während beide einen Drink nach dem anderen kippen und sie sich Koks aus einem Döschen in ihre Nase schaufelt, erzählt sie von ihrer Freundin Luz, die zuvor aus einem fahrenden Taxi gesprungen sei. Später gemeinsam auf dem Klo lässt Nora statt dem erwartbaren Sex ein gelbes Licht aus ihrem Mund in den konvulsivisch zuckenden Arzt fahren.
Derart von ihr beseelt oder befruchtet, fährt dieser aufs Polizeirevier, wo Luz vernommen werden soll, um die mysteriöse Taxifahrt, bei der sich die beiden Freundinnen nach Jahren wiedergetroffen hatten, genau zu rekonstruieren. Dabei werden nicht nur die Realitätsebenen des Reenactments und des tatsächlichen Geschehens zunehmend brüchig und durchlässig, sondern auf schwer greifbare Weise auch die zwischen den Figuren. Wenn aus Luz' Mund eine Gepäckansage des Flughafens ertönt, scheint es, als sprächen seine Figuren nicht selbst, sondern als würde durch sie gesprochen - wie durch Olarte (Johannes Benecke), der in seinem Glaskasten sitzt und übersetzt, obwohl Luz selbst Deutsch spricht. Auch Nora scheint nicht nur im Körper Rossinis an der Szene beteiligt zu sein, sein Körper verwandelt sich an einer Stelle unmittelbar in den ihren. Verfügen diese sehr buchstäblich intersubjektiven Figuren überhaupt noch über eine eigenständige Subjektivität oder sollen wir sie uns vielmehr als reine Medien vorstellen? Und wenn ja, was genau ist es, dass durch sie zum Ausdruck kommt?

"Luz", dem Debütfilm von Tilman Singer, den er als Abschlussarbeit an der Kölner Filmhochschule vorlegte, geht es mitnichten darum, solche Fragen abschließend zu klären oder die rudimentäre Handlung auf herkömmliche Art aufzulösen. Wenn der Horrorfilm im Allgemeinen und die italienischen Gialli der sechziger und siebziger Jahre im besonderen klare Referenz sind, dann begegnet der Film diesen im Modus narrativer Dekonstruktion, ähnlich, wie man das etwa von David Lynch kennt. Anstatt um eine Erzählung im klassischen Sinne geht es Singer um eine dichte Verknüpfung bestimmter (Leit-)Motive um Schwanger- und Mutterschaft, Besessenheit, Katholizismus, bei der nicht nur das Horrorgenre selbst, sondern auch dessen psychoanalytische Implikationen bzw. Auslegungen mitgedacht werden. Wie man auch an den Film herangehen mag, immer bleibt ein rätselhafter Rest.
So wenig, wie aber das Geheimnisvolle reiner Selbstzweck wäre, geht es der formalen Gestaltung ausschließlich darum, möglichst stylische Einstellungen zu kreieren. Die Bilder von Augenpartien oder Lippen, die die gesamte Leinwand füllen, bauen eine Nähe zu den Figuren auf, die nur deshalb funktionieren kann, weil sie rätselhaft bleiben. Der Saal, in dem das Reenactment geschieht, verwandelt sich mehr und mehr in ein Schlachtfeld im dichten Nebel, in dem nur noch die Leuchtröhren an der Decke Auskunft darüber geben, wo die Szene überhaupt spielt. Das Geschehen im Taxi hingegen bildet nicht etwa den narrativen Kern des Films, sondern eher seinen atmosphärischen, indem es einen Moment großer Intimität schafft, einen Ruhepol, an dem Film und Figuren gleichermaßen zu sich kommen können, weil es nichts gibt außer ihnen und das Licht von draußen, das durch die Scheiben, auf die der Regen prasselt, Schattenspiele auf ihre Gesichter wirft.
Die letzte Einstellung mag den beträchtlichen Reiz des Films verdeutlichen, weil es nicht darauf ankommt, ob es sich bei seiner Auflösung um eine narrative handelt, solange sie visuell funktioniert. Luz wird von einer Beamtin bis zum Tresen begleitet, bekommt ein Formular über ihr Verhör, das sie unterschreibt. Dann verlässt sie den Film durch dieselbe Tür, durch die sie ihn am Anfang betreten hat.
Nicolai Bühnemann
Luz - Deutschland 2018 - Regie: Tilman Singer - Darsteller: Luana Velis, Johannes Benecke, Jan Bluthardt, Lilli Lorenz, Julia Riedler - Laufzeit: 70 Minuten.
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens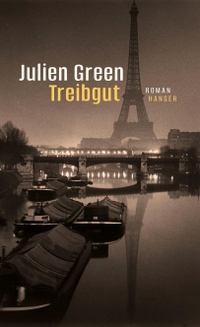 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut