Im Kino
Das Leben in all seinen Formen
Die Filmkolumne. Von Olga Baruk, Jochen Werner
25.08.2021. Pietro Marcellos Filmadaption des Jack-London-Romans "Martin Eden" erzählt die Geschichte eines Aufsteigers und Liebenden mit melancholischer Poesie. Florian Zeller gewinnt dem Demenzthema in "The Father" auch dank Anthony Hopkins und Olivia Coleman einige Spannung ab.
"Piccerè" - "meine Kleine", singt der italienische Komponist und Schlagersänger Daniele Pace über der Vorspannmontage von "Martin Eden". Es geht um eine Liebe, die den Wellen des Meeres gleicht, die über einen hinwegspülen, nur um sich dann aufzulösen in der ewigen Weite des Ozeans. Martin Eden ist ein Seemann, und er ist ein Alter Ego von Jack London, der ihm einen semiautobiografischen Roman, vielleicht seinen besten, gewidmet hat. Den hat nun der italienische Filmemacher Pietro Marcello als Vorlage für seinen ersten narrativen Spielfilm, nach einer Reihe mehr oder minder artifizieller, stark poetisierter Dokumentarfilme, ausgewählt, und von diesen ersten Klängen und Bildern an wird deutlich, dass "Martin Eden" ein durch und durch italienischer Film ist.
Jack Londons Martin Eden ist ein hochintelligenter, aber ungebildeter junger Arbeiter, der seit seinem elften Lebensjahr zur See fährt, der allerlei Abenteuer erlebt hat und vieles von der Welt weiß, aber nichts von den Gepflogenheiten im bildungsbürgerlichen Elternhaus des jungen Mannes, den er vor einem Überfall rettet und der ihn zum Dank (und ein bisschen auch als interessantes Kuriosum) bei einer Abendgesellschaft seiner Familie einführt. Von deren feinen Umgangsformen und der universitären Bildung, die dort allen zuteil wurde, aber auch und insbesondere von der schönen Tochter des Hauses - im Roman Ruth, hier Elena - angezogen, beginnt Martin, sich in eifrigem Selbststudium zu bilden und mit unbändigem Ehrgeiz auf sein neues Ziel hinzuarbeiten: ein Schriftsteller zu werden, ein Intellektueller - aber einer, der nicht nur die Schreibstube und den Salon, sondern die Welt und das Leben in all seinen Formen gesehen hat.
Dass dieses Ziel die Ambitionen und das enge Weltbild der Menschen, in deren Gesellschaft er sich hochzuarbeiten beabsichtigt, sprengt, kann ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst sein - und doch ist von vornherein klar, dass Martin von einer grundlegend anderen Kraft angetrieben wird als Elena, die er durch seine mitreißende Geisteskraft ebenso wie durch Körperlichkeit und Willen tatsächlich für sich gewinnen kann. Er ist ein Liebender, während das Bürgertum, dem anzugehören ihm zunächst als erstrebenswertes Ziel all seiner Anstrengungen erscheint, stets der Konvention und der Mittelmäßigkeit verpflichtet bleibt. Die bittere Enttäuschung all seiner Hoffnungen und Erwartungen scheint vorprogrammiert.
Londons Roman ist ein dickes Buch, dessen Erzählung in ihrer epischen Breite einen jahrelangen Kampf abbildet, um den steinigen Weg zu Bildung und Wissen ebenso wie um das nackte Überleben. Er erzählt von harter Arbeit und Hunger und Armut, von Dingen, die London aus der eigenen Biografie vertraut sind, von unzähligen Rückschlägen und Enttäuschungen und einem schlussendlichen Erfolg, der seinem Protagonisten im Moment, in dem er eintritt, bereits wertlos geworden ist. Es ist die Geschichte des Intellektuellen, dessen Tragik es ist, all jene, die er sich als temporäre Vorbilder erwählt und deren Anerkennung er zu erringen versucht, immer wieder zu übertreffen, nirgends jemals dauerhaft dazuzugehören und schließlich in Einsamkeit zu enden.

Das ist eine zeitlose Geschichte, und diese Zeitlosigkeit macht Pietro Marcello zum zentralen ästhetischen Thema seiner Adaption. Die sinnlichen 16mm-Bilder des weitgehend auf analogem Filmmaterial gedrehten Films werden immer wieder durch vielleicht dokumentarische, vielleicht auch geschickt gefälschte Archivaufnahmen und Viragierungen aufgebrochen, die ebenso wie die mal historische, mal einen Tick zu modern anmutende Ausstattung oder der anachronistische Soundtrack zwischen Italopop und Electronica die zeitliche Verankerung der Adaption des im frühen 20. Jahrhundert erschienenen Romans brüchig werden lassen. Zwar werden am Ende Bücher in Flammen geworfen, ein Krieg bricht aus, und zwischenzeitlich wird eifrig über den Sozialismus und die Revolution debattiert. Aber derart in die Historie geworfene Anker sorgen lediglich dafür, dass Marcellos Adaption keiner schnöde ästhetizistischen, ahistorischen Beliebigkeit anheimfällt; so ganz dingfest machen können sie "Martin Eden" nie.
Der Film weigert sich hartnäckig in der Form des historischen Kostümfilms aufzugehen. Eher scheinen die Zeitebenen permeabel zu werden und sich gegenseitig zu durchdringen, so wie sich Londons uramerikanischer Roman und Marcellos durch und durch europäische, die süditalienischen Schauplätze schwelgerisch ins Bild setzende Inszenierung durchdringen und kontrastieren, um mehr als die Summe ihrer Teile zu werden. Dieses unüberbrückte Neben- und Ineinander der Zeitebenen erinnert ein wenig an Petzolds "Transit", einen weiteren großen Film des gerade vergangenen Jahrzehnts. Während Petzold jedoch eine eher nüchterne Poetik der Lücke entwickelt und so eine Gegenwart erzählt, unter der sich - vielleicht den Büchern W.G. Sebalds vergleichbar - mit jedem Schritt ein Abgrund der Geschichte auftut, da ist es Marcello eher an der melancholischen Poesie einer nie ganz verlorenen Zeit gelegen, die alle anderen Zeiten durchdringt: ein Maelstrom der Geschichte. So betrachtet bekommt sein Martin Eden, dieser optimistische, kraftstrotzende, aber immer schon von vornherein gescheiterte Wanderer zwischen den Zeiten, etwas Geisterhaftes - der Künstler als ewig Unbehauster nicht nur zwischen den gesellschaftlichen Sphären, sondern auch zwischen den Jahrhunderten.
129 Minuten nimmt sich Marcello Zeit, um diesen langen, traurigen Bildungsroman für die Kinoleinwand zu erzählen, und seine Inszenierung ist durch und durch eine der Seduktion: seine großartigen Schauspieler setzt er in Nah- und Detailaufnahmen ins Bild, und wenn Elena immer wieder direkt in die Kamera spricht, soll sie nicht nur Martin erst verführen, um ihm dann das Herz zu brechen, sondern auch uns. Die Schönheit des Filmmaterials, der Inszenierung, die unkonventionelle, brüchige Form, all das beschwört die Schönheit herauf, der Martin ein, vielleicht mehrere Leben lang nachjagt - "Martin Eden" ist der Film eines Liebenden über einen Liebenden, inszeniert von einem Filmemacher, der uns zwei Kinostunden lang glauben machen könnte, dass das Kino und die Schönheit uns retten.
Jochen Werner
Martin Eden - Italien 2019 - Regie: Pietro Marcello - Darsteller: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Marco Leonardi, Carlo Cecchi, Denise Sardisco - Laufzeit: 129 Minuten.
---

Jeder Wandel ist schleichend. Anthony Hopkins spielt (und wie er spielt!) einen Mann, der zwischen Sessel, Bett und Speisetisch einer vornehmen Londoner Wohnung lebt. Trotz des hohen Alters und zunehmender Vergesslichkeit will er sich nicht helfen lassen, jede Bevormundung lehnt er entschieden ab. Selbst dann, als ihm zunehmend Widersprüchliches geschieht. "Ich rieche den Braten", sagt er. Anthony ahnt eine Verschwörung gegen ihn, wird laut und bissig und beschuldigt seine Tochter Anne, die sich mit beeindruckender Selbstaufopferung um ihn kümmert. Eine Nervensäge! So sei Anne schon immer gewesen, ganz anders als ihre Schwester Lucy, die eine Künstlerin geworden ist, das Bild dort an der Wand habe Lucy gemalt, schön, nicht wahr? Solche Sachen erzählt er der frisch engagierten Pflegerin, während Anne die Drinks serviert.
Der Wandel ist schleichend und dabei bleibt es nicht. Es passieren Déjà-vus, darin verschieben oder verkrümmen sich Dinge, mal stückweit und mal ganz arg. Zum Abendessen gibt es immer nur Hühnchen. Die Gespräche ähneln sich, nehmen aber von mal zu mal ein anderes Ende. Anne (eine Schauspielerin von wunderbar warmer Präsenz: Olivia Colman) trägt plissierte Seidenblusen, die es in genau zwei Ausführungen gibt: blau und cremeweiß. Achten Sie auf Farben und Möbelstücke der Ausstattung! Auch hier ist nämlich nichts mehr sicher. Menschen, Umgebung, die Zeit - alles rutscht weg. "The Father" ist ein Film über Alzheimer und darüber, was diese Krankheit für alle Betroffenen bedeutet, wie sie sich anfühlt, wie sie aussieht, sich anhört. Ein Film darüber, was Demenz aus jedem so vertrauten Alltag macht - ein Rätselspiel, eine Tragödie, ein Tapp- und Tastwahnsinn in einer wechselnden Abfolge von Gereiztheit und Horror. Ruhe gibt es selten.

Um es vorwegzunehmen: Der Film ist erschütternd, das Ende - herzzerreißend. Dennoch verbleibt er nicht nur im Modus eines Dramas, "The Father" ist auch als raffinierter Thriller sehr gelungen, eine außerordentlich spannende Mischform. Anthonys Symptome - die Gedächtnislücken, die falschen Sicherheiten - wissen der französische Autor und Regisseur Florian Zeller und sein Team geschickt in intensive Spannung zu übersetzen. Paul, Annes arroganter Ehemann: Wie lange hat Anthony bitte noch vor, allen auf den Geist zu gehen: "How long are you planning to hang on everybody's tits?". Ist Paul eine Bedrohung? Eine Mordfantasie zu Beginn (es ist nicht klar, in wessen Kopf sie sich abspielt) wirft Schatten auch über harmlose Bilder.
"The Father" ist die erste Regiearbeit Zellers. Der "spannendste Dramatiker unserer Zeit" (The Guardian) adoptiert hier sein zum ersten Mal 2012 in Paris aufgeführtes Theaterstück. Auch sein Co-Autor Christopher Hampton kommt vom Theater, wenngleich mit erfolgreichen Ausflügen nach Hollywood. Drehbücher etwa zu "Gefährliche Liebschaften" (1988) und "Eine dunkle Begierde" (2011) stammen von ihm, daneben zahlreiche Romanadaptionen und Übersetzungen fremdsprachiger Autorinnen und Autoren. Auf der Seite des British Council ist nachzulesen, dass Hampton für sein vielfältiges Talent bereits "easy populism" vorgeworfen wurde. Der Vorwurf ist grotesk, das Drehbuch der beiden Autoren - klug, rund, großartig gelungen.
Am meisten zeichnet "The Father" aber seine bizarre Eleganz aus. Bizarr ist sie, weil dieses perfekte Zusammenspiel aller filmischen Elemente gar nicht dem fasrigen Sujet zu entsprechen scheint. Und es doch tut. Sie werden den Film vermutlich lieben, aber Vorsicht: "The Father" erzählt mehr von menschlicher Existenz, als einem lieb ist. Am Schluss zeigt sich - was sonst - ein Haufen Pixel.
Olga Baruk
The Father - UK 2020 - Regie: Florian Zeller - Darsteller: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Evie Wray, Rufus Sewell - Lauzeit: 98 Minuten.
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens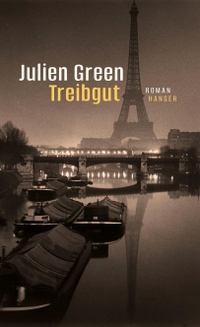 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut