Magazinrundschau
Die Kunst des guten Kopierens
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
20.04.2010. In Salon erklärt Viktor Jerofejew, was Katyn für die Russen bedeutet. In n+1 bewundert Brian Ferneyhoughs Willen zur Avantgarde. Open democracy prophezeit Europa eine stürmische Zeit mit Viktor Orban. In Elet es Irodalom bewundert Laszlo Krasznahorkai die Weisheit Peter Eötvös'. The Nation feiert die badenden Schönheiten des tschechischen Fotografen Miroslav Tichy. "Pissoirliteratur" ruft in Le Monde Michel Onfray all denen zu, die im Internet ein Buch verrissen haben, das ihm gefällt. In der London Review würdigt Benjamin Kunkel den majestätischen Stil des marxistischen Denkers Fredric Jameson. Der Boston Globe singt ein Loblied auf die Copycats.
Salon.eu.sk (Slowakei), 17.04.2010
 Der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew schreibt über Katyn und das komplizierte Verhältnis zwischen Polen und Russland. Obwohl auch die Deutschen den Polen übel mitgespielt haben, "zeigt die polnische Emigration nach Deutschland, dass die Polen die deutsche Zivilisation mögen und sich gern darin verlieren. Natürlich hat das auch geholfen, Wunden zu heilen. Russland dagegen ist das feindliche Land geblieben, das Polen erobert hat, nicht weil es besser oder stärker war, sondern weil es für den Sieg eine riesige Anzahl der eigenen Leute geopfert hat, wie eine benebelte Frau, der es egal ist, ob sie im Schlaf einen aus ihrer zahllosen Brut erdrückt. Es ist also kaum überraschend, dass Russland mit der selben faulen Indifferenz seinen potentiellen Widersacher zerquetscht, mit der jemand mit einem Handtuch nach einer Biene schlägt, bevor sie nur versucht hat, ihn zu stechen. Darum geht es bei Katyn. ... Jeder Pole weiß Bescheid über Katyn, während die Russen nur eine vage Vorstellung davon haben. Während es für erstere ein Ereignis von apokalyptischen Ausmaßen war, war es für letztere bestenfalls eine ganz gewöhnliche Kriegstragödie. Und darum kann Russlands Bedauern für die Polen nie groß genug sein, während die Forderungen der Polen für die russischen Autoritäten zu viel sind."
Der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew schreibt über Katyn und das komplizierte Verhältnis zwischen Polen und Russland. Obwohl auch die Deutschen den Polen übel mitgespielt haben, "zeigt die polnische Emigration nach Deutschland, dass die Polen die deutsche Zivilisation mögen und sich gern darin verlieren. Natürlich hat das auch geholfen, Wunden zu heilen. Russland dagegen ist das feindliche Land geblieben, das Polen erobert hat, nicht weil es besser oder stärker war, sondern weil es für den Sieg eine riesige Anzahl der eigenen Leute geopfert hat, wie eine benebelte Frau, der es egal ist, ob sie im Schlaf einen aus ihrer zahllosen Brut erdrückt. Es ist also kaum überraschend, dass Russland mit der selben faulen Indifferenz seinen potentiellen Widersacher zerquetscht, mit der jemand mit einem Handtuch nach einer Biene schlägt, bevor sie nur versucht hat, ihn zu stechen. Darum geht es bei Katyn. ... Jeder Pole weiß Bescheid über Katyn, während die Russen nur eine vage Vorstellung davon haben. Während es für erstere ein Ereignis von apokalyptischen Ausmaßen war, war es für letztere bestenfalls eine ganz gewöhnliche Kriegstragödie. Und darum kann Russlands Bedauern für die Polen nie groß genug sein, während die Forderungen der Polen für die russischen Autoritäten zu viel sind."Polityka (Polen), 16.04.2010
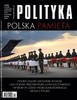 Der Journalist und Mitbegründer der Gazeta Wyborcza Jacek Zakowski fand (hier auf Deutsch) Lech Kaczynski als Mensch eigentlich sehr sympathisch. Er passte gar nicht so recht in die PiS, meint er. "Seine menschliche Größe, seine Zurückhaltung und seine ideelle Identität unterschieden Lech Kaczynski von seiner politischen Basis. Aber sie konnten ihn vor dieser Basis nicht schützen. Erstens ermöglichte die Partei keine Zusammenarbeit mit vielen sehr kompetenten Personen, die für den Präsidenten akzeptable Ansichten hatten. Zweitens verführte der aus der Tradition Pilsudskis geborene Kult der politischen 'Härte' im Namen der Staatsraison diejenigen Personen aus der politischen Basis, denen es an Empathie und oft auch an Kompetenz fehlte, dazu, die verschiedensten Radikalismen zu entwickeln. Besonders in Fragen, in denen sich Kaczynski selbst nicht auskannte, sprich in Wirtschaftsfragen und internationalen Angelegenheiten."
Der Journalist und Mitbegründer der Gazeta Wyborcza Jacek Zakowski fand (hier auf Deutsch) Lech Kaczynski als Mensch eigentlich sehr sympathisch. Er passte gar nicht so recht in die PiS, meint er. "Seine menschliche Größe, seine Zurückhaltung und seine ideelle Identität unterschieden Lech Kaczynski von seiner politischen Basis. Aber sie konnten ihn vor dieser Basis nicht schützen. Erstens ermöglichte die Partei keine Zusammenarbeit mit vielen sehr kompetenten Personen, die für den Präsidenten akzeptable Ansichten hatten. Zweitens verführte der aus der Tradition Pilsudskis geborene Kult der politischen 'Härte' im Namen der Staatsraison diejenigen Personen aus der politischen Basis, denen es an Empathie und oft auch an Kompetenz fehlte, dazu, die verschiedensten Radikalismen zu entwickeln. Besonders in Fragen, in denen sich Kaczynski selbst nicht auskannte, sprich in Wirtschaftsfragen und internationalen Angelegenheiten."Krytyka Polityczna (Polen), 19.04.2010
Das Unglück von Smolensk bleibt das wichtigste Thema in Polen. Es herrscht kollektive Trauer, aber einige scheren aus und äußern sich auf der Webseite der linksintellektuellen Zeitschrift Krytyka Polityczna. "Schon seit Samstag habe ich den Eindruck, dass wir einen absurden Herdentrieb beobachten, nicht Trauer", schreibt etwa die Regisseurin Malgorzata Szumowska. "Trauer, wie ich sie auf dem polnischen Land erlebt habe, soll den Tod zähmen. Sie hat nichts von Hysterie oder Erhebung. Die Trauer, die ich im Fernsehen sehe, in den polnischen Straßen, hat mit der Zähmung des Todes nichts zu tun. Es ist eine kollektive Hysterie, ein Gemeinschaftsakt, den die Polen wie die Luft zum Atmen brauchen. Wir sind wohl die einzige Nation in Europa, die zu so etwas fähig ist, im Namen der eigenen Exaltiertheit, des Erlebens von etwas Großem, im Namen des Patriotismus."
Außerdem: Auch die Schriftstellerin und feministische Aktivistin Manuela Gretkowska versucht sich an einer psychologischen Deutung der Ereignisse: "Die Polen fühlen sich nicht als Bürger, sie haben keinen Anteil am Regieren; die nationale Trauer ist ein außergewöhnlicher Moment, in dem sie sich bedeutend und geeint fühlen können." Und in einem Gastkommentar prophezeit der konservative Publizist Cezary Michalski, dass die nationale Einheit nicht lange anhalten wird: "Mit der Beschwörung des Ereignisses, das über jegliche Politik hinaus geht, wird gnadenlose Politik betrieben werden. Es wird ein brutaler Machtkampf stattfinden. In Ausschnitten publiziert werden ferner die Stellungnahmen Olga Tokarczuks für die New York Times (hier auf Polnisch) und Slawomir Sierakowskis für den "Freitag" (hier auf Polnisch, hier auf Deutsch).
Außerdem: Auch die Schriftstellerin und feministische Aktivistin Manuela Gretkowska versucht sich an einer psychologischen Deutung der Ereignisse: "Die Polen fühlen sich nicht als Bürger, sie haben keinen Anteil am Regieren; die nationale Trauer ist ein außergewöhnlicher Moment, in dem sie sich bedeutend und geeint fühlen können." Und in einem Gastkommentar prophezeit der konservative Publizist Cezary Michalski, dass die nationale Einheit nicht lange anhalten wird: "Mit der Beschwörung des Ereignisses, das über jegliche Politik hinaus geht, wird gnadenlose Politik betrieben werden. Es wird ein brutaler Machtkampf stattfinden. In Ausschnitten publiziert werden ferner die Stellungnahmen Olga Tokarczuks für die New York Times (hier auf Polnisch) und Slawomir Sierakowskis für den "Freitag" (hier auf Polnisch, hier auf Deutsch).
n+1 (USA), 17.04.2010
 Nikil Saval schreibt eine leidenschaftliche Verteidigung von Brian Ferneyhoughs und Charles Bernsteins "bizarrer" Oper "Shadowtime", eines Stücks über Walter Benjamin, das es offensichtlich schafft, sämtliche Klischees der von Saval verspotteten "Benjamin-Industrie" zu umgehen, allein durch einen Willen zu Avantgarde, Schwierigkeit und Absurdität: "Die Oper schien sich als ein zerstörtes Kunstwerk präsentieren zu wollen, zerbrochen in Fragmente einer absichtlich unverständlichen Erzählung. Eine Musik, die sich fast erfolgreich der Erfahrung entzieht; ein Text, der zwischen Benjamins eigener Sprache und purem Kauderwelsch zu schweben scheint. Es wäre relativ einfach gewesen, Benjamins Leben zu erzählen, bis hin zum Selbstmord an der spanischen Grenze. Aber Bernstein und Ferneyhough haben sich dieser Perspektive auf meisterhafte Art verweigert." (Hier eine Hörprobe bei Youtube)
Nikil Saval schreibt eine leidenschaftliche Verteidigung von Brian Ferneyhoughs und Charles Bernsteins "bizarrer" Oper "Shadowtime", eines Stücks über Walter Benjamin, das es offensichtlich schafft, sämtliche Klischees der von Saval verspotteten "Benjamin-Industrie" zu umgehen, allein durch einen Willen zu Avantgarde, Schwierigkeit und Absurdität: "Die Oper schien sich als ein zerstörtes Kunstwerk präsentieren zu wollen, zerbrochen in Fragmente einer absichtlich unverständlichen Erzählung. Eine Musik, die sich fast erfolgreich der Erfahrung entzieht; ein Text, der zwischen Benjamins eigener Sprache und purem Kauderwelsch zu schweben scheint. Es wäre relativ einfach gewesen, Benjamins Leben zu erzählen, bis hin zum Selbstmord an der spanischen Grenze. Aber Bernstein und Ferneyhough haben sich dieser Perspektive auf meisterhafte Art verweigert." (Hier eine Hörprobe bei Youtube)Open Democracy (UK), 15.04.2010
 "Das Leben mit Viktor Orban wird stürmisch werden", meint Anton Pelinka nach dem Wahlsieg von Orbans nationalkonservativer Partei Fidesz und dem bestürzenden Wahlerfolg (16,7 Prozent) der rechtsextremen Jobbik in Ungarn. Orban selbst mag kein Rechter sein, "aber er und seine Regierung stehen vor einer großen Herausforderung. Ein wichtiger Grund für den tiefen Fall der Linken ist die Weltwirtschaftskrise, die Ungarn härter getroffen hat als fast alle anderen postkommunistischen Länder in Mittelosteuropa. Da globale Bedingungen die Konturen dieser Krise formen, wird Ungarns neuer Premierminister in der nahen Zukunft keinen nennenswerten Aufschwung produzieren können. Die Arbeitslosigkeit wird hoch bleiben, und Fidesz wird weiterführen müssen, was schon ihr sozialistischer Vorgänger getan hat - eine Politik der Bescheidenheit. Viele Fidesz-Wähler werden enttäuscht sein. Das bringt Jobbik ins Bild."
"Das Leben mit Viktor Orban wird stürmisch werden", meint Anton Pelinka nach dem Wahlsieg von Orbans nationalkonservativer Partei Fidesz und dem bestürzenden Wahlerfolg (16,7 Prozent) der rechtsextremen Jobbik in Ungarn. Orban selbst mag kein Rechter sein, "aber er und seine Regierung stehen vor einer großen Herausforderung. Ein wichtiger Grund für den tiefen Fall der Linken ist die Weltwirtschaftskrise, die Ungarn härter getroffen hat als fast alle anderen postkommunistischen Länder in Mittelosteuropa. Da globale Bedingungen die Konturen dieser Krise formen, wird Ungarns neuer Premierminister in der nahen Zukunft keinen nennenswerten Aufschwung produzieren können. Die Arbeitslosigkeit wird hoch bleiben, und Fidesz wird weiterführen müssen, was schon ihr sozialistischer Vorgänger getan hat - eine Politik der Bescheidenheit. Viele Fidesz-Wähler werden enttäuscht sein. Das bringt Jobbik ins Bild."Elet es Irodalom (Ungarn), 16.04.2010
 Der Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai sprach mit dem Komponisten Peter Eötvös über dessen im Münchner Nationaltheater im Februar uraufgeführte Oper "Die Tragödie des Teufels" (Youtube), eine Reflexion (Libretto: Albert Ostermaier) auf Imre Madachs (1823-1864) Schöpfungsdrama "Die Tragödie des Menschen", in dessen Mittelpunkt nicht mehr Adam, sondern Luzifer steht. Krasznahorkai lobt die weise Entscheidung von Eötvös und Ostermaier, diesen Schöpfungsmythos nicht in der Dualität des reinen Guten und reinen Bösen dargestellt zu haben: "Dies wäre zu schematisch, zu zoroastrisch, und diese primitive Dualität kommt heute nicht mehr gut an, die Wahrnehmung des heutigen Menschen ist ein wenig komplizierter geworden. Einerseits glaubt er nicht mehr, dass das Schöpfungsdrama anhand des menschlichen Schicksals wie auf einem Modellbau-Tisch dargestellt werden kann - schließlich denken wir auch nicht mehr, dass im Zentrum dieser Schöpfung der Mensch steht; andererseits hat der heutige Mensch nicht mehr jene Naivität, mit der beispielsweise der Mensch des Mittelalters die Teilnehmer dieses großen Schöpfungsdramas personifizieren konnte. Wir können nicht mehr daran glauben, dass das Böse eine Person ist, weil es uns vielmehr als eine mathematische oder physikalische Konstante bekannt geworden ist. Für uns ist Luzifer kein Teufel, der Böses tut, sondern wirklich nur ein Scheitern, Fiasko und Friedhof der intelligenten Fragestellungen und kritischen Anmerkungen, also, wenn du willst, ein gefallener alter Mann in der Schöpfung, der unser ganzes Mitgefühl genießt."
Der Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai sprach mit dem Komponisten Peter Eötvös über dessen im Münchner Nationaltheater im Februar uraufgeführte Oper "Die Tragödie des Teufels" (Youtube), eine Reflexion (Libretto: Albert Ostermaier) auf Imre Madachs (1823-1864) Schöpfungsdrama "Die Tragödie des Menschen", in dessen Mittelpunkt nicht mehr Adam, sondern Luzifer steht. Krasznahorkai lobt die weise Entscheidung von Eötvös und Ostermaier, diesen Schöpfungsmythos nicht in der Dualität des reinen Guten und reinen Bösen dargestellt zu haben: "Dies wäre zu schematisch, zu zoroastrisch, und diese primitive Dualität kommt heute nicht mehr gut an, die Wahrnehmung des heutigen Menschen ist ein wenig komplizierter geworden. Einerseits glaubt er nicht mehr, dass das Schöpfungsdrama anhand des menschlichen Schicksals wie auf einem Modellbau-Tisch dargestellt werden kann - schließlich denken wir auch nicht mehr, dass im Zentrum dieser Schöpfung der Mensch steht; andererseits hat der heutige Mensch nicht mehr jene Naivität, mit der beispielsweise der Mensch des Mittelalters die Teilnehmer dieses großen Schöpfungsdramas personifizieren konnte. Wir können nicht mehr daran glauben, dass das Böse eine Person ist, weil es uns vielmehr als eine mathematische oder physikalische Konstante bekannt geworden ist. Für uns ist Luzifer kein Teufel, der Böses tut, sondern wirklich nur ein Scheitern, Fiasko und Friedhof der intelligenten Fragestellungen und kritischen Anmerkungen, also, wenn du willst, ein gefallener alter Mann in der Schöpfung, der unser ganzes Mitgefühl genießt."Espresso (Italien), 16.04.2010
 E- und U-Kultur, wer braucht eine derartige Unterscheidung, fragt Umberto Eco. Eine Beethoven-Sonate werde zum Klingelton, während Italiens erster internationaler Popstar Alberto Rabagliati mit seinem unvergesslichen "Non dimenticar le mie parole" heute etwas für Feinschmecker sei. Interessant ist auch Dwight Macdonald, den Eco zitiert, der in den 60ern zwischen Hoch- und Massenkultur eine dritte Ebene einzog; den Midcult. "Die Hochkultur, nur damit Sie es wissen, war laut Macdonald repräsentiert von Joyce, Proust, Picasso, während der 'Masscult' von Hollywood-Ausschussware dominiert wurde, von den Titelblättern der Saturday Evening Post und vom Rock (Macdonald war einer jener Intellektuellen, die keinen Fernseher besaßen. Die aufgeschlossensten hatten einen in der Küche stehen). Die dritte Ebene, der Midcult, war eine Mittelkultur, die aus Unterhaltungsware bestand, die auch Anleihen bei der Avantgarde machte, im Grunde aber Kitsch war. Zu diesen Midcult-Produkten zählt Macdonald für die Vergangenheit Alma Tadema und Rostand, für seine zeitgenössische Gegenwart Somerset Maugham, der späte Hemingway und Thornton Wilder."
E- und U-Kultur, wer braucht eine derartige Unterscheidung, fragt Umberto Eco. Eine Beethoven-Sonate werde zum Klingelton, während Italiens erster internationaler Popstar Alberto Rabagliati mit seinem unvergesslichen "Non dimenticar le mie parole" heute etwas für Feinschmecker sei. Interessant ist auch Dwight Macdonald, den Eco zitiert, der in den 60ern zwischen Hoch- und Massenkultur eine dritte Ebene einzog; den Midcult. "Die Hochkultur, nur damit Sie es wissen, war laut Macdonald repräsentiert von Joyce, Proust, Picasso, während der 'Masscult' von Hollywood-Ausschussware dominiert wurde, von den Titelblättern der Saturday Evening Post und vom Rock (Macdonald war einer jener Intellektuellen, die keinen Fernseher besaßen. Die aufgeschlossensten hatten einen in der Küche stehen). Die dritte Ebene, der Midcult, war eine Mittelkultur, die aus Unterhaltungsware bestand, die auch Anleihen bei der Avantgarde machte, im Grunde aber Kitsch war. Zu diesen Midcult-Produkten zählt Macdonald für die Vergangenheit Alma Tadema und Rostand, für seine zeitgenössische Gegenwart Somerset Maugham, der späte Hemingway und Thornton Wilder."The Nation (USA), 03.05.2010
 Jana Prikryl preist die Fotografien meist badender Schönheiten des tschechischen Außenseiterkünstlers Miroslav Tichy, dem das New Yorker ICP eine Ausstellung widmet. In der kommunistischen Tschechoslowakei saß er erst in Gefängnis und Psychiatrie steckte und konnte dann gerade noch als Barfuß-Fotograf arbeiten. "Seine Fotografien sind nicht in der Zeit eingefroren; es scheint eher so, dass sie einmal eingeforen waren und nun langsam auftauen. Tichy schoss sie aufs Geratewohl, unscharf mit Kameras, die er allein aus Schuhkartons und Papprollen und Plexiglas (geschliffen mit Zahnpasta und Asche) herstellte. Die Abzüge sind über- und unterbelichtet, schief ausgeschnitten, zerkratzt, gerissen, übermalt, vermodert und von Getier angenagt, oft wie zufällig; tatsächlich sind die Bilder so durchzogen von zufälligen Spuren, dass die Idee künstlerischer Absicht selbst verschwimmt. John Berger schrieb einst, dass 'Fotografien von einer menschlichen Entscheidung zeugen, die in einer bestimmten Situation getroffen wird'. Tichys Arbeit zeugt von einer so grundlegenden Skepsis gegenüber der menschlichen Entscheidung, dass sich der Kreis schließt: Sie zwingt uns darüber nachzudenken, wer oder was für diese unleugbar sinnträchtigen Bilder verantwortlich ist, und auch zu fragen, ob ihre Fehler kalkuliert sind, um den einzelnen Bilder einen nostalgischen Glanz zu verleihen."
Jana Prikryl preist die Fotografien meist badender Schönheiten des tschechischen Außenseiterkünstlers Miroslav Tichy, dem das New Yorker ICP eine Ausstellung widmet. In der kommunistischen Tschechoslowakei saß er erst in Gefängnis und Psychiatrie steckte und konnte dann gerade noch als Barfuß-Fotograf arbeiten. "Seine Fotografien sind nicht in der Zeit eingefroren; es scheint eher so, dass sie einmal eingeforen waren und nun langsam auftauen. Tichy schoss sie aufs Geratewohl, unscharf mit Kameras, die er allein aus Schuhkartons und Papprollen und Plexiglas (geschliffen mit Zahnpasta und Asche) herstellte. Die Abzüge sind über- und unterbelichtet, schief ausgeschnitten, zerkratzt, gerissen, übermalt, vermodert und von Getier angenagt, oft wie zufällig; tatsächlich sind die Bilder so durchzogen von zufälligen Spuren, dass die Idee künstlerischer Absicht selbst verschwimmt. John Berger schrieb einst, dass 'Fotografien von einer menschlichen Entscheidung zeugen, die in einer bestimmten Situation getroffen wird'. Tichys Arbeit zeugt von einer so grundlegenden Skepsis gegenüber der menschlichen Entscheidung, dass sich der Kreis schließt: Sie zwingt uns darüber nachzudenken, wer oder was für diese unleugbar sinnträchtigen Bilder verantwortlich ist, und auch zu fragen, ob ihre Fehler kalkuliert sind, um den einzelnen Bilder einen nostalgischen Glanz zu verleihen."Und: In einem sehr langen Artikel kommt Jonathan Blitzer dem uruguayischen Schriftsteller Juan Carlos Onetti nicht auf die Spur, ja, er wird nicht einmal richtig warm mit ihm.
Le Monde (Frankreich), 17.04.2010
Die Internet-Kommentare von Lesern seien das zeitgenössische Pendant zur "Pissoirliteratur" früherer Zeiten, schäumt der Philosoph Michel Onfray in einem Debattenbeitrag. Anlass sind hämische und beleidigende Leserkommentare zu einem Buch der Journalistin Florence Aubenas, das er selbst als "rein wie ein Diamant" gelobt und mit Stendhal, Zola und Celine verglichen hat. Und dann stehen im Netz plötzlich die "Rülpser irgendwelcher Zwerge", die das Buch - weil ein Bestseller - nicht einmal gelesen hätten: "Der Sykophant lässt seinen traurigen Affekten freien Lauf: Neid, Eifersucht, Bosheit, Hass, Ressentiment, Verbitterung, Groll etc. Da vernichtet der gescheiterte Koch die Küche eines erfolgreichen Kollegen...; der verhinderte Schriftsteller hält Vorlesungen über ein Buch, das er nur aus dem Fernsehauftritt seines Autors kennt... Der anonyme Kommentar im Internet ist eine virtuelle Guillotine. Er lässt den Impotenten einen abgehen, die nur jubeln, wenn Blut fließt. Morgen ist auch ein noch ein Tag, es reicht, ein bisschen dieses Fernsehen zu schauen, das man angeblich so verabscheut, aber vor dem man sich räkelt, um ein neues Sühneopfer für seine eigene Mittelmäßigkeit, seine Leere, seine geistige Armseligkeit zu finden."
London Review of Books (UK), 22.04.2010
 Der Schriftsteller Benjamin Kunkel nutzt das Erscheinen eines neuen dicken Buchs - "Valences of the Dialectic" (Valenzen des Dialektischen) - mit Essays von Fredric Jameson dazu, den marxistischen Denker als Autor und Theoretiker einmal sehr grundsätzlich zu würdigen: "Die Vorrangstellung, die sich Fredric Jameson unter den englischsprachigen Kritikern seiner Generation erworben hat, wird man kaum bezweifeln können. Nicht zuletzt verdankt sie sich seinem majestätischen Stil, zu dem als herausragendes Merkmal gehört, dass ein Konvoy langer Sätze, die mit Nebensätzen befrachtet und ausbalanciert werden, immer wieder vor Anker geht, um einen griffigen Slogan zu entladen. 'Immer historisieren!' war einer von ihnen... Im vergangenen Vierteljahrundert war Jameson zugleich der zeitgemäßeste und der unzeitgemäßeste aller amerikanischen Kritiker und Autoren. Nicht nur entwickelte er früher als die meisten seiner Kollegen in den Geisteswissenschaften Interessen an Film, Science Fiction und dem Werk Walter Benjamins, er war auch ein Pionier jener Erweiterung des Feldes (James promovierte 1959 in Yale in französischer Literatur) in Richtung Allzwecktheorie, die die Diskussion von allem Möglichen im selben Atemzug zur bewährten akademischen Praxis gemacht hat."
Der Schriftsteller Benjamin Kunkel nutzt das Erscheinen eines neuen dicken Buchs - "Valences of the Dialectic" (Valenzen des Dialektischen) - mit Essays von Fredric Jameson dazu, den marxistischen Denker als Autor und Theoretiker einmal sehr grundsätzlich zu würdigen: "Die Vorrangstellung, die sich Fredric Jameson unter den englischsprachigen Kritikern seiner Generation erworben hat, wird man kaum bezweifeln können. Nicht zuletzt verdankt sie sich seinem majestätischen Stil, zu dem als herausragendes Merkmal gehört, dass ein Konvoy langer Sätze, die mit Nebensätzen befrachtet und ausbalanciert werden, immer wieder vor Anker geht, um einen griffigen Slogan zu entladen. 'Immer historisieren!' war einer von ihnen... Im vergangenen Vierteljahrundert war Jameson zugleich der zeitgemäßeste und der unzeitgemäßeste aller amerikanischen Kritiker und Autoren. Nicht nur entwickelte er früher als die meisten seiner Kollegen in den Geisteswissenschaften Interessen an Film, Science Fiction und dem Werk Walter Benjamins, er war auch ein Pionier jener Erweiterung des Feldes (James promovierte 1959 in Yale in französischer Literatur) in Richtung Allzwecktheorie, die die Diskussion von allem Möglichen im selben Atemzug zur bewährten akademischen Praxis gemacht hat." Weitere Artikel: Neue Bücher über die - derzeit ja noch nicht endgültig vollzogene - Wiederkehr der Konservativen in Großbritannien hat der Philosoph John Gray gelesen. Jonathan Raban ereifert sich über ein für seine Begriffe sehr unoriginelles konservatives Pamphlet von Phillip Blond mit dem provokativen Titel "Red Tory" (Rote Tories). Der Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz kritisiert in einer lesenswerten, aber für den ökonomietheoretisch unbeschlagenen Leser auch nicht ganz anstrengungsfreien Rezension Robert Skidelskys Buch "Keynes: The Return of the Master". Jenny Disky beschäftigt sich in ihrer Tagebuch-Kolumne mit allem, was krabbelt und fleucht.
MicroMega (Italien), 08.04.2010
 Die Italiener nennen ihre Heimat selbst "Bel Paese". Dass das Land gar nicht mehr so schön ist, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, quält einige Beobachter schon länger. In der Tageszeitung Il Fatto Quotidiano, dem 2009 gegründeten und damit jüngsten Blatt in Italien, beklagt Pierfranco Pellizzetti in einem Auszug, dass Italiener nur noch auf drei Gebieten konkurrenzfähig sind, und das auch nicht mehr lange. "Wie sieht es aus mit den Unternehmen in Italien? In Sachen technologischer Innovation schlechter als schlecht. Auch weil die öffentliche Forschung nicht gerade brilliert und - das ist noch weitaus schlimmer - keiner auch nur so tut, als gäbe es zwischen diesem Fakt und der allgemeinen Entwicklung des Landes einen Zusammenhang: die Truppe der Wissenschaftler und die Gruppe der Unternehmen verharren gemeinsam in einem Zustand der Nichtkommunikation. Völlig anders als in den USA oder den wettbewerbsfähigeren europäischen Staaten. Fazit: Seit Jahrzehnten haben wir kein selbst entwickeltes Produkt mehr auf den Markt gebracht. Genauso abgründig ist die Situation auf dem organisatorischen Sektor. Nehmen wir nur drei Sektoren in denen wir eigentlich gut sind: Tourismus, Essen und Logistik. Auch hier verlieren wir immer mehr an Boden."
Die Italiener nennen ihre Heimat selbst "Bel Paese". Dass das Land gar nicht mehr so schön ist, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, quält einige Beobachter schon länger. In der Tageszeitung Il Fatto Quotidiano, dem 2009 gegründeten und damit jüngsten Blatt in Italien, beklagt Pierfranco Pellizzetti in einem Auszug, dass Italiener nur noch auf drei Gebieten konkurrenzfähig sind, und das auch nicht mehr lange. "Wie sieht es aus mit den Unternehmen in Italien? In Sachen technologischer Innovation schlechter als schlecht. Auch weil die öffentliche Forschung nicht gerade brilliert und - das ist noch weitaus schlimmer - keiner auch nur so tut, als gäbe es zwischen diesem Fakt und der allgemeinen Entwicklung des Landes einen Zusammenhang: die Truppe der Wissenschaftler und die Gruppe der Unternehmen verharren gemeinsam in einem Zustand der Nichtkommunikation. Völlig anders als in den USA oder den wettbewerbsfähigeren europäischen Staaten. Fazit: Seit Jahrzehnten haben wir kein selbst entwickeltes Produkt mehr auf den Markt gebracht. Genauso abgründig ist die Situation auf dem organisatorischen Sektor. Nehmen wir nur drei Sektoren in denen wir eigentlich gut sind: Tourismus, Essen und Logistik. Auch hier verlieren wir immer mehr an Boden."Boston Globe (USA), 18.04.2010
Erfindungen sind schön und gut, meint Drake Bennett im Boston Globe, aber Nachahmungen, erklärt ihm Oded Shenkar, Professor für Management und Autor des Buchs "Copycats: How Smart Companies Use Imitation to Gain a Strategic Edge", sind mindestens genauso wichtig. "Wir mögen Imitationen als den bequemen Weg herabsetzen - vor allem verglichen mit wegweisenden Erfindungen - aber es gibt auch eine Kunst des guten Kopierens. Wissenschaftler, die die Dynamik sozialer Systeme modellieren, haben herausgefunden, dass die Frage, wie man kopiert und wann, den entscheidenden Unterschied macht zwischen demjenigen, der seine Konkurrenten überholt, und demjenigen, der als blasser, imitierender Mitläufer abgeschrieben wird. 'Es passiert nicht einfach so, man muss wissen, wie man es macht', sagt Shenkar. 'Was für Innovationen gilt, gilt auch für Imitationen: Man muss es richtig machen.'"
Blätter f. dt. u. int. Politik (Deutschland), 01.04.2010
 Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die Vorratsdatenspeicherung und die Ablehnung der Bankdatenweitergabe an die USA (SWIFT-Abkommen) durch das Europäische Parlament lassen hoffen, dass der Datenschutz künftig eine größere Rolle spielen wird. Von einer europäischen Bürgerrechtsbewegung sind wir aber noch weit entfernt, meint Ralf Bendrath: "Die Debatte um die SWIFT-Abstimmung zeigte allerdings, wie schnell das mediale und politische Echo über den Bürgerrechtsaufstand der Europaparlamentarier verklingen kann. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Die europäische Öffentlichkeit krankt daran, dass sie massenmedial aus nationalen Öffentlichkeiten besteht - und nur auf diese reagieren nationale Regierungen. (...) Das heißt auch: Die Datenschützer müssen sich in erster Linie nicht auf den Weg nach Brüssel, sondern vielmehr nach Madrid, Paris, Prag, Warschau, Athen, Rom und Kopenhagen machen."
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die Vorratsdatenspeicherung und die Ablehnung der Bankdatenweitergabe an die USA (SWIFT-Abkommen) durch das Europäische Parlament lassen hoffen, dass der Datenschutz künftig eine größere Rolle spielen wird. Von einer europäischen Bürgerrechtsbewegung sind wir aber noch weit entfernt, meint Ralf Bendrath: "Die Debatte um die SWIFT-Abstimmung zeigte allerdings, wie schnell das mediale und politische Echo über den Bürgerrechtsaufstand der Europaparlamentarier verklingen kann. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Die europäische Öffentlichkeit krankt daran, dass sie massenmedial aus nationalen Öffentlichkeiten besteht - und nur auf diese reagieren nationale Regierungen. (...) Das heißt auch: Die Datenschützer müssen sich in erster Linie nicht auf den Weg nach Brüssel, sondern vielmehr nach Madrid, Paris, Prag, Warschau, Athen, Rom und Kopenhagen machen."Blogs und SMS können einiges zur Demokratisierung Afrikas beitragen. Und die Afrikaner nutzen die verbesserten Informationsmöglichkeiten, berichtet Geraldine de Bastion: "Einen Überblick zum Stand der afrikanischen Blogger-Community bietet der Aggregator Afrigator, der im Juli 2009 über 10.500 afrikanische Blogs aufführte. Südafrika nimmt mit 62 Prozent (rund 6400) der Blogs den weitaus größten Anteil ein, es folgen Nigeria (1094 Blogs), Kenia (555 Blogs) und Ägypten (325 Blogs). Sieben Prozent (etwa 780) der aufgeführten Blogs lassen sich inhaltlich nicht einem Land zuordnen, sondern thematisieren Afrika im Allgemeinen und werden als überregional klassifiziert."
El Pais Semanal (Spanien), 18.04.2010
"Venezuela ist heute, zusammen mit El Salvador, eines der gewalttätigsten Länder Lateinamerikas. Gewalttätiger als Kolumbien, Brasilien und Mexiko. Und Caracas ist inzwischen die mit Abstand gewalttätigste Stadt Lateinamerikas." Gerardo Zavarce zitiert den Leiter des "Observatorio Venezolano de Violencia", Roberto Briceno Leon. Die Mordrate hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt und betrug 2008 127 Opfer je 100.000 Einwohner. Ein nur scheinbar banaler Grund hierfür ist offensichtlich die massenhafte Verbreitung von Schusswaffen: "86 Prozent aller in Caracas zwischen 1999 und 2006 verzeichneten Morde wurden mit Schusswaffen durchgeführt. Venezuelas rund 27 Millionen Einwohrner verfügen gegenwärtig, legal oder illegal, über rund 12 Millionen Schusswaffen." Hugo Chavez sieht die Sache naturgemäß anders: "Die Verbrecher und viele ihrer kriminellen Banden werden ausgebildet, finanziert und unterstützt durch das konterrevolutionäre Bürgertum und unsere internationalen Feinde, el imperio yanqui und seine Lakaien."
New Yorker (USA), 26.04.2010
 Google, der gerade noch leidenschaftlich bekämpfte größte Feind der Buchindustrie, könnte plötzlich ihr bester Alliierter werden, schreibt Ken Auletta in einem sehr instruktiven Hintergrundartikel zu Ebooks und der Zukunft des Verlagswesens, denn anders als Apple und Amazon erlegt Google den Verlagen keine drastische Bedingungen auf - sofern das Google Books Settlement durchgeht. Dann "wird Google Mitte des Jahres einen Online-Ebooks-Store namens Google Editions eröffnen. Dan Clancy, der Ingenieur, der Google Books leitet, wird dann auch Google Editions übernehmen. Er sagt, dass der Ebooks-Store von Google anders als die von Amazon und Apple für Nutzer mit allen Arten von Geräten offen stehen wird. Google lässt die Verleger den Preis festlegen und wird ein Agenturmodell akzeptieren. Da Google inklusive rechtefreier Bücher schon zwölf Millionen Titel digitalisiert hat, wird es auch über ein wesentlich größeres Angebot verfügen als Apple und Amazon."
Google, der gerade noch leidenschaftlich bekämpfte größte Feind der Buchindustrie, könnte plötzlich ihr bester Alliierter werden, schreibt Ken Auletta in einem sehr instruktiven Hintergrundartikel zu Ebooks und der Zukunft des Verlagswesens, denn anders als Apple und Amazon erlegt Google den Verlagen keine drastische Bedingungen auf - sofern das Google Books Settlement durchgeht. Dann "wird Google Mitte des Jahres einen Online-Ebooks-Store namens Google Editions eröffnen. Dan Clancy, der Ingenieur, der Google Books leitet, wird dann auch Google Editions übernehmen. Er sagt, dass der Ebooks-Store von Google anders als die von Amazon und Apple für Nutzer mit allen Arten von Geräten offen stehen wird. Google lässt die Verleger den Preis festlegen und wird ein Agenturmodell akzeptieren. Da Google inklusive rechtefreier Bücher schon zwölf Millionen Titel digitalisiert hat, wird es auch über ein wesentlich größeres Angebot verfügen als Apple und Amazon."
Kommentieren







