Magazinrundschau
Fürst der Unordnung
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
21.09.2021. Atlantic lernt, warum der Investor Peter Thiel nur Moonshots liebt. Vielleicht verkörpert er damit die Essenz des Libertarismus, vermutet die LRB, die uns außerdem in die sinistre Welt des Rohstoffhandels einführt. Das New York Magazine feiert Gaetano Pesce, der etwas Asche in die blutigen Stigmata der Hand Christi streut. Wired kuschelt mit Hopepunk. Die NYT berichtet über die systematische Entrechtung von Muslimen in der indischen Provinz Assam durch ein neues Staatsbürgergesetz. Africa is a Country fragt: Was ist Whiteness in Nordafrika?
The Atlantic (USA), 14.09.2021
 Sebastian Mallaby porträtiert das Valley-wiz-kid Peter Thiel, wobei Thiel mit seinen 54 Jahren schon ein alter Hase ist. Aus Max Chafkins Biografie über den Trump-Unterstützer Thiel erfährt er, wie Thiel als Student gemobbt wurde und worin das Geheimnis seines Erfolgs besteht: "Beim Venture Investment zeitigt Thiels Nonkonformismus die besten Ergebnisse. Sogar verglichen mit den nonkonformistischen Standards des Valleys ist Thiels Investment-Stil anregend zu nennen. Vielleicht wegen des Einflusses des Philosophen René Girard unterscheidet er besonders streng zwischen Nachahmer-Start-ups, die er verachtet, und wirklich originellen 'Moonshots', von denen viele scheitern, einige jedoch eine ganz neue Branche etablieren. Der einfache Weg für jeden Unternehmensgründer besteht darin, mehr von etwas Vertrautem zu machen. Im Gegensatz dazu gibt es keine bestimmte Formel für die Hervorbringung neuer Technologien oder Produkte, aber Thiel hat eine Strategie, die zu funktionieren scheint (und die wahrscheinlich aus seiner Zeit in Stanford stammt): Er bekämpft etablierte Weisheiten. Er argumentiert nach Grundprinzipien. Er fördert eigenwillige Außenseiter. Wie er in seinem Buch 'Zero to One' argumentiert, tappen Unternehmer, die nicht radikal ungewöhnlich agieren, in Girards Falle. Sie entwickeln vernünftige Pläne, die, eben weil sie vernünftig sind, auch anderen einfallen. Sie erschaffen keine neue Form oder einen neuen sozialen Maßstab. Im Wettbewerb mit der Konkurrenz werden sie keine Gewinne erzielen." (Einen Auszug aus Chafkins Thiele-Biografie kann man bei Bloombergs lesen.)
Sebastian Mallaby porträtiert das Valley-wiz-kid Peter Thiel, wobei Thiel mit seinen 54 Jahren schon ein alter Hase ist. Aus Max Chafkins Biografie über den Trump-Unterstützer Thiel erfährt er, wie Thiel als Student gemobbt wurde und worin das Geheimnis seines Erfolgs besteht: "Beim Venture Investment zeitigt Thiels Nonkonformismus die besten Ergebnisse. Sogar verglichen mit den nonkonformistischen Standards des Valleys ist Thiels Investment-Stil anregend zu nennen. Vielleicht wegen des Einflusses des Philosophen René Girard unterscheidet er besonders streng zwischen Nachahmer-Start-ups, die er verachtet, und wirklich originellen 'Moonshots', von denen viele scheitern, einige jedoch eine ganz neue Branche etablieren. Der einfache Weg für jeden Unternehmensgründer besteht darin, mehr von etwas Vertrautem zu machen. Im Gegensatz dazu gibt es keine bestimmte Formel für die Hervorbringung neuer Technologien oder Produkte, aber Thiel hat eine Strategie, die zu funktionieren scheint (und die wahrscheinlich aus seiner Zeit in Stanford stammt): Er bekämpft etablierte Weisheiten. Er argumentiert nach Grundprinzipien. Er fördert eigenwillige Außenseiter. Wie er in seinem Buch 'Zero to One' argumentiert, tappen Unternehmer, die nicht radikal ungewöhnlich agieren, in Girards Falle. Sie entwickeln vernünftige Pläne, die, eben weil sie vernünftig sind, auch anderen einfallen. Sie erschaffen keine neue Form oder einen neuen sozialen Maßstab. Im Wettbewerb mit der Konkurrenz werden sie keine Gewinne erzielen." (Einen Auszug aus Chafkins Thiele-Biografie kann man bei Bloombergs lesen.)Und in einem weiteren Beitrag prügelt Ian Bogost auf das E-Book ein und sucht nach einem triftigen Grund, warum er dem herkömmlichen Buch so viel mehr abgewinnen kann: Es ist seine Buchmäßigkeit! "Angesichts der langen Geschichte der Buchmäßigkeit ist ein Buch weniger irgendein spezifisches Ding als ein Echo der langen Geschichte der Buchmacherei - und eine Hommage an die Idee von einem Buch, individuell und kollektiv, wie sie in unseren Köpfen existiert. Das unterscheidet Bücher von anderen menschlichen Technologien. Der Mensch musste schon immer essen, aber die Methoden der Landwirtschaft, der Konservierung und Verteilung haben sich weiterentwickelt. Der Mensch wollte sich schon immer fortbewegen, aber der Verkehr hat dafür schnellere und spezialisiertere Möglichkeiten erschlossen. Ideen und Informationen haben ebenfalls einen technologischen Wandel erfahren - Kino, Fernsehen und Computer, um nur einige zu nennen, haben den Ausdruck verändert. Aber wenn es ums Sammeln von Wörtern und Bildern geht, die zuerst auf Seiten und dann zwischen Deckeln gepresst werden, ist das Buch weitgehend gleich geblieben. Damit stehen Bücher auf Augenhöhe mit anderen Super-Erfindungen der menschlichen Zivilisation, mit Straßen, Mühlen, Zement, Turbinen, Glas und dem mathematischen Konzept der Null."
London Review of Books (UK), 20.09.2021
 Laleh Khalili bekommt mit dem Buch "The World for Sale" von Javier Blas und Jack Farchy Einblick in die sinistre Welt des Rohstoffhandels, der seit den Zeiten der East India Company schillernde Firmen wie Cargill, Glencore, Trafigura und Vitol hervorgebracht hat, mit legendären Gestalten wie Mark Rich, der mit Hilfe der Deutschen Bank Israel zu einer geheimen Pipeline für Öl aus dem Iran verhalf: "Händler und Kaufleute wurden schon immer - ob frei- oder widerwillig - als Vorhut mächtiger Staaten eingesetzt. 'The World for Sale' beginnt 2011 mit dem verstorbenen Ian Taylor, dem Chef von Vitol, an Bord eines Privatjets auf dem Weg nach Bengasi in Libyen. Vitol, die größte Ölhandelsfirma der Welt, war von der Regierung in Katar gefragt worden, ob sie Diesel, Benzin und Heizöl an die Rebellen liefern würde, die gegen Muammar al-Gaddafi kämpften. Weil die Rebellen über kein Bargeld verfügten, hatte Taylor vereinbart, stattdessen Rohöl von den libyschen Ölfeldern am ägyptischen Ende einer Pipeline entgegenzunehmen. Natürlich hatte er sich die Erlaubnis der britischen Regierung für dieses Geschäft gesichert, ebenso wie eine Ausnahme von Sanktionen der USA. Vitol schmierte den Krieg in Libyen auf Geheiß ausländischer Mächte, aber Taylor behauptete, sein Handeln sei nicht politisch. Dies scheint das Mantra der von Javier Blas und Jack Farchy befragten Titanen des Rohstoffhandels zu sein: "Wir machen keine Politik, wir sind nur wegen des Geldes hier'."
Laleh Khalili bekommt mit dem Buch "The World for Sale" von Javier Blas und Jack Farchy Einblick in die sinistre Welt des Rohstoffhandels, der seit den Zeiten der East India Company schillernde Firmen wie Cargill, Glencore, Trafigura und Vitol hervorgebracht hat, mit legendären Gestalten wie Mark Rich, der mit Hilfe der Deutschen Bank Israel zu einer geheimen Pipeline für Öl aus dem Iran verhalf: "Händler und Kaufleute wurden schon immer - ob frei- oder widerwillig - als Vorhut mächtiger Staaten eingesetzt. 'The World for Sale' beginnt 2011 mit dem verstorbenen Ian Taylor, dem Chef von Vitol, an Bord eines Privatjets auf dem Weg nach Bengasi in Libyen. Vitol, die größte Ölhandelsfirma der Welt, war von der Regierung in Katar gefragt worden, ob sie Diesel, Benzin und Heizöl an die Rebellen liefern würde, die gegen Muammar al-Gaddafi kämpften. Weil die Rebellen über kein Bargeld verfügten, hatte Taylor vereinbart, stattdessen Rohöl von den libyschen Ölfeldern am ägyptischen Ende einer Pipeline entgegenzunehmen. Natürlich hatte er sich die Erlaubnis der britischen Regierung für dieses Geschäft gesichert, ebenso wie eine Ausnahme von Sanktionen der USA. Vitol schmierte den Krieg in Libyen auf Geheiß ausländischer Mächte, aber Taylor behauptete, sein Handeln sei nicht politisch. Dies scheint das Mantra der von Javier Blas und Jack Farchy befragten Titanen des Rohstoffhandels zu sein: "Wir machen keine Politik, wir sind nur wegen des Geldes hier'."David Runciman entnimmt Max Chafkins Porträt des Investors Peter Thiel, dass dieser natürlich kein echter Libertär ist, sondern nur den Sozialstaat hasst. Er selbst verdient sein Geld nämlich am liebsten mit staatlichen Aufträgen, etwa wenn sein AI-Unternehmen Palantir den militärischen Geheimdiensten Schlangenöl verkauft: "Er möchte, dass der Einzelne frei entscheiden kann, wo, wann und wie er Steuern zahlt - und an wen. Er glaubt an die Schaffung von Monopolen durch innovative Technologien und den Einsatz dieser Technologien, um die unhaltbare und überholte Monopolmacht des modernen Staates zu brechen, einschließlich seiner Macht, Geld zu drucken. Was sich mit dieser Philosophie nur schwer vereinbaren lässt, ist die Tatsache, dass Thiel den Großteil seines eigenen Geldes durch die Ausnutzung der Monopolmacht des Staates verdient hat, um sich lukrative Verteidigungsaufträge zu sichern. Wie kann ein Libertärer mit Staatsfonds, dem militärisch-industriellen Establishment und dem Sicherheitsstaat auf Tuchfühlung gehen? Eine mögliche Antwort ist, dass Thiel gar kein Libertärer ist. ... Die andere Möglichkeit ist jedoch, dass dies die Essenz des Libertarismus ist", den Runciman mit Robert Nozicks 1974 erschienenem Buch "Anarchy, State and Utopia" beschreibt.
HVG (Ungarn), 16.09.2021
 Péter Hamvay stellt eine Studie von Luca Kristóf vor, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die die Veränderungen innerhalb der ungarischen kulturellen Elite und die Auswirkungen des durch die Regierung seit 2010 forcierten Elitenwechsels untersucht wurden. Zwar sind die Veränderungen beträchtlich, aber die kulturelle Elite erwies sich zumindest in den letzten elf Jahren am resistentesten im Vergleich zu anderen Eliten des Landen. Die Situation lässt sich immer noch mit den Worten des verstorbenen Péter Esterházy beschreiben: "Einen Staatssekretär kann man ernennen, einen Dichter nicht." Vergeblich, so Hamvay, "wurden aus beinahe allen Institutionen die linksliberalen Künstler hinausgefegt, denn in den breiten Schichten der Gesellschaft werden sie weiterhin als maßgeblich betrachtet. (...) Laut der Studie wurde seit 2010 ein Viertel der kulturellen Elite ausgetauscht. Die Veränderung - die gleichzeitig ein Rechtsruck ist - betraf mit ca. 50 Prozent in erster Linie die Leitung der kulturellen Institutionen sowie die Medien, was erheblich ist. Dennoch gelang der Austausch der kulturellen Elite nicht in dem Maße wie zum Beispiel in der Wirtschaft."
Péter Hamvay stellt eine Studie von Luca Kristóf vor, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die die Veränderungen innerhalb der ungarischen kulturellen Elite und die Auswirkungen des durch die Regierung seit 2010 forcierten Elitenwechsels untersucht wurden. Zwar sind die Veränderungen beträchtlich, aber die kulturelle Elite erwies sich zumindest in den letzten elf Jahren am resistentesten im Vergleich zu anderen Eliten des Landen. Die Situation lässt sich immer noch mit den Worten des verstorbenen Péter Esterházy beschreiben: "Einen Staatssekretär kann man ernennen, einen Dichter nicht." Vergeblich, so Hamvay, "wurden aus beinahe allen Institutionen die linksliberalen Künstler hinausgefegt, denn in den breiten Schichten der Gesellschaft werden sie weiterhin als maßgeblich betrachtet. (...) Laut der Studie wurde seit 2010 ein Viertel der kulturellen Elite ausgetauscht. Die Veränderung - die gleichzeitig ein Rechtsruck ist - betraf mit ca. 50 Prozent in erster Linie die Leitung der kulturellen Institutionen sowie die Medien, was erheblich ist. Dennoch gelang der Austausch der kulturellen Elite nicht in dem Maße wie zum Beispiel in der Wirtschaft."Africa is a Country (USA), 21.09.2021
Was ist Whiteness in Nordafrika, fragt sich Leila O. Tayeb anlässlich einer libysche Fernsehshow, für die sich die Moderatorin schwarz schminkte und mit zwei Affen als Kindern posierte. Tayeb fällt auf, dass "Afrikaner" die "gängige Bezeichnung für schwarze Menschen in Nordafrika ist, die sich von einer nicht näher bezeichneten (unmarkierten) Norm unterscheiden. Diese diskursive Praxis erzeugt auch ein spannungsgeladenes und ambivalentes Weißsein, mit dem die algerische Diaspora-Aktivistin Houria Bouteldja kürzlich in einer Polemik über 'Weiße, Juden und uns' tanzte. Sie schreibt: 'Fünfzig Jahre nach den Unabhängigkeitsbewegungen ist es Nordafrika, das seine eigenen Bürger und Schwarzafrikaner unterdrückt. Ich wollte eigentlich meine afrikanischen Brüder sagen. Aber das traue ich mich nicht mehr, jetzt, da ich mein Verbrechen zugegeben habe. Lebt wohl, Bandung.' Indem sie es 'nicht mehr wagt', brüderliche Verwandtschaft zu beanspruchen, erkennt Bouteldja die Gewalt der nordafrikanischen Anti-Blackness an. Doch selbst dann, wenn sie 'Nordafrika' als 'Unterdrücker seiner eigenen Bürger und Schwarzafrikaner' beschreibt, scheint sie anzudeuten, dass das Ende des kolonial konstruierten Staatssystems die nordafrikanische Anti-Schwarzheit beenden könnte. Letztere geht jedoch viel tiefer als der postkoloniale Staat. Das nordafrikanische unmarkierte Weißsein selbst hält das 'und' in ihrem Satz, 'seine eigenen Bürger und Schwarzafrikaner', hoch, als ob diese Kategorien sich gegenseitig ausschließen oder immer ausgeschlossen hätten."

Noah Tsika empfiehlt die Fortsetzung von Kemi Adetibas Netflixfilm "King of Boys", eine Art "Der Pate" auf nigerianisch, nur dass der Pate hier eine Frau ist, Eniola Salami, gespielt von der großartigen Sola Sobowale. In dem als Serie angelegten "The Return of the King" versucht Salami für ein politisches Amt zu kandidieren. Adetiba nimmt dabei erbarmungslos die Korruption nigerianischer Politiker aufs Korn: "'Die Rückkehr des Königs' geht davon aus, dass Betrug und Korruption zur nigerianischen Wahlpolitik gehören wie die Egusi-Suppe. Noch stärker als der ursprüngliche Spielfilm spielt die Netflix-Serie auf die jüngere Geschichte Nigerias an. Während im ersten Teil Porträts von Goodluck Jonathan auftauchen, wird im zweiten Teil ein fiktiver Präsident eingesetzt, der es Adetiba ermöglicht, die Skandale einiger tatsächlicher nigerianischer Staatsoberhäupter mittels eines imaginären Stellvertreter zu untersuchen. Vor allem der ehemalige Präsident Olusegun Obasanjo geistert durch die dramatischen Vorgänge, ebenso die Tatsache, dass im Jahr 2007 (dem Jahr, in dem Obasanjo aus dem Amt schied) 31 der 36 Gouverneure Nigerias wegen Korruption angeklagt wurden. Obasanjos Anti-Korruptions-Rhetorik diente jedoch nur dazu, das Fehlverhalten, das er zuließ, zu verschleiern - vor allem für die ausländische Presse."
Außerdem: Grace Adeniyi-Ogunyankin und Simidele Dosekun unterhalten sich über Postfeminismus in Nigeria.

Noah Tsika empfiehlt die Fortsetzung von Kemi Adetibas Netflixfilm "King of Boys", eine Art "Der Pate" auf nigerianisch, nur dass der Pate hier eine Frau ist, Eniola Salami, gespielt von der großartigen Sola Sobowale. In dem als Serie angelegten "The Return of the King" versucht Salami für ein politisches Amt zu kandidieren. Adetiba nimmt dabei erbarmungslos die Korruption nigerianischer Politiker aufs Korn: "'Die Rückkehr des Königs' geht davon aus, dass Betrug und Korruption zur nigerianischen Wahlpolitik gehören wie die Egusi-Suppe. Noch stärker als der ursprüngliche Spielfilm spielt die Netflix-Serie auf die jüngere Geschichte Nigerias an. Während im ersten Teil Porträts von Goodluck Jonathan auftauchen, wird im zweiten Teil ein fiktiver Präsident eingesetzt, der es Adetiba ermöglicht, die Skandale einiger tatsächlicher nigerianischer Staatsoberhäupter mittels eines imaginären Stellvertreter zu untersuchen. Vor allem der ehemalige Präsident Olusegun Obasanjo geistert durch die dramatischen Vorgänge, ebenso die Tatsache, dass im Jahr 2007 (dem Jahr, in dem Obasanjo aus dem Amt schied) 31 der 36 Gouverneure Nigerias wegen Korruption angeklagt wurden. Obasanjos Anti-Korruptions-Rhetorik diente jedoch nur dazu, das Fehlverhalten, das er zuließ, zu verschleiern - vor allem für die ausländische Presse."
Außerdem: Grace Adeniyi-Ogunyankin und Simidele Dosekun unterhalten sich über Postfeminismus in Nigeria.
New York Magazine (USA), 21.09.2021




Von links oben im Uhrzeigersinn: Golgotha Chair aus mit Dacron gefülltem und mit Harz getränktem Glasfasergewebe, 1972. Senza Fine Unica, Sessel aus polychromem PVC, 2010. Die bemalte Harztür in Ruth Lande Shumans Apartment, das Pesce Ende der 80er überarbeitete. Das Selbstporträt-Regal aus Harz, 2019. Alles von Gaetano Pesce.
Modernes Design - da denkt man an kühle Stromlinienförmigkeit. "Das ist nicht die Moderne von Gaetano Pesce", schreibt Matthew Schneier in einer Hommage an den 1939 in Ligurien geborenen Industriedesigner-Künstler-Architekt-Prophet Pesce, der gerade ein neues Comeback erlebt, von dem zahlreiche Ausstellungen zeugen. Pesce hasst glattes, gesichtsloses Design - auch in der Architektur, er findet es totalitär. Für seine eigenen Möbel bevorzugt er organische Materialien wie Harz oder Filz. Und er hat Witz. Zeit für ein Gespräch in Pesces Studio im Brooklyn Navy Yard in New York, wo Pesce seit 1980 lebt: "Ein lippenstiftroter Polyurethanfuß in der Größe eines Motorrads oder ein Bücherregal aus Harz in Form des Gesichts seines Schöpfers können den Weg versperren. In einem Archiv im Obergeschoss stehen reihenweise Vasen aus lollipopartigem Harz Wache, Souvenirs und Satelliten der Pescewelt. Große Stücke, wie das Bücherregal mit dem Gesicht oder der Fuß, kosten 180.000 Dollar und mehr. Über all dem thront Pesce selbst, ein Kobold in Issey Miyake, der sich an seinen Kreationen erfreut, wonky (schrullig) und Wonka. Das lässt ihn etwas harmloser klingen, als er ist. Er ist ein Bombenwerfer, ein 'Fürst der Unordnung', wie Glenn Adamson, ein bekannter Pesce-Forscher, sagt. 'Gaetano ist auf Ärger aus', sagt sein Freund und Förderer Murray Moss, der mit seinem einflussreichen Designgeschäft Moss in Soho dazu beitrug, Pesces Werk in den USA bekannt zu machen. Wer sonst würde einem italienischen Unternehmen vorschlagen, Aschenbecher in Form der gekreuzigten Hand Christi herzustellen, damit man seine Asche direkt in seine blutigen Stigmata streuen kann? (Das war 1969; das Unternehmen lehnte ab.) Oder Modelle aus rohem Fleisch für eine Ausstellung im Louvre anfertigen und sie dann verwesen lassen, bis das Museum von dem Geruch überwältigt war? 'Es gibt viele meiner Kollegen, die Dekoration oder schöne Dinge machen', sagt er. 'Das interessiert mich nicht.'"
Respekt (Tschechien), 19.09.2021
 Das tschechische Nachrichtenmagazin Respekt widmet sein Heft diese Woche dem "Weggang einer unersetzlichen Dame": Angela Merkel. Während die anderen beiden Kanzler, die so lange regierten, dass man von einer "Ära"sprechen könne - Konrad Adenauer und Helmut Kohl - vor allem mit Nachkriegswiederaufbau und USA-Bindung einerseits und der deutschen Wiedervereinigung und Europaarchitektur andererseits verbunden bleiben, lasse sich die Ära Merkels, schreibt Tomáš Lindner, "am leichtesten negativ beschreiben - durch all die Probleme, denen Deutschland während ihrer Kanzlerinnenschaft entgangen ist" - angefangen bei der großen Finanzkrise der Nullerjahre: "In der angelsächsischen Welt stieg jäh die Zahl der Arbeitslosen an, die Mittelschicht verlor ihre Sicherheit. Dagegen herrschte in Deutschland beachtliche Gelassenheit. Der Autor dieser Zeilen unterhielt sich zu jener Zeit (…) mit Arbeitern in Wolfsburg. Sie waren völlig ruhig, ohne Angst vor Arbeitsplatzverlust. Ihre Stimmung war nicht Ausdruck eines verlorenen Realitätssinns, sondern spiegelte die Regierungspolitik wieder", die Angela Merkel damals mit SPD-Finanzminister Peer Steinbrück vorantrieb, als die beiden das System der Kurzarbeit einführten und für die Spareinlagen der Bürger garantierten. Die deutsche Stimmung sei eine völlig andere gewesen als die in Frankreich, den angelsächsischen und den südeuropäischen Ländern - "und für die restliche Ära Merkel haben sich diese mentalen Landkarten nicht wieder verbunden. In den von der Krise schmerzhaft getroffenen Staaten blieben nämlich Narben in Form eines tiefen Misstrauens gegenüber den politischen Eliten und Experten zurück, was mit einigen Jahren Verspätung große Erschütterungen lange stabiler politischer Systeme bewirkte. Und Deutschland? Dort führte Angela Merkel, nach fünf, zehn, fünfzehn Jahren an der Macht immer wieder die Liste der beliebtesten Politiker an."
Das tschechische Nachrichtenmagazin Respekt widmet sein Heft diese Woche dem "Weggang einer unersetzlichen Dame": Angela Merkel. Während die anderen beiden Kanzler, die so lange regierten, dass man von einer "Ära"sprechen könne - Konrad Adenauer und Helmut Kohl - vor allem mit Nachkriegswiederaufbau und USA-Bindung einerseits und der deutschen Wiedervereinigung und Europaarchitektur andererseits verbunden bleiben, lasse sich die Ära Merkels, schreibt Tomáš Lindner, "am leichtesten negativ beschreiben - durch all die Probleme, denen Deutschland während ihrer Kanzlerinnenschaft entgangen ist" - angefangen bei der großen Finanzkrise der Nullerjahre: "In der angelsächsischen Welt stieg jäh die Zahl der Arbeitslosen an, die Mittelschicht verlor ihre Sicherheit. Dagegen herrschte in Deutschland beachtliche Gelassenheit. Der Autor dieser Zeilen unterhielt sich zu jener Zeit (…) mit Arbeitern in Wolfsburg. Sie waren völlig ruhig, ohne Angst vor Arbeitsplatzverlust. Ihre Stimmung war nicht Ausdruck eines verlorenen Realitätssinns, sondern spiegelte die Regierungspolitik wieder", die Angela Merkel damals mit SPD-Finanzminister Peer Steinbrück vorantrieb, als die beiden das System der Kurzarbeit einführten und für die Spareinlagen der Bürger garantierten. Die deutsche Stimmung sei eine völlig andere gewesen als die in Frankreich, den angelsächsischen und den südeuropäischen Ländern - "und für die restliche Ära Merkel haben sich diese mentalen Landkarten nicht wieder verbunden. In den von der Krise schmerzhaft getroffenen Staaten blieben nämlich Narben in Form eines tiefen Misstrauens gegenüber den politischen Eliten und Experten zurück, was mit einigen Jahren Verspätung große Erschütterungen lange stabiler politischer Systeme bewirkte. Und Deutschland? Dort führte Angela Merkel, nach fünf, zehn, fünfzehn Jahren an der Macht immer wieder die Liste der beliebtesten Politiker an."Wired (USA), 16.09.2021
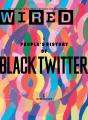 Cyberpunk, Steampunk, Solarpunk: An Punk-Subgenres herrscht in der literarischen Science-Fiction kein Mangel. Neu hinzugekommen ist vor wenigen Jahren Hopepunk - und eine der prominentesten Vertreterinnen dieses Zweigs ist die in den USA bereits mit Genre-Auszeichnungen überhäufte Autorin Becky Chambers, die Jason Kehe porträtiert. Hopepunk, erfahren wir, wirft den Blick in eine kuschelig behaglichen Zukunft: Space Operas erzählen keine intergalaktische Schlachten mehr, sondern handeln von Wesen, die sich bei einer Tasse Tee kennenlernen, Sexualität kennt keine Grenzen zwischen Spezies und eingehegten Präferenzen mehr. Ereignisarmut wird geschätzt, wichtiger sind Dialoge - und am Ende sind alle glücklich. Stichwort Tee: "Je länger wir über Tee sprechen, desto klarer tritt es Chambers und mir vor Augen, dass wir eine fundamentale Wahrheit über das Genre umkreisen: Tee - darin, wie er Kulturen verbindet und zivilisiert, im historischen Handel tief verwurzelt ist und in den Blättern, die er hinterlässt, mögliche Zukünfte offenbar - Tee also mag das science-fictionigste aller Getränke zu sein. Lange bevor Picard aus 'Star Trek' nach einem 'Tee, Early Grey, heiß' verlangte, wurde der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb in 'Per Anhalter durch die Galaxis' von einer 'frischen Tasse mit wirklich heißem Tee' befeuert." In diesem Zusammenhang signalisiert Tee immer eine entwickelte Kultur, so Kehe. Auch war Tee "immer schon eine Art prototypisches Handelsobjekt gewesen, die materielle Evidenz einer Kultur, die sich in eine andere vorwagt und diese oft ausbeutet. Was natürlich Science-Fiction in seiner klassischen Form ist: Kontakt zwischen Aliens - und am Ende steht entweder die eine oder die andere Kultur über der anderen. In gewisser Hinsicht funktioniert Tee wie ein Stichwort für die koloniale Fantasie, die den Antrieb für Erkundungen befeuert, das oberste Gebot des Genres 'Selbst wenn es keine direkte Metapher ist', sagt Chambers, 'ist dieser Subtext da'. Von Anfang an ging es Chambers darum, diesen Subtext zu unterlaufen, indem sie sich ruhigere, nettere, queerere Versionen der Space Operas ausmalte, mit denen sie aufgewachsen ist. Ihre Figuren sind keine Kolonialisten oder schicksalshafte Helden mehr, die voller Manneskraft in den Abgrund des Unbekannten vordringen und alles, was sie vorfinden, in Besitz nehmen. Sie sind Tunnelgräber, Pfleger, Sexarbeiter und Teemönche und was sie vor allem wünschen, ist, über ihre Gefühle zu reden."
Cyberpunk, Steampunk, Solarpunk: An Punk-Subgenres herrscht in der literarischen Science-Fiction kein Mangel. Neu hinzugekommen ist vor wenigen Jahren Hopepunk - und eine der prominentesten Vertreterinnen dieses Zweigs ist die in den USA bereits mit Genre-Auszeichnungen überhäufte Autorin Becky Chambers, die Jason Kehe porträtiert. Hopepunk, erfahren wir, wirft den Blick in eine kuschelig behaglichen Zukunft: Space Operas erzählen keine intergalaktische Schlachten mehr, sondern handeln von Wesen, die sich bei einer Tasse Tee kennenlernen, Sexualität kennt keine Grenzen zwischen Spezies und eingehegten Präferenzen mehr. Ereignisarmut wird geschätzt, wichtiger sind Dialoge - und am Ende sind alle glücklich. Stichwort Tee: "Je länger wir über Tee sprechen, desto klarer tritt es Chambers und mir vor Augen, dass wir eine fundamentale Wahrheit über das Genre umkreisen: Tee - darin, wie er Kulturen verbindet und zivilisiert, im historischen Handel tief verwurzelt ist und in den Blättern, die er hinterlässt, mögliche Zukünfte offenbar - Tee also mag das science-fictionigste aller Getränke zu sein. Lange bevor Picard aus 'Star Trek' nach einem 'Tee, Early Grey, heiß' verlangte, wurde der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb in 'Per Anhalter durch die Galaxis' von einer 'frischen Tasse mit wirklich heißem Tee' befeuert." In diesem Zusammenhang signalisiert Tee immer eine entwickelte Kultur, so Kehe. Auch war Tee "immer schon eine Art prototypisches Handelsobjekt gewesen, die materielle Evidenz einer Kultur, die sich in eine andere vorwagt und diese oft ausbeutet. Was natürlich Science-Fiction in seiner klassischen Form ist: Kontakt zwischen Aliens - und am Ende steht entweder die eine oder die andere Kultur über der anderen. In gewisser Hinsicht funktioniert Tee wie ein Stichwort für die koloniale Fantasie, die den Antrieb für Erkundungen befeuert, das oberste Gebot des Genres 'Selbst wenn es keine direkte Metapher ist', sagt Chambers, 'ist dieser Subtext da'. Von Anfang an ging es Chambers darum, diesen Subtext zu unterlaufen, indem sie sich ruhigere, nettere, queerere Versionen der Space Operas ausmalte, mit denen sie aufgewachsen ist. Ihre Figuren sind keine Kolonialisten oder schicksalshafte Helden mehr, die voller Manneskraft in den Abgrund des Unbekannten vordringen und alles, was sie vorfinden, in Besitz nehmen. Sie sind Tunnelgräber, Pfleger, Sexarbeiter und Teemönche und was sie vor allem wünschen, ist, über ihre Gefühle zu reden."New York Times (USA), 15.09.2021
 In einem Beitrag des Magazins geht Siddhartha Deb der systematischen Entrechtung von Muslimen in der indischen Provinz Assam nach: "Viele der rund zwei Millionen Menschen in Assam, die nunmehr als staatenlos gelten, sind bengalische Muslime, die Mehrheit von ihnen Kleinbauern und Tagelöhner, die im Fokus der Entrechtungskampagne von Premier Modis Hindu-nationalistischer Regierungspartei stehen. Als illegale Migranten aus Bangladesch gebrandmarkt, sind sie in ein kafkaeskes System von Anschuldigungen, Gerichtsverfahren und Verhaftungen geraten. Die Grundlage dafür ist ein nationales Staatsbürgergesetz, das schon mit dem des 'Dritten Reichs' verglichen wird. Für die Hindu-Rechte sind Grenzregionen wie Assam oder Kaschmir schon lange Gegenden muslimischer Bedrohung. Doch während Kaschmir oft benutzt wird, um die Gefahr einer Sezession heraufzubeschwören, stellt Assam in der Rhetorik hinduistischer Extremisten eine heimtückischere Bedrohung dar - die eines steten, grenzüberschreitenden Zustroms von Muslimen, der Hindus zu einer verfolgten Minderheit im eigenen Land zu machen droht. Assam ist sowohl für die historischen indischen Zivilisationen als auch für das moderne Indien weitgehend peripher - Guwahati liegt mehr als 1600 Kilometer östlich von Delhi, China und Myanmar liegen viel näher. Doch Assam ist für die Frage, wer in Indien ein Recht auf Staatsbürgerschaft hat, wer nicht, zentral geworden. Im Juli 2018 veröffentlichte Assam ein Nationales Bürgerregister (N.R.C.), das den Nachweis der Staatsbürgerschaft erbringen sollte. Jeder Einwohner Assams, dessen Name nicht im Register stand, kam vor ein Ausländergericht und musste beweisen, dass er vor 1971 in Assam geboren worden war, als Bangladesch von Pakistan unabhängig wurde und Flüchtlinge in großer Zahl in den Staat flohen, oder dass sie von einer solchen Person abstammten. Einmal vom Tribunal zu Ausländern erklärt, blieben ihnen nur die Gerichte. Das 'National' im N.R.C. ist allerdings irreführend. Es gilt nur für die multiethnische Bevölkerung des Staates von rund 33 Millionen, von denen ein Drittel Muslime sind, obwohl Modi drohte, ein ähnliches Bürgerregister für ganz Indien zu erstellen. Als die erste Version des N.R.C. veröffentlicht wurde, fehlten die Namen von fast vier Millionen Menschen, und ihre Staatsbürgerschaft wurde damit in Frage gestellt."
In einem Beitrag des Magazins geht Siddhartha Deb der systematischen Entrechtung von Muslimen in der indischen Provinz Assam nach: "Viele der rund zwei Millionen Menschen in Assam, die nunmehr als staatenlos gelten, sind bengalische Muslime, die Mehrheit von ihnen Kleinbauern und Tagelöhner, die im Fokus der Entrechtungskampagne von Premier Modis Hindu-nationalistischer Regierungspartei stehen. Als illegale Migranten aus Bangladesch gebrandmarkt, sind sie in ein kafkaeskes System von Anschuldigungen, Gerichtsverfahren und Verhaftungen geraten. Die Grundlage dafür ist ein nationales Staatsbürgergesetz, das schon mit dem des 'Dritten Reichs' verglichen wird. Für die Hindu-Rechte sind Grenzregionen wie Assam oder Kaschmir schon lange Gegenden muslimischer Bedrohung. Doch während Kaschmir oft benutzt wird, um die Gefahr einer Sezession heraufzubeschwören, stellt Assam in der Rhetorik hinduistischer Extremisten eine heimtückischere Bedrohung dar - die eines steten, grenzüberschreitenden Zustroms von Muslimen, der Hindus zu einer verfolgten Minderheit im eigenen Land zu machen droht. Assam ist sowohl für die historischen indischen Zivilisationen als auch für das moderne Indien weitgehend peripher - Guwahati liegt mehr als 1600 Kilometer östlich von Delhi, China und Myanmar liegen viel näher. Doch Assam ist für die Frage, wer in Indien ein Recht auf Staatsbürgerschaft hat, wer nicht, zentral geworden. Im Juli 2018 veröffentlichte Assam ein Nationales Bürgerregister (N.R.C.), das den Nachweis der Staatsbürgerschaft erbringen sollte. Jeder Einwohner Assams, dessen Name nicht im Register stand, kam vor ein Ausländergericht und musste beweisen, dass er vor 1971 in Assam geboren worden war, als Bangladesch von Pakistan unabhängig wurde und Flüchtlinge in großer Zahl in den Staat flohen, oder dass sie von einer solchen Person abstammten. Einmal vom Tribunal zu Ausländern erklärt, blieben ihnen nur die Gerichte. Das 'National' im N.R.C. ist allerdings irreführend. Es gilt nur für die multiethnische Bevölkerung des Staates von rund 33 Millionen, von denen ein Drittel Muslime sind, obwohl Modi drohte, ein ähnliches Bürgerregister für ganz Indien zu erstellen. Als die erste Version des N.R.C. veröffentlicht wurde, fehlten die Namen von fast vier Millionen Menschen, und ihre Staatsbürgerschaft wurde damit in Frage gestellt."
Kommentieren







