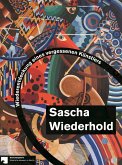Die blauen Augen der Krystyna Madej.
Der Maler Jan Markiel sah sie erst nur von weitem, als er in Auschwitz aus dem Fenster seiner Baracke schaute und sie vor dem Lager in einem rosafarbenen Kleid vorüberging. Später sah er sie in der Bäckerei ihres Vaters wieder, die das Konzentrationslager mit Brot belieferte, und war von ihren blauen Augen zutiefst fasziniert. Im Lager malte er ihr Porträt. Ein Sehnsuchtsbild. Überlebende berichten, dass die Bäckersfamilie den Häftlingen half, mit zusätzlichen Lebensmitteln, Kurierdiensten und sogar bei der Beschaffung von Zivilkleidung für Flüchtige. Markiel schenkte der Bäckerstochter und ihrer Familie als Dank das Bild.
Die »Entartete Kunst«, die Kunst der verfolgten und ins Exil gegangenen Künstler, ist seit Jahrzehnten ein viel beackertes Thema. Aber wer weiß etwas über die Kunst, die in den Ghettos, Verstecken und Lagern entstand? Wer kennt noch Jan Markiel, Marian Ruzsamski, Peter Kien, Wladyslaw Siwek, Josef Capek (den Bruder des Schriftstellers) oder Jerzy Adam Brandhuber? Allenfalls Felix Nussbaum und Peter Weiss sind etwas bekannter.
Über 15 Jahre hat sich Jürgen Kaumkötter mit der in den Lagern der Nazis entstandenen Kunst und ihren Künstlern beschäftigt, in Gedenkstätten, Archiven und Privatsammlungen gesucht. In Der Tod hat nicht das letzte Wort erzählt er ihre Geschichte, leuchtet die oft dramatischen Bedingungen aus, unter denen ihre Werke entstanden und erhalten wurden und erzählt, wie es den Künstlern, deren Begabung oft den Wachmännern nicht verborgen blieb, im Lager erging.
Der Maler Jan Markiel sah sie erst nur von weitem, als er in Auschwitz aus dem Fenster seiner Baracke schaute und sie vor dem Lager in einem rosafarbenen Kleid vorüberging. Später sah er sie in der Bäckerei ihres Vaters wieder, die das Konzentrationslager mit Brot belieferte, und war von ihren blauen Augen zutiefst fasziniert. Im Lager malte er ihr Porträt. Ein Sehnsuchtsbild. Überlebende berichten, dass die Bäckersfamilie den Häftlingen half, mit zusätzlichen Lebensmitteln, Kurierdiensten und sogar bei der Beschaffung von Zivilkleidung für Flüchtige. Markiel schenkte der Bäckerstochter und ihrer Familie als Dank das Bild.
Die »Entartete Kunst«, die Kunst der verfolgten und ins Exil gegangenen Künstler, ist seit Jahrzehnten ein viel beackertes Thema. Aber wer weiß etwas über die Kunst, die in den Ghettos, Verstecken und Lagern entstand? Wer kennt noch Jan Markiel, Marian Ruzsamski, Peter Kien, Wladyslaw Siwek, Josef Capek (den Bruder des Schriftstellers) oder Jerzy Adam Brandhuber? Allenfalls Felix Nussbaum und Peter Weiss sind etwas bekannter.
Über 15 Jahre hat sich Jürgen Kaumkötter mit der in den Lagern der Nazis entstandenen Kunst und ihren Künstlern beschäftigt, in Gedenkstätten, Archiven und Privatsammlungen gesucht. In Der Tod hat nicht das letzte Wort erzählt er ihre Geschichte, leuchtet die oft dramatischen Bedingungen aus, unter denen ihre Werke entstanden und erhalten wurden und erzählt, wie es den Künstlern, deren Begabung oft den Wachmännern nicht verborgen blieb, im Lager erging.

Lange wurden die Schoa-Werke nicht als Kunst, sondern als Zeugnis bewertet. Endlich korrigiert ein Buch diese Sicht.
Von Jürgen Serke
In eine jüdische Gemeinde Polens kommt ein Wunderrabbi, der die Gabe besitzt, Blinde sehend zu machen. Unter denen, die zu ihm strömen, ist einer, der keine Probleme mit seinen Augen hat, der dennoch den Tappstock der Blinden trägt und seine Augen mit einem grünen Schirm beschattet. Ein Bekannter unter den Blinden fragt ihn, warum ausgerechnet er, der Sehende, den Wunderrabbi aufsucht. Seine Antwort: "Dass ein Mensch so bled sein kann. Begreift Ihr denn nicht? Wenn ich werd vor ihm stehen, dem Großen, dem Echten, werd ich blind sein, und er wird mich machen sehend."
Die jüdische Legende aus dem Anfang des vergangenen Schreckensjahrhunderts spricht von der Notwendigkeit, die Blindheit des eigenen Sehens zu überwinden, die Schablone des gewohnten Blicks zu verlassen. Der 45-jährige Kunsthistoriker Jürgen Kaumkötter wirft jetzt in seinem Buch "Der Tod hat nicht das letzte Wort. Kunst der Katastrophe 1933-1945" der Kunstwissenschaft vor, mit dem traditionellen Blick der Kunstgeschichte eine ganze Kunstepoche falsch ins Auge genommen, die bildnerische Werke der Schoa ausgegliedert und sie als ästhetisch minderwertig abgeschoben zu haben in das zeithistorische Ambiente des Völkermords. Die Bewertung der Schoa-Werke unter dem Begriff Zeugnis ist für ihn eine Missachtung des Werts jener Bilder, eine Missachtung, die einem zweiten Mord gleichkommt.
Nicht nur insofern hat Kaumkötter sieben Jahrzehnte nach der Befreiung des KZ Auschwitz ein einzigartiges Buch geschrieben, das den Kunstcharakter der Holocaust-Werke wiederherstellt. Kaumkötter belegt auch mit seinen jahrelangen Recherchen über die Künstler in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern, dass es längst an der Zeit ist, mit einem neuen Blick die Schoa-Werke endlich einzufügen in die Kunstgeschichte, wohin sie gehören. Er stellt mit seinen bewegenden Erzählungen nicht die Kunstgeschichte über den Zeitraum von 1933 bis 1945 auf den Kopf, sondern auf die Füße.
Ich habe Kaumkötter bei seinen Überlegungen und Recherchen ein Jahrzehnt begleitet, zuerst mit Skepsis und dann überzeugt von seinen Thesen. Er lief nicht einmal bei denen durch offene Türen, die vor 15 Jahren in Auschwitz den Bilderbestand verwalteten. Die Gedenkstätte ist ein historisches Museum. Kaumkötters Suche nach der ästhetischen Qualität der Schoa-Bilder muss ihren Verwaltern wie eine zweite Selektion vorgekommen sein.
Ich sehe Kaumkötter, wie er zu Beginn des zweiten Jahrtausends tage- und nächtelang im Kommandantenhaus von Rudolf Höß lebte, wo ihn die Leitung der Gedenkstätte Auschwitz für seine Sichtung der Holocaust-Werke einquartierte. Den nächtlichen Blick aus dem Fenster auf den noch immer erleuchteten Stacheldraht des Stammlagers Auschwitz hielt er nicht aus und zog in ein rückwärtiges Zimmer.
Kaumkötter kommt aus Osnabrück, aus der Geburtsstadt von Felix Nussbaum, dessen Kunst in einem Versteck in Brüssel entstand, ehe er 1944 nach Auschwitz deportiert wurde. Die späte Anerkennung seiner Werke als Kunst stellt eine Ausnahme dar. Und Kaumkötter moniert, dass die Deutung von Nussbaums Bildern immer auf die spätere Ermordung des Künstlers fixiert ist. "Das Diktum der Täter", so schreibt er, "dominiert die Perspektive." Das Diktum der Täter unterstreicht auch das Osnabrücker Nussbaum-Museum, das Daniel Libeskind geschaffen hat. Es ist eine Innenarchitektur, die auf die Anmutung aus ist, Räume und Gänge zu schaffen, als wäre man in einem KZ.
Kaumkötter erinnert sich an ein Gespräch mit Professor Detlef Hoffmann von der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, einem Holocaust-Experten, der ihm sagte, er solle mal die Zigeunerporträts von Dinah Gottliebová neben einen damaligen Rassekundeatlas legen, um zu erkennen, warum diese Bilder entstanden seien. Das Desaster durch die Täterperspektive des KZ-Arztes, der die Gemälde in Auftrag gegeben hatte, entwertet die Bilder als Kunst. Kaumkötter schreibt: "Gottliebová widersetzte sich Mengele, zeigte Individuen und keine Stereotype. Sie schuf eigenständige Kunstwerke, autonome Bilder von beeindruckender Schönheit." Eben Menschenbilder aus der Neuen Sachlichkeit, ließe man den Kontext Mengele weg. Gottliebová machte ihre Porträtierten eben nicht zu Objekten, wie Mengele sie haben wollte.
Erst raubten die Täter den KZ-Künstlern ihre Freiheit, und dann stahlen die Verwalter der Katastrophe, die Kunsthistoriker und Museumsleute, ihnen ihre Eigenständigkeit und machten sie zu Produkten der Täter. Der Aufschrei im Ersten Weltkrieg hat seinen Platz in der Kunstgeschichte gefunden, der in der Schoa nicht. Kaumkötter spricht von einer vergessenen Kunstepoche, die in den Archiven von Gedenkstätten lagert. Sie ist nach 1945 herabgewürdigt worden zu Depotware. Wird die Schoa-Kunst in Ausstellungen gezeigt, dann als zeitgeschichtliches Dokument - als Randprodukt des Zweiten Weltkriegs.
Kaumkötter gibt in seinem Buch den vielen Vergessenen ihr Gesicht zurück, zeigt die Einzigartigkeit ihrer Kunst. Der Tod hat für ihn nicht das letzte Wort. Es ist eine Beschwörung, die in Zuversicht mündet. Eine "zweite Generation", seine Generation, hat inzwischen Wege gefunden, die Verstörung der Häftlingskünstler, deren Traumata hinter sich zu lassen. Zwei dieser Künstler hebt er heraus, die wie er 1969 geborene israelische Künstlerin Sigalit Landau und den 1954 geborenen Karikaturisten Michel Kichka. Beide haben Verwandte in der Schoa verloren.
Wenn die Erinnerung übermächtig wird, vereinnahmen sie das Leben der Nachgeborenen. Der Bruder Kichkas hielt der Überlebensgeschichte des Vaters nicht stand und nahm sich das Leben. Michel Kichka überwand das Trauma seines Vaters mit seiner Graphic Novel "Die zweite Generation. Was ich meinem Vater nie gesagt habe" und schuf in dieser neuen Form ein Kunstwerk. Sigalit Landau fasst das Unfassbare in Installationen. Schmerz, Verletzung, Gefangensein zeigt sie beispielsweise in einer Filmsequenz: sie nackt am Strand von Tel Aviv. Einen Reifen aus Stacheldraht, der in die Haut eindringt, schwingt sie um ihre Hüfte.
Auf einer seiner vielen Reisen zur Gedenkstätte Auschwitz zeigte mir Kaumkötter das riesige Bilderdepot im Stammlager. Beim Herausziehen der Bildwände genügte ihm ein flüchtiger Blick, die Werke einzuordnen: in die Zeit des Lagers bis 1945 und in die Zeit unmittelbar danach. Die KZ-Zeit war die Zeit des Verlustes von Symbolen und Metaphern, die gleich nach 1945 im Übermaß zurückkehrten. Oft litt diese Kunst der Überlebenden nach 1945 unter Verzerrung: das Böse wurde noch böser und das Gute noch besser.
Durch dieses Konglomerat des Gelingens und des Scheiterns arbeitete sich Kaumkötter hindurch für seine international als fulminant wahrgenommene Ausstellung "Kunst in Auschwitz 1940-1945" im Berliner Centrum Judaicum im Jahre 2005. Er legte erstmals hohe ästhetische Anforderungen an die Bilder, die er ausstellte. Das Buch jetzt mit einer Vielzahl von Abbildungen zeigt den lebensgefährlichen Weg, den alle Künstler mit ihrer Kunst in Auschwitz gingen.
Auschwitz war zuerst ein Terrorinstrument der deutschen Besatzer gegen die polnischen Eliten. Sie wurden ins Stammlager deportiert, ehe die industrielle Tötungsmaschinerie gegen die europäischen Juden in Gang gesetzt wurde. In der Lagertischlerei fanden sich die inhaftierten polnischen Künstler zusammen, nutzten für ihre Malerei Kohle, Bleistiftstummel, Kot, Brot und Blut für ihre ersten Werke in der Gefangenschaft.
Eines der großen Menschenbilder zeigt die polnische Bäckerstochter Krystyna Madej, die der in Lodz und in Frankreich aufgewachsene jüdische Häftling Jan Markiel aus der Ferne sah. Die Bäckerei des Vaters belieferte das KZ mit Brot und half den Häftlingen mit Lebensmitteln. Der Vater war zugleich Kurier für Briefe aus dem Lager. Markiel ließ der Tochter zum Dank das Porträt zukommen. Als Maler war er Autodidakt. Er kratzte Farben vom Putz der Lagerwände, mischte mit einer Eieremulsion die Farben an und schuf so sein erstes Bild.
Sein Porträt wurde der Gedenkstätte nach der Jahrtausendwende zum Kauf angeboten, aber der Gedenkstätte fehlte das Geld. Kaumkötter rief seine Freunde in Osnabrück an. Zusammen brachten sie die verlangte Summe auf, so dass die Gedenkstätte das Bild kaufen konnte. Der Autodidakt Markiel war die Ausnahme unter den Künstlern des KZ. Die anderen hatten eine Ausbildung im Vorkriegspolen und waren zumeist anerkannte Maler, ehe sie nach Auschwitz deportiert wurden.
Der polnische Jude Markiel überlebte unter dem Schutz seiner polnischen Mithäftlinge und starb 1968 in Paris. Der große Maler Marian Ruzamski überlebte nicht. Nach dem Todesmarsch aus Auschwitz starb er in Bergen-Belsen zwei Wochen vor der Befreiung des Lagers. Unter seinem Hemd trug er seine Auschwitz-Mappe mit den Porträts seiner Mithäftlinge. Kaumkötter nennt diese Werke Ruzamskis "Guernica", eine überzeitliche Anklage gegen die Unmenschlichkeit. Ein großartiges Kunstwerk, vergleichbar mit dem Bild, das Picasso nach dem deutschen Bombardement der baskischen Stadt geschaffen hat. In Picassos "Guernica" verweist nichts direkt auf das Bombardement. Der Titel ist der einzige Hinweis. Und das Kunstmuseum Reina Sofía in Madrid, wo das Bild hängt, zeigt es nur im Kunstkontext wie alle anderen Exponate auch.
Marian Ruzamski galt als genuin polnischer Künstler bis in die Jahrtausendwende, bis Kaumkötter und ich uns mit meinem Freund Ryszard Krynicki in Krakau trafen und über Ruzamski sprachen. Krynicki, ein Mann des Widerstands gegen das kommunistische Regime und längst ein bedeutender Lyriker seines Landes, wurde 1945 mit seinen Eltern in einem Lager in Österreich befreit und in Gorzów Wielkopolski angesiedelt. Es ist Landsberg/Warthe, meine Geburtsstadt, aus der ich, so alt wie Krynicki, zur selben Zeit vertrieben wurde. Karl Dedecius, der große deutsch-polnische Vermittler, hatte uns zusammengebracht. Krynicki mit seinen Gorzów-Gedichten und mich mit meinem Landsberg-Buch "Nach Hause - eine Heimatkunde".
Krynicki löste bei unserem Treffen ganz schnell das Geheimnis des Namens Ruzamski. Die Silbe -ski ist polnisch. Der Rest ist ein Anagramm. Ruzamski heißt in Wirklichkeit Mazur und ist ein polnischer Jude. Sein Vater, ein Notar, offensichtlich vertraut mit dem polnischen Antisemitismus, hatte 1891 den Familiennamen polnisch verändert. Kaumkötter und ich reisten nach Tarnobrzeg, ins polnische Galizien, wo Ruzamski bis zu seiner Deportation 1943 gelebt hatte. Wir erfuhren, dass er von einem Volksdeutschen als "homosexueller Jude" denunziert worden war.
Kaumkötter war zu jener Zeit ein Kenner meiner Literatursammlung über die verfolgten Dichter des NS-Regimes. Er hatte Ausstellungen aus dem Bestand in Breslau, Berlin, Prag und Jerusalem kuratiert. In Solingen führte er 2008 meine Sammlung "Himmel und Hölle 1918-1989. Die verbrannten Dichter" mit der Sammlung Schneider, einer Sammlung der verfolgten bildenden Kunst im "Dritten Reich", zu einem Museum der verfolgten Künste zusammen.
Aus dieser Erfahrung kommt er in seinem Buch zu dem Ergebnis: Kein bildender Künstler wurde wegen seiner Kunst unmittelbar mit dem Tode bedroht, es sei denn, er war Jude. "Das Buch, der Text . . . war gefährlicher als das Bild an der Wand." Den vorgeblichen Widerstand mit antiken und christologischen Motiven unter den Künstlern, die bedrängt, aber frei in Deutschland leben konnten, lässt Kaumkötter als wirklichen Widerstand nicht gelten und zeichnet mit einem Porträt von Otto Pankok (1893-1966) das Bild eines Künstlers, der sich unter dem NS-Regime mit seinen Zigeuner-Kohlegemälden nicht irritieren ließ. Seine Kunst galt den Sinti und Roma vor 1933, in der Zeit der Verfolgung und nach 1945, wo er unter anderem sein großes Bild "Aus Auschwitz zurück" schuf.
Mit der Einbindung der Exilliteratur traten in Kaumkötters Recherchen zwei Doppeltalente in die Darstellung seiner "Kunst der Katastrophe": Peter Kien und Peter Weiss. Kien und Weiss lernten sich 1937 an der Kunstakademie in Prag kennen. Weiss entkam den Nazis nach Schweden, und Kien schickte ihm dessen bildnerisches Werk nach ins Exil. Mit metaphorischem Blick, der die Unterdrückung kommen sieht, hält Weiss in seinen Bildern aus Prag Einsamkeit und zunehmende Beengung fest. Es sind 400 Werke. 2005, so erfahren wir bei Kaumkötter, wurden fast alle Kunstwerke von Weiss aus einem schwedischen Museumsdepot gestohlen und gelten als verloren.
Weiss wechselte nach dem Krieg von der Malerei in die Literatur und machte aus dem Trauma der Verfolgung große Literatur. Peter Kien gelang es, in der Gefangenschaft Theresienstadts seine Dichtung weiterzuschreiben und das Ungeheuerliche in Worte zu fassen. Auf das Ungeheuerliche verzichtete er in seinen Zeichnungen und zeigte in der Gefangenschaft die Schönheit der inhaftierten Menschen, zeichnete sie in der Würde der Menschlichkeit, die nicht untergeht. Sein letztes Lebenszeichen nach der Deportation nach Auschwitz ist ein Brief an seine Geliebte Helga Wolfenstein, der im leeren Güterzug nach Theresienstadt zurückkehrte: "Ich grüße Dich aus der unbekannten Richtung wohin wir fahren. Mein Blick wird zu Dir gerichtet sein, bis ein seliger Tag uns wieder zusammenführt." Helga Wolfenstein überlebte in Theresienstadt und starb 2003 in Florida.
Jehuda Bacon, der Freund Peter Kiens aus Theresienstadt, geboren in Mährisch-Ostrau, erscheint in Kaumkötters Buch als einziger ehemaliger KZ-Insasse, dem es nach 1945 als Maler und Zeichner gelingt, das Trauma seines Lebens darzustellen und es dann zugunsten leichter, schwebender, sinnenfroher Bilder zu verlassen. Nach Kriegsende ist er 15 Jahre alt, hat Auschwitz hinter sich wie Greta Klingsberg, die Anninka in der tschechischen Kinderoper "Brundibar" in Theresienstadt. Beide gelangen sie im selben Transport von Marseille nach Palästina. Bei der Gedenkausstellung des Bundestages zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz im Paul-Loebe-Haus, die unter dem Buchtitel Kaumkötters steht und von ihm kuratiert wird, sind die beiden 85-Jährigen Ehrengäste. Die Ausstellung geht im Mai nach Krakau in den Museumsbau des Schindler-Hauses. Das Buch erscheint im April in Polen in polnischer Übersetzung.
Ein Kunsthistoriker hat sich Auschwitz ausgesetzt. Bei seinen Recherchen hat er spät bemerkt, dass nicht er sein Thema gewählt hat, sondern das Thema ihn. Da gab es eine Schmiede bei Osnabrück. Der Gründer der Schmiede war Kaumkötters Großvater. Der Großvater hatte sich das Geld für die Schmiede bei einem Juden geliehen, das er nicht zurückzahlen musste, weil der Jude und seine Familie nach 1945 nicht mehr zurückkehrten. Wie ist der Name des Leihgebers? Jürgen Kaumkötter schaute bei seinen Recherchen in der Familie auf eine "trübe Wand aus Glas". Doch die Konturen dahinter waren stark genug: Das geliehene Geld stammte von der Unternehmerfamilie Nussbaum, deren Mitglieder alle von den Nazis ermordet wurden. Hier schließt sich der Kreis. Ohne zu ahnen, war Kaumkötter als Student in Osnabrück auf Felix Nussbaum gestoßen, dessen Werk ihn nicht losließ. So führt ihn letztlich der Weg nach Auschwitz.
Ganz am Ende seiner Recherchen fragt er sich, ob Nussbaum mit seinem letzten Bild im belgischen Versteck, das den Namen "Triumph des Todes" trägt, mit dem Leben abgeschlossen hatte, wie die Kunstwissenschaft meint. Kaumkötter setzt sein Nein dagegen und schreibt: "Nussbaum wollte weiterleben." Inzwischen weiß er, dass der Maler entgegen der bisherigen Annahme die Selektion in Birkenau überstand und im Lagerkrankenbau Auschwitz registriert wurde. Nussbaums Lebenshoffnung dauerte einen Monat. Trotz seiner Ermordung steht Nussbaum für die Auferstehung, die Kaumkötter ihm und den anderen Künstlern im Bereich der Schoa in seinem Buch bereitet.
Jürgen Kaumkötter: "Der Tod hat nicht das letzte Wort. Kunst in der Katastrophe 1933-45". Galiani, 385 Seiten, 39,99 Euro
Jürgen Serke, 77, widmet sich in seinem Werk seit vielen Jahren dem Schicksal verfolgter Künstler und Schriftsteller. Sein "Buch der verbrannten Dichter" von 1977 war für die deutsche Literaturgeschichte eine Revolution. Seine Exil-Literatursammlung ist im "Zentrum für verfolgte Künste" im Kunstmuseum Solingen zu sehen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Jürgen Kaumkötter bricht mit der "unausgesprochenen Regel der Kunstgeschichte", nach der die Kunst, die von den Häftlingen der Lager der Nationalsozialisten gefertigt wurde, nur als historisches Dokument, als Zeugnis zu behandeln sei, berichtet Julia Voss. In "Der Tod hat nicht das letzte Wort" spricht sich Kaumkötter dafür aus, den Werken nicht länger die kritische Würdigung als Kunst vorzuenthalten, und er geht zahlreiche Fälle durch, so die Rezensentin - zu viele, findet Voss sogar: denn die einzelnen Künstler und Werke gehen in der großen Menge der erwähnten etwas unter. Auch wenn sich die Rezensentin Kaumkötters Appell anschließt, hofft sie, dass bald Einzelstudien folgen, die den Anspruch des Autors einlösen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH