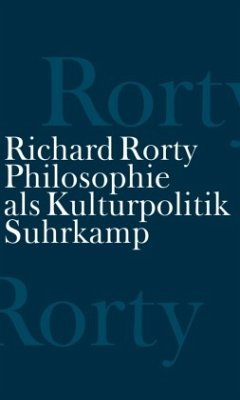Mit Richard Rorty verstarb im Sommer 2007 einer der einflußreichsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Spätestens seit seiner aufsehenerregenden Demontage des cartesianischen Selbstverständnisses der Philosophie in "Der Spiegel der Natur" gehörte er zu den meistgelesenen Philosophen weltweit, der auch aufgrund seiner politischen Interventionen Bekanntheit erlangte. Heidegger, Wittgenstein und vor allem John Dewey waren seine Gewährsmänner, deren Einsichten er mit analytischer Brillanz für die Gegenwart fruchtbar machte. Romantische Ironie und weltbürgerliche Solidarität galten ihm mehr als philosophische Besserwisserei. Philosophie - das war für Rorty kein akademisches Fach, exklusiv zuständig für die "ersten Fragen", sondern vielmehr eine Stimme unter vielen im großen zivilisatorischen Gespräch der Menschheit.Philosophie als Kulturpolitik, der letzte von Rorty selbst zusammengestellte Band mit zum Teil bislang unveröffentlichten Essays, kann als sein Vermächtnis gelesen werden: Religion und Moralphilosophie, Wittgenstein und Kant, Naturalismus, romantischer Polytheismus und immer wieder die analytische Philosophie und ihre "Heilung" durch den Pragmatismus sind die scheinbar disparaten Themen, die gleichwohl durch ein starkes Band zusammengehalten werden, nämlich die Frage nach der Rolle der Philosophie in der westlichen Kultur, genauer: Wie muß man philosophieren, um als Philosoph einen sinnvollen Beitrag zur menschlichen Kultur leisten zu können? Rortys Antwort: Man muß sich entscheiden, und zwar gegen den Elfenbeinturm und für den kulturellen Wandel durch das Gespräch - mit den Naturwissenschaften, der Kunst, der Literatur, der Religion und der Politik.

Richard Rortys Entrümpelung der philosophischen Tradition
Der amerikanische Philosoph Richard Rorty – er starb fünfundsiebzigjährig im Juni vergangenen Jahres – war zweifellos eine singuläre Gestalt in der Philosophie und auf der intellektuellen Bühne der letzten Jahrzehnte. Der Pragmatismus, für den er warb und den er in immer neuen Anläufen sowie in ständigen Disputen mit den diversesten philosophischen Positionen erhärtete, trägt seinen ganz persönlichen Stempel, weist in einen völlig anderen, viele beunruhigenden Gesichtskreis, fort von einer sich als autonomes, professionelles Universitätsfach verstehenden Philosophie, hin zu Literatur und Kunst oder zu dem, was er zuletzt summarisch Kulturpolitik benannte.
An Originalität lag ihm freilich nichts. „Hin und wieder hat man den Fehler gemacht, mich wegen meiner Originalität zu loben”, bemerkt er einmal als liberaler Ironiker – einer, so versteht er das, der allen Fundamentalismen spottet und denen er mit dem Ockhamschen Rasiermesser zu Leibe rückt. Rorty sah sich in den Fußstapfen des pragmatistischen Gründervaters William James und vor allem des Altpragmatisten und Pädagogen John Dewey. Darüber hinaus schöpfte er aus einer Tradition, der er sich wahlverwandt fühlte, interpretierte sie sozusagen auf seine Seite, von Protagoras etwa über Ockham, Nietzsche und Hegel bis zu Wittgenstein und Sellars. Im Bündnis mit deren Überzeugungen entledigte er sich jenes metaphysisch-essentialistischen, aufs hintergründige Wesen der Dinge zielenden Denkens, das uns Größen wie Platon, Descartes oder Kant als Ballast hinterließen, die damit den Weg zu einer menschlicheren Gesellschaft versperrt hätten. Dennoch, räumt er ein, waren auch deren einstmals neuartige Weltbeschreibungen als Stufen unserer Evolution „vom Anthropoiden zum Menschen” zeitweise von Bedeutung. Wir sind auf deren Leiter hinaufgestiegen, jetzt können wir sie, à la Wittgenstein, wegwerfen.
Hoffnung statt Erkenntnis
Wie kein anderer Philosoph unserer Zeit war Richard Rorty in den zwei Welten der amerikanisch-analytischen und der „kontinentalen” europäischen Philosophie zu Hause. Nichts war ihm da fremd. „Es fällt ganz leicht”, meint er, „Davidson mit Derrida und Gadamer oder Brandom mit Hegel und Heidegger in einen Zusammenhang zu bringen”. Und über der Versenkung in die Finessen analytischer Abstraktionen – exemplarisch in dem sich über dreißig Jahre hinziehenden Dialog mit Donald Davidson über Sinn oder Nutzlosigkeit einer überlebensgroßen WAHRHEIT – entglitt ihm nie der Blick auf die übergreifenden Perspektiven. Dieser Wechsel vom Minutiösen zum Generellen spiegelt sich auch in Rortys literarischem Sprachspiel als Ineinander von Sachlichkeit und witzig-ironischer, gänzlich unpolemischer façon de parler.
Im vierten Band seiner „Philosophical Papers”, dessen deutsche Übersetzung nun postum vorliegt, wird man, wie Rorty eingangs bemerkt, nichts grundsätzlich Neues finden. In den dreizehn Aufsätzen finden sich die nämlichen markanten Grundsätze Rortys variiert wieder: dass wir etwa unsere Überzeugungen nicht gegenüber „der Welt” oder Gott oder „der Wahrheit” zu verantworten haben, sondern „gegenüber anderen Angehörigen der Gesellschaft”. Oder: Es gibt nur nützliche und weniger nützliche Weltbeschreibungen. Die nützlichen fördern fortlaufend kulturpolitische, der Humanität dienliche Entscheidungen; epistemologische und ontologische Fragen nach sogenannten bewusstseinsunabhängigen und ahistorischen Gegenständen oder Gesetzen blockieren hingegen den Weg dahin. Philosophischer Fortschritt, sofern man noch darauf setzt, geschieht nicht durch Problemlösungen, sondern durch die „Verbesserung unserer Beschreibungen”.
Und wie schon in seinem Erstling „Philosophy and the Mirror of Nature” von 1979 wird die „repräsentationalistische” Idee verworfen, es gebe Dinge „da draußen”, deren Verfassung unabhängig von ihrer sprachlichen Beschreibung gegeben sei, und ein Weg, eine Methode, führe stracks vom Subjekt zum Objekt, vom Bewusstsein zur Realität, die sich in unserem Geist wie in einem Spiegel reflektiere. Dem Streben nach Gewissheit, das „uns Pragmatisten” als Weltflucht verdächtig ist, wird die Phantasie entgegengesetzt – Phantasie, so wendet er das „Kernstück der Romantik” jetzt ins Pragmatische, nicht als Produktion von Vorstellungsbildern, sondern als Kapazität zur „Veränderung sozialer Praktiken”. Hoffnung statt Erkenntnis, nicht etwa Hoffnung dank Erkenntnis, Solidarität statt Objektivität, auf diese früher schon beschworenen Nenner bringt Rorty seine Sicht auch in diesem Band.
Dabei ist immer wieder frappierend, wie mühelos, wie elegant sich Rorty von Argumenten Hegels, Nietzsches, Heideggers, Habermas’ oder Dennetts, denen er sich nahe fühlt, diejenigen abschöpft, die seinem Neopragmatismus Nahrung geben. Heidegger beispielsweise ist ihm lieb, weil der unbeirrt an seinen Neologismen festhielt, durch die er, nach Rorty, unser „Sprachrepertoire” fruchtbar erweitert habe. In der weit ausholenden Abhandlung „Kulturpolitik und die Frage nach der Existenz Gottes” wird der Seinsdenker zum Sozialdenker umfunktioniert, mit Berufung auf Robert Brandom, der Heidegger die „These” vom „ontologischen Vorrang des Sozialen” unterstellt. Nietzsche, der ja nach dem Tod Gottes „pragmatistisch” den Menschen zum Gestalter seines Geschicks machte, hebt Rorty einmal als „glühenden Verehrer Darwins” heraus; aber hatte nicht Nietzsche den Evolutionstheoretiker unter die „mittelmäßigen englischen Verständer” verortet? Von Hegel lässt sich Rorty seinen Historismus (in gewisser Weise auch Relativismus) bestätigen, nämlich die Zeitbezogenheit all unserer Weisheit, die er in Hegels Satz, Philosophie sei ihre Zeit – Rorty übersetzt das: „die gegenwärtigen Diskurspraktiken” – in Gedanken erfasst, auf den Punkt gebracht findet.
Hegel stand in den letzten Jahren, vielleicht beeinflusst vom Pittsburgher „Neuhegelianer” Robert Brandom, hoch in Rortys Gunst. Doch es ist, wie wohl auch für Brandom, allein der Hegel der „Phänomenologie”, der ihn interessiert, danach, meinte er einmal in einem Gespräch, „ging etwas fürchterlich schief, etwas was ihn, Hegel, dazu brachte, die Wissenschaft der Logik zu schreiben”. Mit Habermas’ kommunikativer, intersubjektiver Vernunft weiß er sich einig; dessen Beharren auf Allgemeingültigkeit, seinen Universalismus, hält er hingegen für „eine bedauerliche Konzession an den Platonismus”. Sein eigentlicher „Held” ist indes bis zuletzt John Dewey, einst von Bertrand Russell als „bürgerlicher Langweiler” abgetan, was Rorty nicht unerwähnt lässt. Deweys pädagogische oder wenn man will therapeutische Lehre, die sich auf die Formel „Demokratie statt Philosophie” bringen lässt, weist für Rorty in die Richtung einer Gesellschaft liberaler, „pragmatischer Atheisten”, in der die Akzeptanz kultureller Pluralität und insbesondere eine gesteigerte Sensibilität gegenüber Grausamkeiten endemisch sein könnten.
Zu eigenwilligen moralpsychologischen Konsequenzen gelangt Rorty in dem Text „Redliche Irrtümer”. Daraus, dass es keine außermenschliche Instanz, keinen moralischen Leitstern gebe, folge, „dass ehrenwerte Männer und Frauen durchaus imstande sind, abscheuliche Dinge zu tun”. Wenn manche noch 1939 verkannten, dass Stalin ein inhumaner Tyrann war, sei das kein Grund, an deren Redlichkeit zu zweifeln; dass George Orwell immer auf der richtigen Seite stand, Churchill gegen die „katastrophalen Irrtümer” des ehrenwerten Léon Blum recht behielt, beruhe nicht auf Churchills und Orwells höheren moralischen Qualitäten oder tieferen Einsichten, vielmehr hätten sie „einfach Glück gehabt”, hätten zur rechten Zeit am rechten Ort gestanden – „Moral Luck” hieß einer der letzten Texte des britischen Philosophen Bernard Williams.
Rortys Kritiker – sie sind versammelt in zwei stattlichen Bänden –, auf deren Widerrede er geradezu erpicht war, die er allenthalben herbeizitiert, werden an einem solch prinzipienlosen Verständnis von Moral und Toleranz wahrscheinlich ebenso wenig Gefallen finden wie an seinem Kahlschlag der philosophischen abendländischen Kultur. Anderen klingt hingegen verlockend, dass mit dem Entrümpeln reglementierender übermenschlicher Autoritäten, also überkommener metaphysischer „Ladenhüter”, sich der Ausblick auf eine freiere, solidarischere Gesellschaft eröffnen könnte. Das war Rortys Hoffnung für die Zukunft, seine „liberale Utopie”, für die dieses Buch noch einmal wirbt. WILLY HOCHKEPPEL
RICHARD RORTY: Philosophie als Kulturpolitik. Aus dem Englischen von Joachim Schulte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 357 S.. Euro 28,80.
„Hin und wieder hat man den Fehler gemacht, mich wegen meiner Originalität zu loben”, meinte Richard Rorty (1931-2007). Foto: Graziano Arici/Focus
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Thomas Assheuer verneigt sich vor dem im vergangenen Jahr verstorbenen amerikanischen Philosophen und seinem posthum erschienenen Essayband mit dem für seinen Geschmack etwas "abschreckenden Titel". In ihm könne man noch einmal nachlesen, wie "leichthändig" Richard Rorty "die dicken Mauern philosophischer Weltgebäude" nach hohlen Stellen abgeklopft, wie "federnd und elegant" er "sein Florett" geführt habe. Besonders begeistert sich der Rezensent für Rortys Theorie von der Ironie als Fanatismusvermeidung. Manchmal allerdings sieht er dessen Überlegungen auch in ungemütliche, nichtsdestotrotz äußerst nachdenkenswerte Regionen wachsen: Wenn Rorty zum Beispiel die Existenz einer "kontextfreien gültigen Vernunft" bezweifelt, die er nicht so sehr als Kategorie denn als Prozess verstanden wissen will. In diesem Zusammenhang beeindrucken den Rezensenten auch Rortys Überlegungen zur Frage, warum der westliche Universalismus in der nichtwestlichen Welt so wenig Freunde findet. Die Übersetzung der Aufsätze wird ebenfalls sehr gelobt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Die Leichtfüßigkeit seiner makellosen Sprache täuscht über den Schwierigkeitsgrad dieses scharfsinnigen Denkers hinweg.« Thomas Assheuer DIE ZEIT