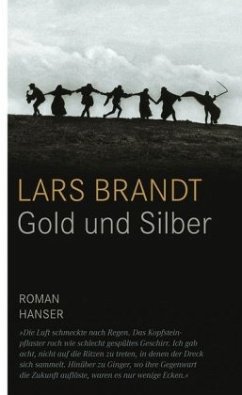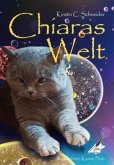Eine mittelgroße deutsche Stadt am Ende des 20. Jahrhunderts. Hier gibt es eine Gruppe jüngerer und nicht mehr ganz so junger Leute, die sich als Künstler fühlen und sich fragen: Wie finde ich das richtige Leben in dieser so komplizierten und schlecht organisierten Welt? Sie wissen, was sie wollen, aber sie wissen nicht wirklich, wie sie es machen sollen. So auch der Erzähler, der sich weigert zu begreifen, dass die von ihm verehrte Ginger bereits vergeben ist und nichts von ihm wissen will. Seine Hartnäckigkeit führt ihn mit Umwegen nach Rom, zum Sehnsuchtsort aller Künstler, der nun auch seiner Liebe aufhelfen soll. Lars Brandt bringt auf leichte, assoziative Weise das Schwerste zur Sprache: Sein Künstler- und Liebesroman erzählt von Menschen auf der Suche nach dem richtigen Leben.

Das Leben der Boheme als moderner Artus-Roman aus der Provinz: Lars Brandt schildert in seinem Romandebüt Künstler als die Letzten ihrer Art.
Der avantgardistische Künstler ist eine etwas rotzige Heiligengestalt der Moderne, die allerdings vom Aussterben bedroht scheint. So diagnostizierte der amerikanische Schriftsteller William Gibson angesichts einer fortschreitenden Kommerzialisierung des Kunstbetriebs ein "Verschwinden der Boheme" - eine Klage, die nun auch wehmütig in "Gold und Silber" anklingt, dem ersten Roman von Lars Brandt. Darin geht es um eine Truppe von künstlerischen Möchtegern-Avantgardisten, die bezeichnenderweise nicht in Paris, London oder New York zu Hause sind, sondern in der rheinischen Provinz, höchstwahrscheinlich in Bonn; dafür spricht unter anderem ein Hinweis auf eine dottergelb gestrichene Innenstadt-Universität.
Man schreibt die späten neunziger Jahre. Der Regierungsumzug steht bevor, der Sog nach Berlin hat eingesetzt. Und es herrscht drückend schwüles Sommerwetter bis in den Herbst hinein - das passende Klima zu einer bleiernen Endzeitstimmung, die der Bohème bestenfalls noch am äußersten Rand Überlebenschancen einräumt oder, wie es der Ich-Erzähler, der Maler Rudi, gleich zu Beginn formuliert: "Äußerlich ereignete sich nicht viel, aber alles veränderte sich. An uns allen (nagte) die Sehnsucht, endlich hier fort zu kommen. Sie feilte am Verdacht, das wahre Leben warte auf uns an einem anderen Flecken."
Die Berliner Republik blinkt also schon von ferne bei Brandt. Doch noch herrscht die Stille vor dem Sturm. Und Rudi resümiert lapidar: "Das war es, was passierte: warten." In dieser Feststellung schwingt allerdings auch schon das dramaturgische Grundproblem des Romans mit: dass auf dreihundert Seiten tatsächlich nicht viel von einem existentiellen Schrecken zu spüren ist, der einen schweren Verlust normalerweise begleitet. Mit einem Mal ins deutsche Abseits gedrängt und eigentlich dabei, im Orkus der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, geben sich Brandts Provinz-Bohemiens auffällig wenig wütend oder traurig. Stattdessen gehen sie, merkwürdig ungerührt, ihren Routinen nach. Sie treffen sich in der alten Stammkneipe, ziehen nachts wie "ein lebendiger Scherenschnitt" um die Häuser, jobben nebenher für den Lebensunterhalt.
Und sie schwingen großmäulige Reden - so wie der Filmemacher Jarl, der einen Film plant, der nur aus Pausen besteht. Denn, so Jarl: "In einer Pause steckt mehr Geschichte als im ganzen OEuvre Jack the Rippers." Je aussichtsloser Brandts B-Künstler, alle schon weit jenseits der dreißig, vom Durchbruch entfernt sind, desto mehr beschwören sie die Illusion vom großen Geniestreich, der sie auf einen Schlag berühmt machen soll. Und ebenso spätpubertär-ungestüm wie Jarls Idee vom Film ohne Handlung mutet auch die Performance von Hans an, der sich kopfüber von der Decke baumeln lässt, um vor Publikum Worte wie "Salamander" verkehrt herum aufzusagen. Oder die Zeichenkunst Sebastians, der gern onanierende Comicfiguren skizziert.
Auch Hauptheld Rudi hat als Maler nur mäßig Erfolg, versichert sich selbst aber immer wieder, dass "ich besser war und mehr konnte als irgendein anderer". Der jungenhaft-trotzige Größenwahn, mit dem Brandts selbsternannte Kunstgenies ständig ihre angebliche Außergewöhnlichkeit herbeireden, obwohl sie längst aussortierte Fußlahme der Geschichte sind, hat durchaus etwas Anrührendes, in seiner Vergeblichkeit geradezu etwas Charmant-Heroisches.
Man merkt dem Autor an, der früher selbst als literarischer Performance-Künstler aufgetreten ist, dass er die Szene gut kennt und genug Sympathie für seine Helden besitzt, um deren Selbstüberschätzung mit genauem, mitfühlendem Blick zu schildern. Leider aber zeigt sich Lars Brandt (der zweite Sohn von Willy Brandt, der zuletzt viel Anerkennung für sein assoziatives Vaterbuch "Andenken" erhielt) bei seinem Romandebüt insgesamt zu beflissen. Vor lauter Lust am literarischen Verweis vernachlässigt er nämlich schon bald seine reizvolle Ausgangsidee: das Verschwinden eines Künstlermythos mit dem Verschwinden der alten Bundesrepublik zu verschalten.
Besonders hemmend für den Erzählfluss wirkt sich aus, dass er unbedingt die mittelalterliche Artus-Sage in seine Geschichte einbauen wollte. Das aussichtslose Streben seiner Männergruppe nach künstlerischer Anerkennung findet entsprechend eine zusätzliche Parallele in einem ebenso aussichtslosen Liebeswahn Rudis, der wie einst der Ritter Lancelot einer verführerischen "Ginevra" verfällt. Sie, die eigentlich Ginger heißt und offiziell Jarls Freundin ist, ist das erotische Sehnsuchtsobjekt der gesamten Kunst-Kompanie. Den armen Rudi aber erwischt es besonders schwer, so dass er als demütiger Minneheld der Angebeteten auf Schritt und Tritt folgt. Erst reist er ihr nach Rom nach (auch eine beziehungsreiche Adresse!). Später dann nach Berlin, ohne dass er jedoch je den Mut aufbrächte, sich seiner Herzensdame zu offenbaren. Was bleibt, ist eine wortreich-folgenlose Schwärmerei, die sich langatmig liest. Der Liebestaumel endet so schnöde wie symbolträchtig. Ähnlich wie der Maler vorher schon den Karriere-Gong Richtung neue Hauptstadt verschläft, überhört er eines Nachmittags auch, ungewollt eingenickt, das entscheidende Türklingeln Gingers. Rudi döst einfach weiter.
Das mag alles klug gedacht sein. Aber so viel Aufladung mit sinnschweren Zitaten und Bedeutung ermüdet irgendwann nicht nur die Hauptfigur. Am Schluss kann es einen darum auch nicht mehr wundern, dass Gruppenmitglied Horst sich pünktlich zu Silvester 2000 gleich selbst in die Luft sprengt. "Horsts Überreste", heißt es, "lagen in Blei gefasst." Womit zwar auch dem Letzten die Romanbotschaft zäher Ausweglosigkeit klar sein dürfte, die auf Rudi und seine Kumpane beim Kampf um "die Entwicklung des Eigenen, Individuellen" lauert. Etwas weniger Bildungsstolz des Autors und etwas mehr Mut zu tragischer Fallhöhe aber hätten dieser unterschwellig romantischen Apologie des Scheiterns sicherlich gutgetan.
GISA FUNCK.
Lars Brandt: "Gold und Silber". Roman. Carl Hanser Verlag, München 2008. 303 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Martin Krumbholz scheint selbst nicht ganz genau zu wissen, ob ihm dieser "üppige Roman" von Lars Brandt nun gefallen hat. Und wenn ja, warum. Doch er muss zugeben, sehr gelacht zu haben - auch wenn er nicht sicher ist, ob "mit oder über" die Hauptfigur Rudi. Ein Sympathieträger ist der unglücklich verliebte Protagonist mit seiner "tragikomischen Demuts-Arroganz" Krumbholz' Meinung nach jedenfalls nicht. Doch die "Trumpfkarte", ein Kommunikationsstil mit "Schnörkeln, Verstiegenheiten und Schrullen" hat in den Augen des Rezensenten auf jeden Fall Unterhaltungswert. Ob seine Irritation darüber berechtigt ist, dass eine unfundierte Hoffnung, wie Rudi sie im Bezug auf seine Angebetete hat, über 300 Seiten tragen soll, scheint der Rezensent selbst nicht so recht zu wissen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein kontemplatives und bei aller Melancholie doch sehr komisches Lesevergnügen." Christine Diller, Münchner Merkur, 15.07.08
"Lakonisch und skurril witzig [...], Sätze, über die man laut auflachen möchte, sind nicht selten in 'Gold und Silber' und machen die Lektüre zu einem grossen Vergnügen." Martin Krumbholz, Neue Zürcher Zeitung, 21.05.08
"Ein schönes Buch, das nach der Einheit von Empfindung und Sprache sucht." Christa Thelen, Park Avenue, 04.08
"Man merkt dem Autor an, der früher selbst als literarischer Performance-Künstler aufgetreten ist, dass er die Szene gut kennt und genug Sympathie für seine Helden besitzt, um deren Selbstüberschätzung mit genauem, mitfühlendem Blick zu schildern." Gisa Funck, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.04.08"Es gelingen Lars Brandt poetische Bilder und Stimmungen." Silja Ukena, Die Zeit, 06.03.08
"Lakonisch und skurril witzig [...], Sätze, über die man laut auflachen möchte, sind nicht selten in 'Gold und Silber' und machen die Lektüre zu einem grossen Vergnügen." Martin Krumbholz, Neue Zürcher Zeitung, 21.05.08
"Ein schönes Buch, das nach der Einheit von Empfindung und Sprache sucht." Christa Thelen, Park Avenue, 04.08
"Man merkt dem Autor an, der früher selbst als literarischer Performance-Künstler aufgetreten ist, dass er die Szene gut kennt und genug Sympathie für seine Helden besitzt, um deren Selbstüberschätzung mit genauem, mitfühlendem Blick zu schildern." Gisa Funck, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.04.08"Es gelingen Lars Brandt poetische Bilder und Stimmungen." Silja Ukena, Die Zeit, 06.03.08