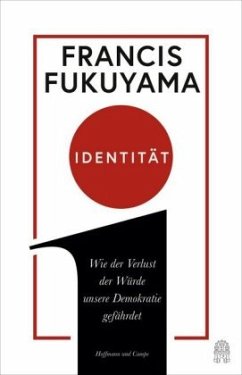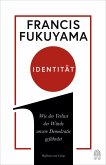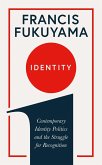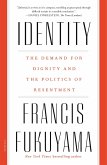»Intelligent und klar wir brauchen mehr Denker, die so weise sind wie Fukuyama.« The New York Times
In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der demokratischen Staaten weltweit erschreckend schnell zurückgegangen. Erleben wir gerade das Ende der liberalen Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, Autor des Weltbestsellers Das Ende der Geschichte, sucht in seinem neuen Buch nach den Gründen, warum sich immer mehr Menschen antidemokratischen Strömungen zuwenden und den Liberalismus ablehnen. Er zeigt, warum die Politik der Stunde geprägt ist von Nationalismus und Wut, welche Rolle linke und recht Parteien bei dieser Entwicklung spielen, und was wir tun können, um unsere gesellschaftliche Identität und damit die liberale Demokratie wieder zu beleben.
»Einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler der westlichen Welt.« Die Welt
In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der demokratischen Staaten weltweit erschreckend schnell zurückgegangen. Erleben wir gerade das Ende der liberalen Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, Autor des Weltbestsellers Das Ende der Geschichte, sucht in seinem neuen Buch nach den Gründen, warum sich immer mehr Menschen antidemokratischen Strömungen zuwenden und den Liberalismus ablehnen. Er zeigt, warum die Politik der Stunde geprägt ist von Nationalismus und Wut, welche Rolle linke und recht Parteien bei dieser Entwicklung spielen, und was wir tun können, um unsere gesellschaftliche Identität und damit die liberale Demokratie wieder zu beleben.
»Einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler der westlichen Welt.« Die Welt
"Fukuyama hat eines der wichtigsten Bücher verfasst, die man derzeit lesen sollte, wenn man den Zustand unserer Demokratie verstehen will." Sebastian Christ Huffingtonpost.de, 22.10.2018

Das „Ende der Geschichte“ machte den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama berühmt. Doch die Wirklichkeit fügte sich
seinen Thesen nicht. In seinem neuen Buch „Identität“ will er erklären, wie der Verlust der Würde die Demokratie gefährdet
VON THOMAS STEINFELD
In den Dreißigern lebte in Paris ein verarmter junger Russe von großer Gelehrsamkeit. An der École Pratique des Hautes Études hielt er Vorlesungen über Hegels „Phänomenologie des Geistes“. Sie wurden schnell berühmt, weckten unter französischen Intellektuellen ein neues Interesse am spekulativen Idealismus und veränderten die Wahrnehmung der Hegel’schen Werke vor allem unter Philosophen, die Hegel nicht auf Deutsch lesen konnten. Alexandre Kojève rückte den Abschnitt über Herr und Knecht, der im Original gerade einmal zehn Seiten umfasst und einem Stadium des Übergangs zum absoluten Wissen von sich selbst gilt, in den Mittelpunkt nicht nur der „Phänomenologie“, sondern des gesamten Hegel’schen Œuvres. Seitdem handelt dieses Werk, in den Augen überraschend vieler Menschen, von einem Motiv, das im spekulativen Idealismus nur in einem Übergang (der Herr ist das Wissen „an sich“, der Knecht ist das Wissen „für sich“) vorkam, aber nun als etwas Eigenständiges behandelt wird: nämlich von „Anerkennung“.
Von Anerkennung, oder, was beinahe dasselbe sein soll: von Identität, handelt das jüngste Buch des amerikanischen Politologen Francis Fukuyama. Das ist kein Zufall. Denn auch das Werk, mit dem Fukuyama auf der ganzen Welt berühmt wurde, der Essay vom „Ende der Geschichte“ aus dem Jahr 1992, beruht auf der Anverwandlung eines Gedankens aus der Hegel’schen Philosophie, der dann von Alexandre Kojève verändert und verselbständigt wurde. So wie Hegel in seiner Rechtsphilosophie meinte, dass die Geschichte des Geistes in seiner eigenen Philosophie abgeschlossen werde, der wiederum im praktischen Leben der preußische Verwaltungsstaat entspreche, so erklärte Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums, das Ende der Geschichte sei nun erreicht – in der liberalen, marktwirtschaftlich orientierten Demokratie.
Fukuyama hatte diese kompakte, auf eine „one great idea“ hin orientierte Denkungsart von seinem Lehrer, dem Philosophen Allan Bloom übernommen, der wiederum bei Leo Strauss gelernt hatte, dem politischen Philosophen und Haupt der elitistischen „Chicago School“ – der ein enger Freund Alexandre Kojèves gewesen war. Indessen verfehlten die politischen Ereignisse der vergangenen fünfundzwanzig Jahre den ihnen von Francis Fukuyama zugeschriebenen Zweck. Etwa in der Rückkehr Russlands zu einer autoritären Herrschaft, im Aufstieg Chinas, einem nunmehr zwar kapitalistischen, aber weder liberalen noch demokratischen Staat, oder im Vordringen nationaler oder religiöser Fundamentalismen.
„Identität“ ist ein Versuch, die These aus den Neunzigern zu retten, wiederum im angeblichen Rückgriff auf Hegel und den spekulativen Idealismus. Gleich zu Beginn erklärt Fukuyama, von einem „Ende der Geschichte“ stets nur in Form einer Frage gesprochen zu haben. Außerdem hätten seine Kritiker nicht verstanden, dass man „Ende“ nicht temporal, sondern, wie bei Hegel, im Sinn einer systematischen Vollendung zu verstehen habe. Richtig ist an diesen Einwänden so viel, dass Fukuyama zwar behauptet, die Geschichte sei an ihr Ende geraten, selbst aber diese Aussicht eher trist findet. Doch gleichwohl: in der vermutlich zutreffenden Annahme, dass seine Leser nicht bei Hegel nachschlagen werden, führt Fukuyama nun ein verzögerndes oder vielleicht sogar aufhebendes Moment in seine Geschichtsphilosophie ein, eben jene „Identität“: „Der globale Hang zur Demokratie, der Mitte der siebziger Jahre begann (...), ist in eine globale Rezession übergegangen.“
Vor allem in Folge der großen Finanzkrisen der vergangenen zehn, fünfzehn Jahre sei dieser „Hang“ nämlich in die Hände partikularer Kräfte oder „Interessengruppen“ übergegangen, deren deutlichster Ausdruck im Westen die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Ausstieg Großbritanniens aus der europäischen Union sei.
„Das Verlangen nach Anerkennung der eigenen Identität vereint als Leitmotiv vieles von dem, was sich heutzutage in der Weltpolitik abspielt“, erklärt Fukuyama. Danach führt er aus, dass diesem Verlangen eine spezifisch bürgerliche Denkungsart zugrunde liege, wie sie überhaupt erst im ausgehenden 18. Jahrhundert hervortrete: im Auseinander eines Bewusstseins von Gleichheit, in dem ein freier Wille agiert, der sich die Welt als ein Ensemble von Möglichkeiten vorstellt, und einer vorhandenen gesellschaftlichen Lage, in der sich alle Möglichkeiten als höchst begrenzte erweisen. Aber ist dieses „Verlangen nach Anerkennung“ überhaupt vernünftig, das heißt: den tatsächlichen Erfahrungen vieler Menschen angemessen?
Offenbar wird es doch immer wieder enttäuscht, was ja Grund genug sein könnte, den Gedanken fallen zu lassen. Oder anders gefragt: Könnte es nicht sein, dass jenes Verlangen nichts anderes ist als eine psychologische Technik, mit dem Zweck, sich, wie Hegel gesagt hätte, als „abstrakt freies Subjekt“ zu behaupten, obwohl und weil eben diese Freiheit praktisch immer wieder dementiert wird? Dass also das Verlangen nach Anerkennung und dessen notwendige Enttäuschung keine Gegensätze bilden, sondern zwei Seiten ein und desselben affirmativen Gedankens bilden – affirmativ, weil er die Ideologie des Wettbewerbs und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Hierarchien unangetastet lässt?
Nun ist Fukuyama, aller Hegel-Verweise zum Trotz, kein Dialektiker. Das „Verlangen nach Anerkennung“ wird nicht nach Gründen, Verlaufsformen und Widersprüchen befragt. Stattdessen erscheint es als etwas so Evidentes und Unwidersprechliches, als wäre es in Stein geschlagen – und nicht in die warme Butter der schwankenden Urteile, die ein solches „abstrakt freies Subjekt“ im Laufe der Tage und Jahre über die eigene Vortrefflichkeit fällt. „Identität“, behauptet Francis Fukuyama, „erwächst vor allem aus einer Unterscheidung zwischen dem wahren inneren Selbst und einer Außenwelt mit gesellschaftlichen Regeln und Normen, die den Wert oder die Würde des inneren Selbst nicht adäquat anerkennt.“ Das kann nicht anders sein, wenn es keine anderen Maßstäbe für das „wahre innere Selbst“ gibt als diejenigen, die dieses Selbst sich gesetzt hat. Eine Gesellschaft, in der jedem „wahren inneren Selbst“ Genüge getan worden wäre, hat es deswegen nie gegeben. Es kann sie nicht geben.
Fukuyama meint indessen in den entsprechenden Enttäuschungen die Gründe einer „Politik des Unmuts“ zu erkennen, wie sie sich in den vergangenen Jahren in den meisten demokratischen Staaten durchsetzte, ausgehend von neuen, rechtspopulistischen Bewegungen und getragen von der Überzeugung, die Bürger würden vom Staat und seiner „Elite“ betrogen. Und nicht nur das: Auch die Islamisten sollen von einem unerfüllten Bedürfnis nach Anerkennung getrieben sein. Wäre es da nicht am einfachsten, der Staat, gleich welcher, würde seinen Fundamentalisten nachdrücklich mitteilen, bei ihnen handele es sich, in jedem Fall, um ganz wunderbare und einzigartige Menschen?
Und überhaupt: Wann hätte es so etwas tatsächlich einmal gegeben: einen Staat, der seinen höchsten Zweck nicht etwa in der möglichst erfolgreichen Behauptung seiner selbst erkannt hätte, sondern im Wohlergehen seiner Bürger? Und da es einen solchen Staat nicht gab, zu keinem Zeitpunkt der Geschichte: Warum fragt Francis Fukuyama nicht, welche Realität dem Bewusstsein, betrogen zu werden, überhaupt zugrunde liegt? Nein, dieser Versuch des amerikanischen Gelehrten, Geistesgeschichte und politische Geschichte zu verschmelzen, mündet in eine Schlacht der Phantome von spukhaftester Gestalt.
Von Alexandre Kojève hat Francis Fukuyama gelernt, wie man ein Element der philosophischen Tradition in ein Fundstück verwandelt, das man einer staunenden Öffentlichkeit als den einen, bislang in den dunklen Tiefen des Weltgeistes verborgenen, nun aber endlich gehobenen Schlüssel zum Verständnis der Welt präsentiert. In seinem jüngsten Werk aber demontiert er das Verfahren. Das „Ende der Geschichte“ mag (vorübergehend) als ein solcher Schlüssel erscheinen, Reflexionskategorien wie „Anerkennung“ oder „Identität“ aber taugen nicht dazu. Nicht einmal Fukuyama selbst braucht sie, wenn er am Ende des Buches ein paar Maßnahmen vorschlägt, mit denen Staat und Demokratie der neuen fundamentalistischen Bewegungen Herr werden könnten.
So landet Francis Fukuyama bei den üblichen Einfällen: bei einer Stärkung der Außengrenzen, bei verbesserten Strategien zur „Assimilation“ von Ausländern, bei der Schaffung einer „nationalen Bekenntnisidentität“ auf der Grundlage von „Konstitutionalismus, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit“. Wieso man einen bösartigen Nationalismus überwinden können soll, indem man ihn bestätigt, und wieso man für eine Operation von solcher Einfalt auf einen Hegel zurückgreifen muss, den es nie gab – das alles verbleibt im Reich der Geister.
Francis Fukuyama: Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2019. 240 Seiten, 22 Euro.
„Der globale Hang zur
Demokratie (...) ist in eine globale
Rezession übergegangen.“
Hier tobt ein Schlacht der
Phantome im Geisterreich, nach
Realitäten wird kaum gefragt
„Das Verlangen nach Anerkennung der eigenen Identität vereint als Leitmotiv vieles von dem, was sich heutzutage in der Weltpolitik abspielt“: Francis Fukuyama, Jahrgang 1952, lehrt an der Stanford-Universität.
Foto: Djurdja Padejski/PR
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Jeder Gruppe ihre eigene Bedrohung: Francis Fukuyama untersucht die Gründe für das Wiedererstarken von Identitätsfragen in der Politik. Aber seine Argumentation ist nicht stichhaltig.
Wer, wenn nicht der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der vor dreißig Jahren "Das Ende der Geschichte" prophezeite, könnte erklären, warum der proklamierte Sieg der liberalen Demokratie dann am Ende doch ausgeblieben ist, diese sich vielmehr auf dem Rückzug zu befinden scheint. Nicht nur ist die Gesamtzahl demokratischer Staaten rückläufig.
Darüber hinaus sind viele autoritäre Staaten, wie etwa China und Russland, selbstbewusster geworden, und Länder - darunter Ungarn, Polen, Thailand und die Türkei -, die noch in den neunziger Jahren den Eindruck erweckten, sich in eine demokratische Richtung zu entwickeln, gleiten plötzlich wieder in Richtung Autoritarismus ab. Noch bedeutsamer sind die Wahlsiege, die populistische und nationalistische Rechtsparteien in den Vereinigten Staaten und Europa erzielt haben.
Was sind die Ursachen dafür, dass sich überall auf der Welt und selbst in den reichen Ländern immer mehr Menschen von modernen Demokratien abwenden und sich lieber autokratischen Führern oder nationalistischen und religiösen Protestbewegungen zuwenden? Für Fukuyama ist diese Frage eng mit einer anderen Frage, jener nach dem erstaunlichen Aufstieg der Identitätspolitik zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, verbunden.
Während im zwanzigsten Jahrhundert das politische Denken überwiegend von Wirtschaftsfragen bestimmt worden sei, werde die heutige Politik auf beiden Seiten des politischen Spektrums durch eine obsessive Beschäftigung mit Fragen von Anerkennung und Status bestimmt. Die Linke richte ihr Augenmerk nicht mehr primär darauf, ökonomische Gleichheit herzustellen, sondern konzentriere sich zunehmend darauf, die Interessen einer breiten Vielfalt benachteiligter Gruppen - wie etwa von Frauen, ethnischen Minderheiten, Flüchtlingen und der LGBT-Community - zu fördern. Der Rechten läge vor allem der Patriotismus am Herzen, der Schutz der nationalen Identität, die häufig explizit mit Rasse, Ethnizität, Heimat oder Religion verknüpft wird.
Die primäre Ursache für den Politikwechsel hin zu Identitätsfragen sieht Fukuyama in einem aus zunehmenden gesellschaftlichen Ungleichheiten erwachsenden Würdedefizit in den verarmten oder vom Abstieg bedrohten Bevölkerungsschichten. Die Linke hätte versäumt, an eine geteilte Erfahrung der Ausbeutung zu appellieren: Statt ihr Augenmerk weiterhin auf die Verringerung ökonomischer Ungleichheit zu richten, konzentrierte sie sich auf immer kleinere Gruppen, die auf spezifische Weise marginalisiert werden.
Durch die einseitige Unterstützung von Bewegungen wie #MeToo oder Black Lives Matter und die Behauptung, die Lebenserfahrungen von Frauen oder Schwarzen seien grundsätzlich andere als die von Männern oder Weißen, habe die Linke von den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen und den Abstiegssorgen weitaus größerer Gruppen abgelenkt; von Problemen, wie sie sich gegenwärtig etwa in der Opioid-Krise, der hohen Arbeitslosigkeit in den Staaten des sogenannten Rustbelts und der Zunahme gesellschaftlicher Armut zeigten.
Das größte Problem linker Identitätspolitik sieht der Autor darin, dass die sozialen Gegenbewegungen der Linken unfreiwillig eine Vorreiterrolle für die gegenwärtige Identitätspolitik der Rechten gespielt hätten. Ähnlich wie die Politik der Schwarzen- oder der Frauenbewegung sei auch die Politik der Trump-Anhänger zutiefst vom Gefühl gruppenspezifischer Benachteiligung durchdrungen.
Trumps Wähler unter der weißen Arbeiterschaft hätten sich von der Linken und den liberalen Eliten abgewandt, weil sie ihre traditionellen Werte von der urbanen Mittelschicht bedroht gesehen und den Eindruck gewonnen hätten, dass den identitätspolitischen Anliegen von Minderheiten der Vorzug gegenüber den Interessen der Arbeiter und der einfachen Landbevölkerung gegeben werde. Trotz ihrer Zugehörigkeit zur dominierenden Volksgruppe hielten sich viele weiße Arbeiter deshalb für ausgegrenzt und fühlten sich ungerecht behandelt. Diese Gefühle, so Fukuyama, ebneten nun den Weg für eine rechte Identitätspolitik, die im Extremfall die Gestalt eines unverhohlen rassistischen weißen Nationalismus annehmen könne.
Doch so plausibel Fukuyamas Argumentation zunächst erscheint, so wenig stichhaltig ist sie auf den zweiten und dritten Blick. Das Problem besteht nicht allein darin, dass hier einmal mehr Klassenpolitik gegen Identitätspolitik ausgespielt wird. Gemessen an den strengen Kriterien Fukuyamas, wäre nämlich auch die während des zwanzigsten Jahrhunderts von den Gewerkschaften betriebene Klassenpolitik überwiegend als Identitätspolitik zu werten, da sie ihrer Natur nach keineswegs universalistisch, sondern partikularistisch war und in erster Linie den Interessen der weißen männlichen Arbeiter und Angestellten diente.
Die Partikularität des Klassenkampfes konnte nur deshalb so lange unbemerkt bleiben, weil die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Schwarzen und Weißen oder Einheimischen und Migranten in der Praxis lange Zeit schlicht kein Thema war. Wenn man nun, wie Fukuyama, diese Bewegungen als Identitätspolitik apostrophiert, lässt man sich auf eine fragwürdige Hierarchisierung sozialer Ungerechtigkeiten ein - und fällt damit zurück in eine fruchtlose Debatte, die schon in den siebziger Jahren die Linke gespalten hatte: Auch damals wurden der Hauptwiderspruch - der zwischen Kapital und Arbeit - und der sogenannte Nebenwiderspruch - die Ausbeutung von Frauen durch unbezahlte Sorge- und Hausarbeit - gegeneinander ausgespielt.
Das eigentliche Defizit des Erklärungsansatzes von Fukuyama liegt darin, dass sich seine Frage, warum und unter welchen Bedingungen sich gesellschaftliche Würdedefizite durch populistische oder nationalistische (und nicht etwa durch linke) Bewegungen mobilisieren lassen, auf diese Weise nicht beantworten lässt, unterschlägt sie doch eine fundamentale Differenz zwischen rechten und linken Bewegungen: Während linke Politik auf die künftige Aufhebung von Ungleichheiten im Interesse der Benachteiligten zielt, tritt rechte Politik gerade umgekehrt für den Erhalt beziehungsweise die Wiedererlangung verlorener oder verloren geglaubter Privilegien von bislang etablierten Gruppen ein.
Linke Bewegungen ergreifen Partei für die Interessen der Benachteiligten und versprechen eine bessere Zukunft. Rechte Parteien erweisen sich dagegen als die Anwälte der bedrohten oder bereits verlorengegangenen Vorrechte von Etablierten, weshalb die Vergangenheit zur relevanten Bezugsgröße rechter Gesellschaftsbilder wird. Der Vorschlag Fukuyamas, eine größere und einheitlichere nationale Identität zu definieren, die der Konzentration auf immer enger gefasste Gruppenidentitäten entgegenwirken und etwa kulturübergreifende, "nationale Bekenntnisidentitäten" fördern soll, die nicht mehr auf gemeinsamen persönlichen Erfahrungen oder auf einer einheitlichen Tradition oder Religion, sondern auf geteilten Grundwerten und -überzeugungen beruhten, muss vor diesem Hintergrund wie ein Placebo erscheinen.
Rechtsparteien sind keine Würdelieferanten für Benachteiligte, sondern vielmehr Stabilitätsgaranten in einer durch Umwälzungen aufgerüttelten Gesellschaft, in der die bürgerlichen Parteien Kontinuität und damit die Vorrechte der Etablierten nicht mehr zu garantieren scheinen. Dies ist auch der Grund, warum sich die Anhänger der Rechten, anders als Fukuyama behauptet, keineswegs primär in den unteren Schichten, sondern klassenübergreifend finden.
Trump und die neuen europäischen Rechtsparteien stiften eine vertikale Allianz der Globalisierungsgegner, eine Koalition zwischen konservativen Eliten und Gruppen der sozialen Mitte sowie der Unterprivilegierten, deren gemeinsames Merkmal ist, dass sie ihr persönliches Schicksal eng mit dem Schicksal der Nation verbunden sehen (wenn auch aus unterschiedlichen Gründen) und mit der Unordnung in der Welt in Ruhe gelassen werden wollen. Diese Gruppen erweisen sich als für das Kernversprechen der Rechtsparteien empfänglich, nämlich dafür zu sorgen, dass sich nichts ändert.
CORNELIA KOPPETSCH
Francis Fukuyama: "Identität". Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet.
Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2019. 240 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Arno Widmann stellt erst einmal klar, dass Francis Fukuyama nie das Ende der Geschichte proklamiert hat, sondern höchstens das Ziel erreicht sah, demzufolge Konflikte um Anerkennung in Freiheit und Gleichheit ausgetragen werden können. Fukuyama sei ein Liberaler und Hegelianer, betont Widmann, kein auftrumpfender Chauvinist. Und deswegen liest der Rezensent auch zustimmend, dass Anerkennung Fukuyama zufolge bedeute, dass man anderen das Recht zubillige, an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken. Widmann verrät allerdings nicht, ob Fukuyama das auf Individuen oder Gruppen bezieht. Gefallen lässt sich der Rezensent jedenfalls auch den typischen Fukuyama-Sound, der große Schneisen durch die Geschichten schlägt, vom Englischen Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert zum Polen des Jahres 2018 etwa. Das Staatsragende und das mitunter unfreiwillig Komische verzeiht er Fukuyama gern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Fukuyama arbeitet sehr gut heraus, dass die unzureichende Anerkennung der Würde des Menschen in Wirtschaft und Staat eine Schlüsselrolle für die Erosion demokratischer Kultur spielt.« Ingo Zander WDR 3 Mosaik, 08.03.2019