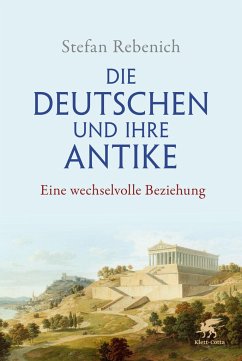200 Jahre Antikensehnsucht und Geschichte der Altertumswissenschaft
Zugänglich und spannend erzählt Stefan Rebenich pointiert die Entwicklung der deutschen Althistorie, die Weltruhm erlangte, aber auch politisch missbraucht wurde. Anhand zentraler Diskurse und wichtiger Institutionen würdigt er kritisch grandiose Leistungen wie Verfehlungen bedeutender Historiker. Ein einzigartiges Buch über die besondere Beziehung der Deutschen zur Antike.
Seit mehr als 200 Jahren hat das griechisch-römische Altertum die deutsche Nationalkultur und unsere kollektive Identität mitgeprägt. Stefan Rebenich, einer der führenden deutschen Alt- und Wissenschaftshistoriker, bietet eine ebenso konzise wie glänzend geschriebene Darstellung der wechselvollen und oft kontroversen Geschichte seiner Disziplin. Dabei schildert er nicht nur die politischen und wissenschaftlichen Biographien einzelner herausragender Historiker (u. a. Mommsen, Wilamowitz, Harnack), sondern er berücksichtigt auch bedeutende Wissenschaftsinstitutionen und legt die zeitbedingten Faktoren der historischen Forschung offen. Souverän behandelt er Kontroversen und Themen, die die Entwicklung des Faches bestimmten, und zeigt schonungslos anhand ausgewählter, wenig bekannter Quellen die ideologische Vereinnahmung der Alten Geschichte und die Anpassung ihrer Vertreter im Nationalsozialismus. Was also bleibt und wo stehen wir nach dem Bedeutungsverlust der Antike als Leitbild, fragt der Autor mit einer aktuellen Wendung: Noch heute ist die Beschäftigung mit der Fremdheit der Antike eine intellektuelle emanzipatorische Übung, uns selbst in Frage zu stellen und uns selbst zu finden.
Zugänglich und spannend erzählt Stefan Rebenich pointiert die Entwicklung der deutschen Althistorie, die Weltruhm erlangte, aber auch politisch missbraucht wurde. Anhand zentraler Diskurse und wichtiger Institutionen würdigt er kritisch grandiose Leistungen wie Verfehlungen bedeutender Historiker. Ein einzigartiges Buch über die besondere Beziehung der Deutschen zur Antike.
Seit mehr als 200 Jahren hat das griechisch-römische Altertum die deutsche Nationalkultur und unsere kollektive Identität mitgeprägt. Stefan Rebenich, einer der führenden deutschen Alt- und Wissenschaftshistoriker, bietet eine ebenso konzise wie glänzend geschriebene Darstellung der wechselvollen und oft kontroversen Geschichte seiner Disziplin. Dabei schildert er nicht nur die politischen und wissenschaftlichen Biographien einzelner herausragender Historiker (u. a. Mommsen, Wilamowitz, Harnack), sondern er berücksichtigt auch bedeutende Wissenschaftsinstitutionen und legt die zeitbedingten Faktoren der historischen Forschung offen. Souverän behandelt er Kontroversen und Themen, die die Entwicklung des Faches bestimmten, und zeigt schonungslos anhand ausgewählter, wenig bekannter Quellen die ideologische Vereinnahmung der Alten Geschichte und die Anpassung ihrer Vertreter im Nationalsozialismus. Was also bleibt und wo stehen wir nach dem Bedeutungsverlust der Antike als Leitbild, fragt der Autor mit einer aktuellen Wendung: Noch heute ist die Beschäftigung mit der Fremdheit der Antike eine intellektuelle emanzipatorische Übung, uns selbst in Frage zu stellen und uns selbst zu finden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Arno Orzessek bekommt trockene Kost mit Stefan Rebenichs Buch über die Altertumsforschung in Deutschland. Von Hölderlins seligem Hellas oder Schliemanns Troja keine Rede, warnt er den Leser. Dafür schildert der Autor getreulich den Einfluss, die Projekte und die Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Altertumswissenschaft, erklärt Orzessek. Das kann spannend sein, meint er, wenn Rebenich hinter die Kulissen und auf die Dramen der akademischen Postenschacherei und Machtkämpfe schaut, oder aufschlussreich, wenn er kaum bekannte Gelehrte vorstellt. Das Buch ist eine Komposition aus älteren Aufsätzen des Autors, aber eine elegante, verrät Orzessek.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Selbstvergewisserungen im Blick zurück: Stefan Rebenich zeichnet deutsche Beschäftigungen mit der Antike nach
Vor bald dreißig Jahren legte der Neuzeithistoriker Hagen Schulze in einem noch immer lesenswerten Aufsatz dar, warum im Laufe der europäischen Geschichte wiederholt auf die Antike zurückgegriffen wurde und es zu Renaissancen kam, in denen ein antikes 'Erbe' konstruiert, rezipiert und transformiert wurde. Diese Wiedererweckungen boten den Europäern auf dem Weg in die verstörende Moderne Anker, um "dem Ansturm des gänzlich Neuen zu widerstehen, den Standort des Ich wie des Anderen zu bestimmen und die Erscheinungen zu kategorisieren".
Der Anker bestand in einem Bezugssystem von Namen, Ereignissen, Ideen, Formen, Symbolen und Zitaten, die neben der biblischen Welt über lange Zeit gesicherter Bestandteil des europäischen Wissenskanons waren. Doch allein als Zuflucht vor dem alles durchgärenden Wandel hätten die Alten kaum ein so mächtiges zweites Leben erlangen können. Schulze sah im Haupterbe der Antike, dem Vertrauen auf die menschliche Fähigkeit zur Vernunft, einen Impuls zur steten Weiterentwicklung, die möglich war, weil sie sich in den vertrauten Begriffen, Denkformen und Grundsätzen der antiken Überlieferung bewegte, doch gleichwohl über diese hinaus neue Pfade und Ziele suchte.
Im Rahmen dieses übergreifenden Prozesses ist der Weg der Deutschen zu sich selbst auf dem Umweg über die Alten oft behandelt worden. Sätze wie Mephistos "Es ist ein altes Buch zu blättern: Vom Harz bis Hellas immer Vettern!" wurden zu goldenen Worten, und nach dem Zweiten Weltkrieg variierte E. M. Butler die These von einem fatalen deutschen Sonderweg in dem plakativen Buchtitel "The Tyranny of Greece over Germany". In aktuellen Debatten um die Zukunft der Demokratie kommen expertokratische Modelle à la Platon ebenso auf den Tisch wie die Vorteile der Losung von Funktionsträgern, die im klassischen Athen Kernbestand demokratischer Praxis war.
Grund und Anlass genug also, zu differenzieren und die Umstände der wechselvollen Beziehungen der Deutschen zu "ihrer" Antike zu klären. Der Berner Althistoriker Stefan Rebenich hat seit mehr als zwei Jahrzehnten zahlreiche Studien vorgelegt; diese finden sich nun in stark überarbeiteter Gestalt und ergänzt durch gänzlich neu verfasste Kapitel zu einem filigran komponierten Buch vereint. Der Autor schreibt Wissenschaftsgeschichte auf der Höhe der Zeit, mit Blick zugleich auf leitende Ideen, formative Institutionen, wegweisende Individuen und markante Inhalte. Ausgeklammert bleibt mit gutem Grund das Riesenfeld der Antike-Rezeption in Literatur, Architektur und Bildender Kunst; auch in dem eindringlichen Stück zum Platonbild im George-Kreis geht es primär um die Bemühungen der gelehrten Adepten des Meisters, in Abgrenzung von der akademischen Klassischen Philologie Sein und Gestalt zu schauen.
Rebenich sucht immer wieder die Archive auf. So erschließt ein besonders lesenswertes Kapitel den Neustart wissenschaftlicher Kommunikation nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von "ersten Briefen", in denen die Fachgemeinschaft Exklusion und Inklusion aushandelte. Manch glücklicher Fund vermag aktuelle Moden ironisch zu spiegeln. So wollten 1938 die Leipziger Ordinarien für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte - Helmut Berve, Hermann Heimpel und Otto Vossler - hinfort nur noch Professoren der Geschichte heißen, da sich die überkommene Fächerteilung längst als fragwürdig, ja unerträglich erwiesen habe. Forschungsstand und Zeitgeist wiesen vielmehr auf das Ganze, da inzwischen "das Volk als übergreifende Macht in der Geschichte anerkannt und zugleich das räumliche wie das zeitliche geschichtliche Weltbild, insbesondere auch die Vorgeschichte, in einen ganz neuen Rahmen gestellt ist, in dem der landläufige Dreitakt der Geschichte als kleinlich und scholastisch im schlechten Sinne des Wortes erscheinen muss". Angesichts der Wucht gegenwärtiger Umbrüche trete die Einheit der deutschen und damit der Weltgeschichte neu ins Bewusstsein, und "die Entdeckung der Rasse als Geschichtsmacht würde allein schon genügen, die Herkunft des eigenen Seins in einer weltgeschichtlichen Sicht zu sehen". Periodisierungskritik und Globalgeschichte können ihre Tücken haben.
Das Buch spannt den Bogen einer modernen, zugleich kritischen Wissenschaftsgeschichte von 1800 bis in die Gegenwart; dabei sind auch Lücken benannt. So sei die Geschichte der Frauen in den Altertumswissenschaften und überhaupt deren Bedeutung für die Rezeption der klassischen Antike noch zu schreiben. Erst seit den späten Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurden Wissenschaftlerinnen auf Professuren berufen. In den strukturkonservativen Fächern, so stellt der Autor ohne Beschönigung fest, waren universitäre Besetzungsverfahren jahrzehntelang von Männerbünden dominiert und von männlichen Netzwerken kontrolliert. Indem Rebenich Brennweite und Tiefenschärfe variiert, von mauerschauartigen Überblicken bis zu detaillierten Fallstudien, bekommt er die Vielfalt der Befunde in den Griff und vermeidet, in lineare Fortschritts- oder Niedergangerzählungen zu verfallen. In der Tat folgten auf Phasen produktiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung immer wieder auch Perioden von Stagnation.
Die Geschichte der Altertumswissenschaften, einer der roten Fäden, ist vor allem deshalb wichtig, weil ihr Gegenstand zugleich einen Hauptinhalt von Bildung darstellte und insofern Teil einer breit angelegten Gesellschaftsgeschichte ist. Mit Recht schildert Rebenich an der Person und den Projekten Wilhelm von Humboldts, wie im Deutschland des frühen neunzehnten Jahrhunderts die Antike als historiographisches Konstrukt und als idealisierte zeitlose Projektion individueller wie kollektiver Wünsche maßgeblich zur kulturellen Homogenisierung des Bürgertums sowie zur Formierung eines bürgerlichen Selbstverständnisses beitrug, wie aber im weiteren Verlauf der Weg in die arbeitsteilige, quasiindustrielle Großforschung im Sinne Theodor Mommsens zwar "die Archive der Vergangenheit zu ordnen" ermöglichte, diese Entwicklung aber spätestens nach 1918 vielen als Sackgasse erschien - auf der Suche nach Sinn und Vorbildern wurde das historistische Paradigma vielfach schroff abgelehnt. Auch für die Zeit nach 1945 ist das Bild nicht eindeutig: Neben Kontinuitätsfiktionen und restaurierte Betriebsamkeit traten neue Perspektiven, oft inspiriert von anderen Disziplinen und Ländern.
Das emanzipatorische Potential einer diverser gewordenen, kritisch erforschten und auf vielen Wegen vermittelten Antike erscheint Rebenich über all die Wendungen hinweg keineswegs erschöpft; im Sinne Humboldts das Eigene am Fremden zu verstehen sei unverändert plausibel, ebenso der Hinweis von Claude Lévi-Strauss, keine Kultur könne sich selbst denken, wenn sie nicht auf andere Gesellschaften blicke, die als Vergleichsmaßstab dienen. Das Studium der Alten Welt, ihrer Sprachen und Kulturen bleibt demnach eine wirkungsvolle Technik der Entfremdung, eine intellektuelle Übung, um die eigene Position in Frage zu stellen. UWE WALTER.
Stefan Rebenich: "Die Deutschen und ihre Antike". Eine wechselvolle Beziehung.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2021. 496 S., geb., 38,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Traum von Humanität – oder gnadenloses Leistungsdenken? Stefan Rebenichs Studien über „Die Deutschen und ihre Antike“
Ganz düster kann es werden, wenn man sich ansieht, wie Deutsche sich früher auf die Antike berufen haben. Der spartanische Feldherr Leonidas, der seine Soldaten in der Schlacht bei den Thermopylen vor 2500 Jahren in einem Engpass in den Opfertod trieb, wurde in Adolf Hitlers Führerbunker und in Stalingrad als Vorbild für unbändigen Durchhaltewillen beschworen. Man faselte von der „ethischen Größe des dorischen Volkes“ (Werner Jaeger). In der Weimarer Republik stilisierten demokratiefeindliche Philologen altrömische Wertbegriffe zu Schlagworten der konservativen Revolution. Den militärischen Drill fürs Vaterland exerzierten Studienräte in deutschen Gymnasien ersatzweise an zarten Knaben durch, in Grammatikübungen und Horaz-Versen.
Ganz hell aber kann es werden, wenn sich ein anderes Bild von deutscher Antiken-Manie auftut: ein Traum von Schönheit, Humanität und Vervollkommnung durch Bildung. Aus dem kosmopolitischen Klassizismus der Aufklärungszeit, angestoßen von Winckelmann – dem schwärmenden Bewunderer der antiken Kultur, aber auch Mitbegründer der modernen Archäologie und Kunstgeschichte –, erwuchs dieser Traum in der Weimarer Klassik und in den idealistischen Anfängen des preußischen Gymnasiums.
Wilhelm von Humboldt, Schöngeist, Diplomat, Sprachforscher und Bildungsreformer, verknüpfte mit den allerbesten Absichten die Entfaltung des Individuums mit einer angeblichen Wesensverwandtschaft zwischen der noch ungeeinten deutschen Kulturnation und den alten Griechen. Deutschland zeige, so meinte Humboldt, „in Sprache, Vielseitigkeit der Bestrebungen, Einfachheit des Sinnes, in der föderalistischen Verfassung, und seinen neuesten Schicksalen eine unleugbare Ähnlichkeit mit Griechenland“. Hier im Lande von Hölderlins seligen Genien herrschte, auch in Abgrenzung zum lateinischen Frankreich, die „Tyranny of Greece over Germany“, so der Titel eines berühmten Buches der englischen Germanistin E. M. Butler aus dem Jahr 1935. Aber die einst so dominante klassische Bildung war auch, wie Stefan Rebenich schreibt, „Ausdruck einer Emanzipationsbewegung des deutschen Bürgertums“.
Wie passt das zusammen, das dunkle und das helle deutsche Altertum? Niemand ist berufener, das kritisch zu erkunden, als der in Bern lehrende Althistoriker Stefan Rebenich. Er ist der Biograf von Theodor Mommsen, einer zentralen Gründerfigur der Altertumswissenschaften im 19. Jahrhundert, ist Kenner der Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte und hat einen weiten kulturgeschichtlichen und methodischen Horizont.
Rebenich hat nun in seinem neuen Buch „Die Deutschen und ihre Antike“ eine Erklärung für die Brüche und Gegensätze: Er findet sie in den ständigen Widersprüchen zwischen der akademischen Professionalisierung und der Bewunderung der Griechen und Römer. Der Philologe August Böckh zum Beispiel, der von 1810 an sein Fach an der neu gegründeten Berliner Universität aufbaute, plädierte einerseits für eine knallhart illusionslose Erforschung der antiken Realität bis in die kleinste Einzelheit: Er „bedaure nicht, wenn die unbedingte Verehrung der Alten gemäßigt werden muss, weil sich ergibt, dass, wo sie Gold berühren, auch ihren Händen Schmutz anklebt“. Andererseits aber beschrieb derselbe Böckh sein Forschungsprogramm als „Erkenntnis des Edelsten, was der menschliche Geist in Jahrtausenden hervorgebracht hat“.
Das ist das Leitmotiv von Rebenichs Buch: der „Widerspruch von Normativität und Historizität“. Dass die moderne Forschungsuniversität entstehen konnte, die bald von Deutschland aus international ausstrahlte, hatte zwei Quellen, die von den Akteuren oft gar nicht unterschieden wurden: die Begeisterung für die Mittelmeerkulturen von Homer bis zur römischen Kaiserzeit; und die Absicht, mit unbestechlicher Wissenschaftlichkeit und kritischer Quellenarbeit die Totalität der Vergangenheit zu erschließen.
Im 19. Jahrhundert wurden gigantische Editions- und Ausgrabungsprojekte gestartet, die zum Teil bis heute laufen. Inschriften, Bauten, Münzen, Kulte, Sprachgeschichte, literarische Überlieferung – alles sollte komplett und zuverlässig erschlossen werden. Man „glorifizierte die innerweltliche Gelehrtenaskese“, schreibt Rebenich, mit einem neuen bürgerlichen Leistungsethos, zugleich differenzierten sich die Fächer der mittelalterlichen Universität in Einzeldisziplinen: Lehrstühle für Archäologie, Byzantinistik und Mittellatein entstanden, dazu Ägyptologie, Orientalistik, die modernen Philologien und die unaufhaltsamen Naturwissenschaften. Die klassischen Studien bekamen also viel Konkurrenz, auch durch die romantische Mittelalterbegeisterung.
Noch in der Kaiserzeit wollte der berühmte Gräzist Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff in Berlin an der Idee einer umfassenden Antikenforschung festhalten: „Alles, alles gehört zur Philologie“, postulierte er, „denn es gehört zu dem Objekte, das sie verstehen will, auch nicht eines kann sie missen“. Das Problem: Nur noch wenige Ausnahmegelehrte wie Wilamowitz waren dazu im Zuge wachsender Spezialisierung in der Lage. In Wirklichkeit sah es aus, wie Rebenich schreibt: „Die Modernisierung der altertumskundlichen Fächer zerstörte die Antike als fächerübergreifendes Ideal.“
Und dieser Phantomschmerz konnte den Altphilologen, den bis zur Zeit der Weltkriege eigentlich am meisten geachteten Lehrern der Nation, Sinnkrisen bereiten. Dazu findet man einiges im Werk von Friedrich Nietzsche, dem entlaufenen Philologieprofessor. Jene Ernüchterung sorgte für die Abschottung in den angeblich wertfreien Großforschungsprojekten, aber eben auch für die politische Anfälligkeit für pervertierte Ideale – siebe oben.
Zu diesem deutschen Komplex sind Stefan Rebenichs Studien eine wahre Fundgrube. Allerdings fehlt dem Buch ein Warnhinweis: Dies ist keine durchgeschriebene Geschichte der deutschen Auseinandersetzung mit dem Altertum. Über Schillers Balladen, Schliemanns Entdeckungen oder Christa Wolfs „Kassandra“ erfährt man nichts.
Es handelt sich vielmehr um eine Zusammenstellung biografischer und wissenschaftshistorischer Einzelstudien, zum Teil sind es überarbeitete Handbuchartikel über die Entstehung von Handbüchern. Das ist fast, als sollte der Siegeszug des Historismus auch noch einmal in der Form des Buches ausgedrückt werden: eine sinnstiftende Synthese ist nicht mehr möglich.
Trotzdem lohnt sich die Lektüre, und trotzdem endet Stefan Rebenich mit der Hoffnung, die Erforschung der alten Kulturen sei heute „notwendige Grundlage einer demokratischen Gesellschaft“. Ob das ganz ohne Begeisterung geht, sei dahingestellt. Aber tröstlich für alle, die den Untergang des Abendlandes fürchten, klingt dann doch der schönste Satz dieses Buches: „Wir haben gelernt, den Abstand zur Vergangenheit nicht aufzuheben, sondern auszufüllen.
“
JOHAN SCHLOEMANN
Bis zur Zeit der Weltkriege waren
die Altphilologen die am meisten
geachteten Lehrer der Nation
Stefan Rebenich:
Die Deutschen und ihre Antike. Eine wechselvolle Beziehung.
Klett-Cotta, Stuttgart 2021. 494 Seiten, 38 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»Der deutschen Altertumswissenschaft galt die Antike als Leitbild des edlen Menschseins. Sie selbst war nicht nur von Idealismus geprägt, sondern auch von Duckmäusertum, Zank und Streit. Stefan Rebenich erzählt diese Wissenschaftsgeschichte auf hohem Niveau.« Deutschlandfunk Kultur, Arno Orzessek, 8. Januar 2022 Arno Orzessek Deutschlandfunk 20220108