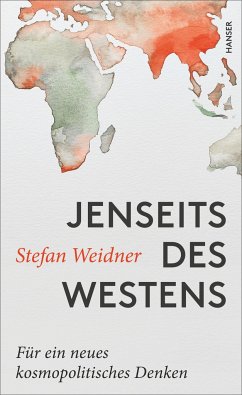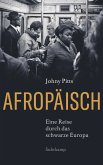Wir waren es gewohnt, dass Europa und Nordamerika die Welt dominieren. In Zeiten der Globalisierung melden nun andere Großmächte politische und wirtschaftliche Ansprüche an und stellen die "westliche" Weltdeutung in Frage. Fortschritt, Säkularisierung, Liberalismus: Warum sollten diese Prinzipien unserer Ideengeschichte für den ganzen Globus gelten? Stefan Weidner ist ein Anhänger der Aufklärung. Gerade deshalb plädiert er dafür, Weltentwürfe aus Arabien, Afrika oder China ernst zu nehmen. Der "Westen" darf nicht glauben, die ganze Welt werde früher oder später seine Vorstellungen übernehmen. Wir brauchen ein kosmopolitisches Denken, das die Vorstellung kultureller Überlegenheit überwindet.

Unseren Werten bekommt das Überlegenheitsbewusstsein nicht gut, das uns vom Rest der Welt trennt: Stefan Weidner plädiert für ein neues kosmopolitisches Denken
Vom globalen "Wettbewerb der Narrative" spricht ja jetzt sogar schon der Koalitionsvertrag. Ganz offiziell wird da als Aufgabe des deutschen Staats, insbesondere seiner Kulturpolitik, definiert, der "Erzählung" des Westens von sich selbst dabei zu helfen, sich in der Konkurrenz mit den Erzählungen Russlands, Chinas und des Islamismus besser zu behaupten. Jeder weiß, dass die Lage ernster geworden ist. Insofern stutzt man bei dem Buchtitel "Jenseits des Westens" und zumal der autobiographischen Einführung mit einer Erinnerung an die achtziger Jahre, als der Autor als Heranwachsender in seinem bürgerlichen Kölner Milieu sein Verlangen nach dem Anderen, dem Fremden entdeckte und in Marrakesch zum ersten Mal stillte. Sind solche in der damaligen BRD blühenden Differenzgelüste heute wirklich noch das Thema? Sind sie angesichts der realen Bedrohungen und der Notwendigkeit, westlichen Werten in der Welt - und im eigenen Land - zur Geltung zu verhelfen, nicht hoffnungslos anachronistisch und luxuriös geworden?
Doch beim Weiterlesen merkt man, dass es dem Autor nicht um einen mehr oder weniger folkloristischen und folgenlosen Exotismus geht, sondern um etwas viel Provokativeres. Ganz im Gegensatz zum gängigen Imperativ, das westliche Narrativ zu stärken, fordert er, es im Interesse eines künftigen Zusammenlebens auf dem Planeten "abzuwickeln". Was ist damit gemeint?
Stefan Weidner ist Islamwissenschaftler und vielfach ausgezeichneter Übersetzer arabischer Lyrik, viele Jahre war er Chefredakteur der vom Goethe-Institut auf Englisch, Arabisch und Persisch herausgegebenen Kulturzeitschrift "Art & Thought / Fikrun wa Fann". Der autobiographische Einstieg in sein Buch erweist sich insofern als wichtig, als er die später entfaltete programmatische Außenperspektive durch eine frühe persönliche Erfahrung beglaubigt. Schon der Sechzehnjährige macht auf seiner ersten großen Reise nach Marrakesch, wo sich im Taxi einander völlig unbekannte Menschen wie engste Freunde unterhalten, eine ihn verblüffende Entdeckung: "Die Fremde ent-fremdete mich, machte, dass ich mich weniger fremd fühlte - zuerst mir selbst gegenüber, dann im Verhältnis zu meiner Umwelt." Unausgesprochen steht über dem Rest des Buchs daher die Frage: Könnte eine solche Ent-Fremdung vielleicht auch den Westen als Ganzes weniger fremd in der Welt machen?
Was Weidner als "Ideologie des Westens" kritisiert, ist durch das Gegenteil gekennzeichnet: nämlich durch Abschottung und Selbstimmunisierung gegenüber dem Rest der Welt. Der Umstand, dass der Westen seine Werte mit seinem Herrschaftsbereich identifiziert, hat eine paradoxe Folge: Ausgerechnet seinen Universalismus, der unter Menschen und Kulturen keine Unterschiede zu machen beansprucht, hält der Westen für das, was ihn von anderen unterscheidet. Die Selbstisolation hat eine geschichtsphilosophische und eine kulturessenzialistische Seite; für die eine ruft der Autor Francis Fukuyama, für die andere Samuel Huntington als Kronzeugen auf. Die Argumentationslücken beider Theoretiker wurden zwar schon in den neunziger Jahren ausführlich benannt, aber trotzdem würden ihre Prämissen nach wie vor weithin geteilt: sowohl das Überlegenheitsbewusstsein eines im Grundsatz unüberbietbaren Systems als auch die Gegenüberstellung des Westens zu allen übrigen Kulturen, die nach biologistischen Mustern als mehr oder minder feststehende Wesenheiten verstanden werden. Eine solche Ideologie stelle "die Wirklichkeit, die sie bestätigt, selbst" her und sperre sich gegen die Wahrnehmung anderer kultureller Narrative in ihrer Geltung.
Zum Beispiel des islamischen Rechts. Weidner schreibt, die Binnenlogik dieses Rechts halte sich eine striktere Gewaltenteilung als im westlichen Rechtsstaat zugute, weil das religiös begründete Gesetz dem Einfluss einer Regierung völlig entzogen sei; nur die Jurisdiktion der Rechtsgelehrten bestimme über die Anwendung der alten Überlieferungen auf gegenwärtige Verhältnisse. Weidner führt den heutigen Islamismus darauf zurück, dass der im Zuge des Kolonialismus oktroyierte und nicht selten von despotischen Regimen kontrollierte moderne Staat von vielen Muslimen als Entrechtung empfunden wurde. Das nicht-staatliche, transzendente islamische Recht erschien ihnen dann als Befreiung.
Weidner betont, dass es ihm nicht um eine "Apologie des Islams" gehe, sondern um den Versuch, aus "den Sackgassen des Denkens" herauszukommen. Das Buch bewegt sich eher auf der Meta-Ebene der Voreinstellungen, Mentalitäten, intellektuellen Kategorien als auf der der konkreten politischen Konflikte. Um die zerstörerische Logik der gegenseitigen Abgrenzung aufzubrechen, schlägt Weidner einen neuen Kosmopolitismus vor, der dem fremden Stoff frischen Sauerstoff zuführt, statt ihn, wie bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Fremden oft üblich, in einer "Quarantänestation für den Geist" zu entsorgen. Als positives Beispiel führt Weidner den vormodernen Eklektizismus an, mit dem China den in Indien entstandenen Buddhismus bei sich einführte; mangels adäquater Übersetzungsmöglichkeiten für die buddhistischen Begriffe entstand damals etwas Drittes zwischen den Kulturen.
Jede Kultur müsse notgedrungen von Narrativen ausgehen, doch es gelte, nicht bei ihnen stehen zu bleiben, sondern sie zu überschreiten. Die Errungenschaften der Aufklärung dürften nicht verworfen werden, doch den von ihnen ausgehenden Hegemonialanspruch gelte es zu überwinden. Wenn einmal der "Riss im Narrativ" erkannt sei, könne er alle Überlegenheitsdiskurse entmachten und die Menschen auf neue Weise miteinander verbinden. Als Vorbild empfiehlt Weidner Gandhi, der die Askese, den Verzicht auf "Identität" und auftrumpfendes Handeln zu einem Mittel der Politik gemacht habe. Auf diese Weise habe Gandhi gegen ein System Widerstand leisten können, das die Freiheit politisch und ontologisch beschneidet, "indem es ableugnet, dass es einen (relevanten!) Bereich jenseits der Politik, jenseits der Welt der Erscheinungen gibt".
Der Fluchtpunkt, auf den die Polyzentrik in diesem Buch hinausläuft, ist das "Recht auf Rechte", in dem Hannah Ahrendt den letzten Baustein jeglichen Rechts und jeder Politik sah. Es gilt nämlich auch noch für Staatenlose, denen aber das Recht, zur Menschheit zu gehören, nicht abgesprochen werden kann. Damit verbindet sich für den Autor eine Art hypothetischer Gottesbeweis: Da dieses Recht nicht von der Menschheit selbst garantiert werden könne, müsse ein außerhalb ihrer stehender Gott angenommen werden - denn ein Mensch, der auf sein Recht verzichtet, wenn kein Staat für es eintritt, würde sich selbst aufgeben.
Das unsystematische, assoziativ-mäandernde Verfahren des Buchs (Weidner selbst nennt es den "kuratierten Mitschnitt, Auszug eines unendlich viel größeren Gesprächs") kommt seiner skeptischen, zahlreiche verblüffende Ideenverbindungen zutage fördernden Nachdenklichkeit zugute. Der Nachteil ist, dass einige argumentative Leerstellen dadurch übertüncht werden: Es wird keine Vorstellung entwickelt, wie sich der romantische Kosmopolitismus der um ihren Herrschaftsanspruch gebrachten Narrative in eine globale oder auch nur nationale Ordnungspolitik übersetzen soll - die Kulturen existieren ja schon lange nicht mehr räumlich getrennt voneinander, sondern oft innerhalb ein und desselben Staats.
Der liberale Rechtsstaat des Westens, der für eine solche Koexistenz weit besser gerüstet sein dürfte als jede partikulare Rechtskultur, hätte schon unter diesem Gesichtspunkt eine genauere inhaltliche Würdigung verdient. Dennoch ist dieser Gedankenversuch nicht bloß eine anregende Spekulation, sondern die sehr ernste Erinnerung daran, dass es Menschlichkeit jenseits der westlichen Prinzipien gibt. Und wie gefährlich es sein kann, sie zu verachten.
MARK SIEMONS
Stefan Weidner: "Jenseits des Westens. Für ein neues kosmopolitisches Denken". Hanser, 368 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In seinem Buch „Jenseits des Westens“ sucht Stefan Weidner nach Auswegen aus
dem konfrontativen Kulturnarzissmus europäischer Machart
VON ALEX RÜHLE
Entfremdung“ ist ein mehrfach negativ konnotiertes Wort. Zum einen umreißt es das defizitäre Lebensgefühl des modernen Menschen, der sinnlos und schal vor sich hinmurkelt in hyperkomplexen Zusammenhängen. Zugleich ist es ein Wort, das für Paare oft das Todesurteil bedeutet – aus der großen Nähe und dem Wunsch nach Verschmelzung resultieren am Ende Beziehungsödnis und Entfremdung.
Was aber, wenn man die Entfremdung mal ganz anders versteht, nämlich so wie Stefan Weidner am Anfang seines großen Versuchs über ein neues kosmopolitisches Denken: als Ende oder momentane Aufhebung der grundlegenden Fremdheitsgefühle. Weidner erinnert sich an seine erste Fernreise, als Jugendlicher, allein nach Marokko. Im Marrakesch der frühen Achtzigerjahre wird er überwältigt von der Herzlichkeit der Bewohner und davon, in was für leidenschaftliche Gespräche sich da völlig fremde Menschen miteinander stürzen. „Die Fremde ent-fremdete mich, machte, dass ich mich weniger fremd fühlte – zuerst mir selbst gegenüber, dann im Verhältnis zu meiner Umwelt. Auch wenn oder weil ich nur ein Gast war, fühlte ich mich zu Hause.“ In der größten Fremde also fühlte Weidner damals ein intensiveres Gefühl von Geborgenheit, Angekommensein als im heimatlichen Köln.
Im Grunde umreißt diese Anekdote aus einem marokkanischen Taxi empirisch das, was Weidner auf den kommenden
300 Seiten theoretisch versucht: Wie könnte man in der Welt heimisch werden, ohne einerseits in die Falle der Identitätspolitik zu laufen, ohne aber auch einem postmodern beliebigen Nomadentum des besserverdienenden Vielfliegers das Wort zu reden, dem angeblich die ganze Welt zu Füßen liegt, jetzt wo der Westen allen anderen Kulturen seine universalistische Matrix aufgedrückt hat? Hinter diesem Versuch, Fremdheit und Heimat in eine neue dialektische Beziehung zueinander zu setzen, liegt aber der noch viel wichtigere Versuch, den eben erwähnten universalistischen, kosmopolitischen Anspruch des Westens als selbstherrlichen Narzissmus und Lebenslüge einer ganzen Weltgegend zu dekonstruieren.
Der Westen, so Weidners Kernthese, definiert sich in herabsetzender Abgrenzung vom Rest der Welt. Entweder geschichtsphilosophisch als Endpunkt der Menschheitsgeschichte (Francis Fukuyama) und damit als System, dem sich alle anderen schon anschließen werden, wenn sie seine Überlegenheit nur erst anerkennen. Oder aber in aggressiv-identitärer Abgrenzung, so wie Samuel Huntington es auf fast schon biologistische Art und Weise durchexerziert hat: Es gibt unterschiedliche Kulturen, die miteinander unvereinbar sind, und die sich heute, da der Westen das kulturell, wirtschaftlich und in Sachen Demokratie vorbildliche System ist, nur in scharfer Abgrenzung davon definieren können. Beiden Theorien, der geschichtsphilosophischen wie der kulturessenzialistischen, ist das Fremde immer sowohl das per se Unterlegene als auch das Gefährliche, Andere. Etwas, das ausgeschlossen, besiegt oder kulturell eingemeindet werden muss. Was in Weidners Augen nur eine späte Konsequenz aus der Reaktion der Aufklärung auf Gottes Tod ist.
Weidner erzählt die Geschichte der Moderne über den Begriff der nachmetaphysischen Entfremdungserfahrung. Der Mensch fühlte sich immer fremd in der Welt, hatte aber lange den Trost der Hoffnung auf ein endgültiges Geborgensein im Jenseits der Religionen. Dieser Weg ist uns seit der Säkularisierung versperrt, der Himmel ist leer. Weshalb der moderne Mensch das Heilsversprechen aufs Diesseits verlagerte und auf unterschiedliche und miteinander konkurrierende Arten und Weisen versucht hat, sich nicht mit der Fremdheit zu versöhnen, sondern diese aufzuheben, zu beseitigen.
Im Grunde, so Weidner, laufen all diese Versuche auf drei Paradigmen des Umgangs mit dem Fremdheitsproblem heraus: Im Entwicklungsparadigma versucht der Mensch, sich auf eine bessere Zukunft hin zu entwerfen. Der politische, technische, soziale, digitale Fortschritt wird’s schon richten, wir müssen nur die Welt noch weiter nach unseren Bedürfnissen umbauen, dann wird das schon. Dem Eigentlichkeitsparadigma zufolge muss hingegen nicht die unzureichende Welt durch Technik oder Politik verändert werden, vielmehr ist die Heimat immer schon vollkommen, es stören nur entweder die Fremden oder die technische Zivilisation. Beiden Paradigmen liegt eine große „Entfremdungsintoleranz“ zugrunde.
Das dritte Paradigma des Umgangs mit unserer Fremdheit in der Welt ist das existenzialistische. Es versucht, die Fremdheit, das Geworfensein, die Unbehaustheit als Grundbedingung zu akzeptieren und aus ihr heraus eine Lebenshaltung zu finden. Dieses Leben muss aber mit einer Grundstimmung der Tragik und einer Skepsis allen Verheißungen gegenüber klarkommen. Weshalb Weidner sich fragt, ob diese Haltung „eine brauchbare Vision, eine empfehlenswerte Haltung darstellt“. Ihm selbst scheint die viel freundlichere, menschengerechtere Lösung eine „transzendente Instanz“. Er setzt also dem versteckten quasi religiösen Versprechen der Aufklärung die Religion selbst entgegen. Allerdings nicht als Dogma, sondern als eine aufgeklärte Leerstelle, eine hypothetische Position außerhalb der Menschheit, ähnlich Gandhis Gottesbegriff der „Wahrheit“.
Weidner, geboren 1967, ist einer der großen Kultur- und Sprachübersetzer unserer Tage, er hat als Arabist und Islamwissenschaftler arabische Lyrik ins Deutsche gebracht, als langjähriger Chefredakteur der vom Goethe-Institut auf Englisch, Arabisch und Persisch herausgegebenen Zeitschrift Art&Thought / Fikrun wa Fann permanent den Dialog zwischen den Kulturen gepflegt und erklärt als Publizist immer wieder auch auf unseren Feuilletonseiten den Nahen Osten, der uns oftmals so fern erscheint. Weidner ist also kein Philosoph, sondern ein Kulturvermittler. Das ist Schwäche und Stärke des Buchs zugleich. Er kann nicht wirklich stringent erklären, wie der westliche Mensch nach 250 Jahren Aufklärung und Säkularisierung nun zurückfinden soll in ein spirituell-religiöses Grundempfinden, das weder im Dogma der herkömmlichen Religionen erstarrt noch sektiererischem Aberglauben anheimfällt. Zwar findet er mehrfach überraschende Anschlüsse für seine Forderung nach dieser „maßstabsetzenden Instanz“. Der wichtigste dürfte die Engführung mit Hannah Arendts Satz vom „Recht auf Rechte“ sein, dem Recht jedes Menschen, innerhalb eines Rechtssystems zu leben. Dieses Meta-Recht auf Rechte ist eine höhere Instanz, die es überhaupt erst ermöglicht, unterschiedliche Rechtssysteme zu akzeptieren. Und das Recht wird, um mit Bernhard Schlink zu sprechen, zur wahren Heimat des Menschen. Ob es dafür aber wirklich Transzendenz braucht? Und wenn ja, ist die am Ende mehr als eine Art Grundmilde der Welt gegenüber aus der Einsicht in die Vorläufigkeit aller Narrative heraus?
In seinem Nachwort schreibt Weidner, es wäre töricht, in einem Buch wie diesem, in das so viele Texte eingegangen seien, von „einem Autor“ zu sprechen, das Ganze sei „wenig mehr als ein kuratierter Mitschnitt, Auszug eines unendlich viel größeren Gesprächs“. Das ganze Buch will sich also von vornherein eher als synkretistische Zusammenschau, thetisches Weltensammleralbum, vehementen Einspruch für eine Vielzahl gleichberechtigter, immer nur vorläufiger Narrative anstelle des westlichen Kosmopolitismus.
Das bedeutet nicht, dass er die Aufklärung einfach über Bord wirft, er will nur die mit ihr einhergehende Überlegenheitsanmaßung überwinden, den immergleichen Fehler, „für sich selbst die Wahrheit zu beanspruchen und risslose, entfremdungsintolerante und Geschlossenheit beanspruchende Narrative in die Welt zu setzen“. Großartig, wie er etwa Hegels Lektüre der indischen Denker dekonstruiert – der große Autor der „Phänomenologie“ schrumpft hier zum gehässigen Blockwart, der sich von Anfang an zum Ziel gesetzt hat, diese verdammten Inder nicht in seinen Gedankenpalast zu lassen. Also macht er einen Popanz aus ihnen, zeigt dann drauf und sagt, seht her, die Bhagavad Gita, ein Popanz.
Wenn das Lesen selbst als Teil des von Weidner im Nachwort erwähnten großen Gesprächs gedeutet werden darf, dann kann man hier sagen: lange nicht so gut unterhalten. Und schon lange nicht mehr mit einer ähnlich langen Leseliste aus einem Text wieder aufgetaucht. Unbedingt Arendt lesen. Und erst recht die Bhagavad Gita.
Stefan Weidner: Jenseits des Westens. Für ein neues kosmopolitisches Denken. Hanser Verlag, München 2018. 368 Seiten, 24 Euro.
Wie kann man in der Fremde
heimisch werden, ohne einfach
nur ein Vielflieger zu sein?
Braucht man noch Transzendenz,
wenn das Recht die wahre
Heimat der Menschen ist?
Indien, 2018: Gläubige am Fuß einer Statue des Gottes Gomateshwara. Stefan Weidner erhofft für die Globalisierung eine neue „transzendente Instanz“.
Foto: DPA
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Rezensent Mark Siemons bescheinigt dem Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer Stefan Weidner nach der Lektüre seines Plädoyers "Für ein neues kosmopolitisches Denken" einen scharfen analytischen Blick: Weidner arbeite heraus, dass das Narrativ des Westens gerade dann zur Ideologie gerate, wo es seinen Anspruch, zwischen Menschen und Kulturen keine Unterschiede zu machen, als Alleinstellungsmerkmal ausgibt. Darum spricht Weidner sich nach Siemons dafür aus, kulturelle Narrative zwar nicht zu revidieren, aber sie zu überschreiten, ihren Hegemonialanspruch zu überwinden. Wie der so entstehende neue Kosmopolitismus dann allerdings konkret politisch umgesetzt werden solle, scheint Siemons Weidners "assoziativ-mäandernder" Argumentation nicht entnehmen zu können. Das unsystematische Vorgehen des Autors komme dennoch eindeutig seiner Reflexionstiefe zugute, versichert Siemons.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Weidner ist einer der großen Kultur- und Sprachübersetzer unserer Tage [...] Wenn das Lesen selbst als Teil des von Weidner im Nachwort erwähnten großen Gesprächs gedeutet werden darf, dann kann man hier sagen: lange nicht so gut unterhalten. Und schon lange nicht mehr mit einer ähnlich langen Leseliste aus einem Text wieder aufgetaucht." Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, 18.05.18
"Ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel auf unsere Welt." Joachim Gärtner, ARD Titel,Thesen,Temperamente, 29.04.18
"Dieser Gedankenversuch ist nicht bloß eine anregende Spekulation, sondern die sehr ernste Erinnerung daran, dass es Menschlichkeit jenseits der westlichen Prinzipien gibt. Und wie gefährlich es sein kann, sie zu verachten." Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 11.03.18
"Pure, ansteckende Freude am Denken prägt dieses Werk mindestens so stark wie sein ernstes politisches und philosophisches Anliegen, einen überfälligen, ja überlebensnotwendigen Perspektivwechsel vorzunehmen." Rolf-Bernhard Essig, Nürnberger Nachrichten, 05.09.18
"Ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel auf unsere Welt." Joachim Gärtner, ARD Titel,Thesen,Temperamente, 29.04.18
"Dieser Gedankenversuch ist nicht bloß eine anregende Spekulation, sondern die sehr ernste Erinnerung daran, dass es Menschlichkeit jenseits der westlichen Prinzipien gibt. Und wie gefährlich es sein kann, sie zu verachten." Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 11.03.18
"Pure, ansteckende Freude am Denken prägt dieses Werk mindestens so stark wie sein ernstes politisches und philosophisches Anliegen, einen überfälligen, ja überlebensnotwendigen Perspektivwechsel vorzunehmen." Rolf-Bernhard Essig, Nürnberger Nachrichten, 05.09.18