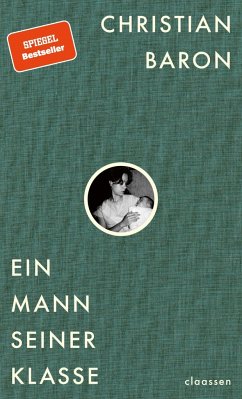»Mochte mein Vater auch manchmal unser letztes Geld in irgendeiner Spelunke versoffen, mochte er auch mehrmals meine Mutter blutig geprügelt haben: Ich wollte immer, dass er bleibt. Aber anders.«
Kaiserslautern in den neunziger Jahren: Christian Baron erzählt die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden Vaters und seiner depressiven Mutter. Er beschreibt, was es bedeutet, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Wie es sich anfühlt, als kleiner Junge männliche Gewalt zu erfahren. Was es heißt, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden. Was von all den Erinnerungen bleibt. Und wie es ihm gelang, seinen eigenen Weg zu finden.
Mit großer erzählerischer Kraft und Intensität zeigt Christian Baron Menschen in sozialer Schieflage und Perspektivlosigkeit. Ihre Lebensrealität findet in der Politik, in den Medien und in der Literatur kaum Gehör. Ein Mann seiner Klasse erklärt nichts und offenbart doch so vieles von dem, was in unserer Gesellschaft im Argen liegt. Christian Baron zu lesen ist schockierend, bereichernd und wichtig.
Kaiserslautern in den neunziger Jahren: Christian Baron erzählt die Geschichte seiner Kindheit, seines prügelnden Vaters und seiner depressiven Mutter. Er beschreibt, was es bedeutet, in diesem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Wie es sich anfühlt, als kleiner Junge männliche Gewalt zu erfahren. Was es heißt, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden. Was von all den Erinnerungen bleibt. Und wie es ihm gelang, seinen eigenen Weg zu finden.
Mit großer erzählerischer Kraft und Intensität zeigt Christian Baron Menschen in sozialer Schieflage und Perspektivlosigkeit. Ihre Lebensrealität findet in der Politik, in den Medien und in der Literatur kaum Gehör. Ein Mann seiner Klasse erklärt nichts und offenbart doch so vieles von dem, was in unserer Gesellschaft im Argen liegt. Christian Baron zu lesen ist schockierend, bereichernd und wichtig.

Jeder Tag ein mündliches Examen: Zwei Bücher über Männer, die sich gegen die
Geschichte ihrer Väter stemmen und auf unterschiedliche Weise scheitern
VON FELIX STEPHAN
Vor Kurzem ist in der Zeitschrift Sinn und Form ein Interview mit dem Lyriker Durs Grünbein erschienen, in dem dieser ausführlich über Paul Celan spricht. Celans Menschenbild, sagt Grünbein dort, sei nach dem Holocaust „bis in den tiefsten Kern erschüttert“. Der „Mensch als solcher“ sei dem Dichter suspekt geworden, und er habe niemandem mehr trauen können, „weil die Geschichte sich je nach Geburtsort in ihn eingeschrieben und jeder die historische Erblast seines Stammes in sich trägt“. Das Phänomen beschränkt sich nicht auf Deutschland, aber eine Steigerung dieses Problems, so sieht es derzeit jedenfalls aus, ist die deutsche Variante doch. Mit Bov Bjergs „Serpentinen“ und Christian Barons Buch „Ein Mann seiner Klasse“ sind in dieser Woche gleich zwei Bücher erschienen, die genau dieses Thema verhandeln. In beiden Erzählungen geht es um erwachsene Männer im heutigen Deutschland, die sich gegen die Geschichte ihrer Väter stemmen und auf jeweils unterschiedliche Weise scheitern.
Bei Bov Bjerg bildet eine Reise den Erzählrahmen. Der Ich-Erzähler unternimmt mit seinem Sohn einen Ausflug nach Süddeutschland, um ihm zu zeigen, wo er selbst aufgewachsen ist. Er entstammt einer Familie von Vertriebenen, auch nach Kriegsende ist sein Vater überzeugter Nationalsozialist geblieben. Die zentralen Erinnerungen an seine Herkunftswelt sind hassgetränkter Provinzialismus, Alkoholismus und Depression. Sowohl der Vater des Ich-Erzählers als auch dessen Vater haben sich umgebracht, und jetzt fürchtet er, dass er diese unheilvolle Tradition, diesen Familienfluch an seinen eigenen Sohn weitergeben wird.
Der Versuch, die Gewalt, die Todessehnsucht, die Depression, die Schuld aus sich selbst zu entfernen, steigert sich zur Obsession, deshalb erblickt er sie wie ein Hypochonder überall. Ständig erwischen ihn die Erinnerungen aufs Neue, ständig hört er seinen Vater, seine verhasste Herkunftswelt durch sich selbst zu seinem Sohn sprechen. Der Stress, der sich aus dem selbstauferlegten Verbot ergibt, auch nur das Geringste von dem weiterzugeben, was ihn selbst geformt hat, ist im Begriff, ihn um den Verstand zu bringen. Als ihm dämmert, dass er nicht aus seiner Haut kann und er selbst weiterträgt, was ihm den größten Schrecken einjagt, sieht er den einzigen Ausweg in einer Paradoxie: Wollte er absolut sichergehen, dass er die väterliche Linie unterbricht, müsste er sich umbringen und damit den Fluch doch wieder erfüllen.
Auf der Handlungsebene passiert relativ wenig in diesem Roman, die Spannung entsteht aus dem Zwiegespräch des Erzählers mit seinen Dämonen, seiner zwanghaften Selbstdisziplinierung, seiner panischen Selbstamputation. Immer wenn sich die äußere Wirklichkeit in dieses Gespräch einschaltet, nährt sie nur die innere Raserei. An einer Stelle fällt der Mutter des Erzählers auf, dass er denselben Rücken hat wie sein Vater, und reflexartig durchfährt den Erzähler dieser Gedanke: „Das rassische Erscheinungsbild war wichtig, wenn jemand zur SS wollte.“ Jedes Ereignis, jeder äußere Eindruck wird eingeordnet in die Muster der eigenen Obsession, die Paranoia wird zum Prisma der Weltwahrnehmung. Auf der letzten Seite, das überrascht dann wirklich nicht mehr, dankt der Autor einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie „für den fachlichen Rat“.
Für das zirkuläre, repetitive Denken des Ich-Erzählers hat Bov Bjerg ein komplementäres Erzählverfahren gefunden. Der Rhythmus des Romans ist atemlos. Eine Handvoll wiederkehrender Motive bildet den Takt der Erzählung. Wie die Trommeln in einem Iñárritu-Film prügeln sie den Text voran: die marmorierten Fliesen der Kindheit, eine Kindheitserinnerung am Küchentisch, die TV-Dokus über Schwertransporte, die spielerische Frage des Sohnes an den Vater: „Um was geht es?“ Ein deutsches Leben in vier wiederkehrenden Bildern. Kompositorisch ist die Sache so rund, dass man ihr eine gewisse Kunsthandwerklichkeit vorwerfen könnte, wenn das nicht auf den stets ungerechten Vorwurf hinauslaufen würde, der Text sei zu gut. Die lückenlose motivische Modellierung reicht bis in den Titel. Die „Serpentinen“ sind nicht nur die Straßen, auf denen Vater und Sohn unterwegs sind, sondern auch die vorgefertigten Bahnen, auf denen sich ihr Bewusstsein bewegt. An jedem Autobahnkreuz sieht der Erzähler ein KZ.
Bei Christian Baron verhält es sich ein wenig anders und womöglich interessanter. Sein Buch ist ausdrücklich kein Roman, sondern eine Art Collage aus Bericht, Autobiografie, Reportage und Porträt seines bettelarmen, alkoholsüchtigen, gewalttätigen Vaters. Baron erzählt, wie er in den Neunzigerjahren, lange vor den Hartz-IV-Reformen und mitten in Westdeutschland, in einer subproletarischen Familie in Kaiserslautern-Ost aufgewachsen ist, wo es außer der Stammkneipe des Vaters „nur Häuser, einen Baumarkt, einen McDonald’s und Autohäuser gab – und Straße, sehr viel Straße.“
Die Ausgangsbehauptung des Buches lautet, dass der Erzähler sein Herkunftsmilieu hinter sich gelassen hat und nach dem Universitätsstudium zurückschaut auf seine Kindheit. Die Konstellation ähnelt Didier Eribons Buch „Rückkehr nach Reims“, weshalb das Buch allenthalben als Referenz herhalten muss, obwohl die Bücher sonst wenig gemein haben. Eribon schaute auf seinen Stoff mit dem geschulten, verfeinerten Blick des Pariser Soziologen und Foucault-Biografen, formbewusst verschränkte er politische Analyse und soziale Autobiografie. Christian Barons Buch lebt eher von der linkischen, etwas unbeholfenen Erzählweise. An einer Stelle heißt es etwa: „Ein Erinnerungssturm überfiel meine Gedanken.“ Zigaretten werden „gequalmt“, das Hochzeitsfest der Eltern ist eine „Fete“. Die Namen der Figuren stammen noch sichtlich aus der Binnenperspektive: Opa Willy, Onkel Ralf, Mama und Papa.
Die Prosa liest sich über weite Strecken wie die Zeugenaussage eines traumatisierten Kindes, das sich alle Mühe gibt, einer imaginären Jury gegenüber die Vorkommnisse aus Kaiserslautern wiederzugeben, dabei aber gleichzeitig allen Beteiligten gerecht zu werden und niemanden zu denunzieren. Mit gepresster Stimme erzählt er eins nach dem anderen: „Mein Vater zog einen Turnschuh aus und schlug mit der Sohle voran im Hiebestaumel auf Mama ein, bestimmt vier oder fünf Mal, ehe er eine Pause einlegte, schnaufend die an der verschlissenen Raufasertapete hängenden Bilderrahmen mit Familienfotos betrachtete und mich anblaffte, ich solle den Lärm leiser machen.“ Der Lärm kommt in dieser Szene aus dem Disney-Trickfilm „Cinderella“, den die Kinder gerade sehen.
Die Gewalt ist unerträglich, gleichzeitig kennt die Sehnsucht nach der väterlichen Liebe keine Grenzen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Stimme des Erzählers. Er versucht, umfassend Bericht zu erstatten und nichts auszulassen, was der Wahrheitsfindung dienlich sein könnte, wirbt aber gleichzeitig um Verständnis für seine Eltern, die ihrerseits Opfer gesellschaftlicher Umstände sind. Wer glaubt, er wäre unter ihren Lebensbedingungen – den ständigen Erniedrigungen, der Scham, der Enge, dem Hunger – ein geduldiger, inspirierender Erziehungsberechtigter, der werfe den ersten Stein.
Die spürbare Anstrengung, sich „literarisch“ auszudrücken, um die Geschichten aus Kaiserslautern-Ost in die Sprache der bürgerlichen Öffentlichkeit zu übersetzen, macht die Erzählung gerade deshalb so stark, weil sie die Grundbehauptung des Erzählers, er habe dieses Milieu anhand von Bildung hinter sich gelassen, unterläuft. Der Text widerspricht seinem Autor: Man wird seine Herkunft eben doch nie ganz los. Ralf Rothmann, der von ähnlichen Verhältnissen im Ruhrgebiet erzählte, hatte die verstümmelte Sprache seines Herkunftsmilieus vollkommen abgelegt, bei ihm kam sie nur noch in der Figurenrede vor. Und auch Didier Eribon hatte sich erst zurück nach Reims gewagt, als er sämtliche sprachlichen und habituellen Merkmale, die ihn mit dem Milieu seiner Familie noch in Verbindung hätten bringen können, sorgsam getilgt hatte.
Während Eribon aus der mondänen, gebildeten Welt zurück in die Unterschicht geschaut hat, schaut Christian Baron noch immer aus ihr heraus. Sie spricht durch ihn zu uns. Die soziale Funktion der Sprache spielt in beiden Büchern eine zentrale Rolle: Bei Bjerg hat sich der Erzähler den Dialekt seines Herkunftsmilieus rabiat abtrainiert, bei Baron widerlegt der Soziolekt den Mythos, man könne seine Klasse hinter sich lassen.
Wenn man Barons Buch unbedingt vergleichen möchte, dann am ehesten mit Eribons Schüler Édouard Louis, der ebenfalls in depravierten, gewalttätigen Verhältnissen aufgewachsen ist, wegen seiner Homosexualität regelmäßig zusammengeschlagen und misshandelt wurde, sich schließlich auf die bessere Schule rettete und dessen Romane heute in aller Welt gelesen werden. Kurz vor Schluss fragt Baron: „Wer oder was hat meinen Vater umgebracht?“, als würde er direkt den Titel von Louis’ jüngstem Buch zitieren: „Qui a tué mon père?“ Auch Bov Bjerg spielt an einer Stelle auf Édouard Louis an, als sich zwei Figuren über dessen Debütroman unterhalten.
Auch das haben die Ich-Erzähler der Bücher miteinander gemein: Sie sind ihren Herkunftsmilieus entkommen, weil sie es auf die Universität geschafft haben und akademische Berufe ergreifen konnten. Bov Bjergs Erzähler ist Soziologe, Christian Baron Redakteur bei der Berliner Wochenzeitung Der Freitag. Und beide kommen mit den inneren und äußeren Konflikten, die diese soziale Umpflanzung mit sich bringt, schlecht zurecht.
Baron wird von seiner Familie regelmäßig der Mund verboten, weil er als Studierter von ihrem Leben nichts verstehe. Bjergs Erzähler wird von einer Klassenscham geplagt, die in beide Richtungen wirkt, nach oben und nach unten. Gegenüber seiner Familie fühlt er sich minderwertig, denn: „Ich hatte nie gearbeitet, immer nur gelesen, geschrieben, gedacht, gelabert.“ Und seinen exaltiertesten Nervenzusammenbruch hat er auf einer Gartenparty im wohlhabenden Südwesten Berlins, zu der ihn seine Frau mitgenommen hat, eine hoch bezahlte Anwältin. Milieuwechsel bedeuten Stress. Den Umgang mit den Fachkollegen erlebt Bjergs Erzähler so: „Jede Begegnung, die nicht strikt fachbezogen war, geriet zu einem mündlichen Examen. Was der Gegenstand der Prüfung war, erriet ich bis zum Schluss nicht.“
Auch dies ein Paradox: Obwohl sich die sozialdemokratische Aufstiegshoffnung in beiden Fällen bestens erfüllt hat, herrscht doch ein Gefühl der Ausgrenzung. In einem Essay im Harper’s Magazine aus dem Jahr 1941 hat die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson dieses Verhältnis für den Aufstieg des Nazismus verantwortlich gemacht. Sie porträtiert dort einen Bildungsaufsteiger, der zum Menschenfeind wird, weil er nirgendwo mehr wirklich zu Hause ist. Dieser Aufsteiger, schreibt Thompson, sei „das Produkt einer Demokratie, die heuchlerisch soziale Gleichheit predigt und achtlos einen brutalen Snobismus praktiziert“.
Bov Bjerg: Serpentinen. Roman. Claassen, Berlin 2020. 272 Seiten, 22 Euro.
Christian Baron: Ein Mann seiner Klasse. Claassen, Berlin 2020. 288 Seiten, 20 Euro.
Der Text widerspricht seinem
Autor: Ganz wird man die
Herkunft eben doch nie los
„Ich hatte nie gearbeitet,
immer nur gelesen, geschrieben,
gedacht, gelabert.“
Christian Baron (links) und Bov Bjerg sind ihren Herkunftsmilieus entkommen und erzählen vom damit verbundenen Stress.
Fotos: Hans Scherhaufer; Gerald von Foris
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Ijoma Mangold verortet Christian Barons autobiografischen Roman im Kontext der Bücher von Didier Eribon. Berührend findet er die Schilderung einer kaputten Familie aus Kaiserslautern, die unter Armut und dem Alkoholismus des Vaters leidet, weil sie den Schmerz der Kinder transportiert, die den Vater nicht so lieben konnten, sie es wollten. Doch so reizvoll der Stoff für Mangold, so problematisch findet er die Klassifizierung des Vaters und den Versuch des Autors, einen "übergeordneten systemischen Zusammenhang" für das Unglück der Familie verantwortlich zu machen. Darüber hinaus erscheint dem Rezensenten die ausgestellte Sprachlosigkeit des geschilderten Milieus als ästhetische Entscheidung zwar nachvollziehbar, beim Leser jedoch bleibt laut Mangold der Wunsch zu erfahren, was in den Köpfen der Figuren vorgeht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Was wissen wir schon von unserem Land? Viel zu wenig - wie man beim Lesen der besten literarischen Debüts dieser Saison erfahren kann: Drei überraschende, überzeugende, überwältigende Bücher von Paula Irmschler, Cihan Acar und Christian Baron
Die drei interessantesten Literaturdebüts dieses Frühjahrs handeln nicht von universellen und der Zeit enthobenen Gefühlen wie Schmerz, Trauer und Abschied, wie man sie schon hundertmal gelesen hat. Sie verbinden auch nicht noch mal eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem Roadtrip, um mit Wolfgang Herrndorfs berühmtem Roman "Tschick" verglichen werden zu können. Sie erzählen von Deutschland. Genauer gesagt: von der deutschen Provinz. Von Kaiserslautern, Chemnitz und Heilbronn. Sie sind so etwas wie Bestandsaufnahmen jenes Landes, in dem wir leben, aus völlig unterschiedlichen Außenseiterperspektiven. Erzählen von jungen Menschen, die zu etwas dazugehören wollen, aber nicht so genau wissen, zu was oder wie sie es anstellen sollen. Drei Deutschland-Romane, die für unsere Selbstverständigung ein Glücksfall sind: Christian Barons "Ein Mann seiner Klasse", Paula Irmschlers "Superbusen" und Cihan Acars "Hawaii" - weil sie alle drei etwas sagen, was wir so noch nicht gehört haben, und uns auf diese Weise vor Augen führen, wie wenig wir von unserem Land wissen.
Mit "Ein Mann seiner Klasse" fängt das an. Mit der autobiographischen Erzählung einer Kindheit in Kaiserslautern Anfang der neunziger Jahre und darin: einem die Mutter und die Kinder bis zur Besinnungslosigkeit prügelnden und misshandelnden, immerzu sturzbetrunkenen Vater (mal schlägt er mit der flachen Hand, mal mit dem Gürtel, haut den Kopf der Mutter gegen die Wand, tritt ihr in den Babybauch oder isst den vier Kindern vor deren Augen das Essen weg). Und mit einem scheinbaren Widerspruch, der für das Buch entscheidend ist, ja dieses überhaupt erst hervorbringt: "Andere hätten ihre ganze Kindheit über gehofft, er würde verschwinden, dieser trinkende und prügelnde Vater", schreibt Christian Baron auf einer der ersten Seiten: "In meinem Fall war es anders. Mochte er auch gesoffen und geprügelt haben, ich wollte immer, dass er bleibt." Wie kann das sein?
Christian Baron wirft in seinem autofiktionalen Text von heute aus einen Blick zurück. Für die anderen, schreibt er, seien sie "Unterschicht", "Asoziale", "Barackler", "Dummschüler" gewesen. Niemand in seiner Familie sei je über den Hauptschulabschluss hinausgekommen. Niemand außer dem Opa mütterlicherseits hatte eine Berufsausbildung abgeschlossen. Was sich hinter der Tür ihrer Wohnung abspielt, weiß aber tatsächlich keiner von denen, die sie als "Unterschicht" bezeichnen. Denn es gibt - und das ist das Erschütternde dieses mit aller Wucht daherkommenden, ungeheuer eindrucksvollen Buchs - überhaupt niemanden außerhalb der Familie, der in diese Wohnung hineinkommt und damit eine Ahnung von dem haben könnte, was dort vor sich geht.
"Ein Mann seiner Klasse" erzählt deshalb an erster Stelle von einer Isolation - und bricht diese durch das Erzählen nachträglich auf. Einen Kindergarten haben er und sein Bruder nie von innen gesehen, deshalb meiden sie - zu Beginn des Buchs ist er acht Jahre alt - den Kontakt mit anderen Kindern. Natürlich erzählen sie in der Schule auch nichts von dem, was für sie zu Hause innerhalb der unablässig von Rauchschwaden durchsetzten vier Wände (jeder Erwachsene ist hier Kettenraucher, dass der Junge Asthma hat, kümmert nicht) Alltag ist: "Unsere bisherigen Lebensjahre hatten unter Aufsicht der Eltern vor dem Fernseher im Wohnzimmer stattgefunden. Freunde hatten wir keine. Verwandte besuchten wir kaum. Wir lebten wie Einsiedler mitten in der Stadt." Und sie erzählen nichts von dem Hunger, der den Jungen irgendwann dazu treibt, mit seinen viel zu langen Fingernägeln den Schimmel von der Wand zu kratzen und ihn sich in den Mund zu schieben, während sein Bruder ihm fassungslos dabei zuzieht und ihn anfleht, damit aufzuhören, weil man davon bestimmt sterben könne.
Sie bleiben für sich und unter sich - und haben nur einander. Deshalb gibt es, solange die Eltern leben oder da sind (später werden sie zu ihrer Tante ziehen), keinen Ausweg in dieser Kindheit. Einmal schafft die Mutter es, den Vater vor die Tür zu setzen, um ihn am nächsten Tag wieder aufzunehmen, als wäre nichts gewesen. Außerdem gibt es auch diese anderen Momente: mit der Mutter, die eigentlich Dichterin werden wollte und ihm Bücher gibt; oder - da ist sie schon schwer depressiv und krebskrank - mit ihm im Arm Lieblingslieder hört. Und mit dem als muskelbepackter Umzugsmann in seiner Stärke immer auch bewunderten Vater, als der Junge blutspuckend ins Krankenhaus gebracht wird, wo er siebenmal operiert werden muss, von den Ärzten fast schon aufgegeben wird - während der Vater den Platz neben seinem Bett nicht verlässt und ihn auf die Stirn küsst, als er die Augen wieder öffnet: "Mein Vater war da. Er hatte mir das Leben gerettet. Seine sich mit Rasierwasser vermengende Alkoholfahne duftete für mich tausend Mal besser als jeder Teller Spaghetti Bolognese."
Wenn Christian Baron zu Beginn seines Buchs diesen Vater einen "Mann seiner Klasse" nennt, ist das deshalb weniger als Beschreibung zu verstehen, sondern als Geste des Selbstschutzes: "Ein Mann, der kaum eine Wahl hatte, weil er wegen seines gewalttätigen Vaters und einer ihn nicht auffangenden Gesellschaft zu dem werden musste, der er nun einmal war." Denn dieser Vater ist nicht das, was er auslöschen und für immer vergessen will. Er ist das, was und wovon er uns in nüchterner schöner Sprache erzählt, ein Teil von ihm auch jetzt, da er selbst, nach Abitur und Studium (Christian Baron arbeitet als Journalist bei der Wochenzeitung "Der Freitag"), kein Mann dieser Klasse geworden ist. Er wollte weg (was sein Bruder ihm heute noch als Verrat vorwirft).
Und auch die Protagonistinnen in den anderen neuen Deutschland-Romanen wollen weg: Gisela in "Superbusen" und Kemal Arslan in "Hawaii". Wobei wir mit Paula Irmschler, die 1989 in Dresden geboren wurde, 2010 zum Studieren nach Chemnitz zog, als freie Journalistin arbeitete und heute Redakteurin bei der "Titanic"ist, in "Superbusen" von der nüchternen Dramatik Christian Barons in eine besondere und ziemlich betörende Humorzone treten. Gisela will, wie die Autorin, von Dresden nach Chemnitz zur Uni, was in ihrem Umfeld erst einmal niemand versteht, nicht die Mutter, nicht die beste Freundin, die sie auslacht.
"Als Dresdnerin nach Chemnitz zu wollen ist quasi Hochverrat, weil alle Dresden lieben müssen. Genau deswegen hasste ich es", heißt es. Für Chemnitz spricht, dass sie dort Politikwissenschaft ohne NC studieren kann, ansonsten bleibt sie realistisch: "Chemnitz ist die am zweitschlechtesten angebundene Stadt Deutschlands, danach kommt nur noch Trier, stand mal auf so einer Liste im Internet. Dass nach Chemnitz kein IC oder ICE fährt, ist wichtig für die Identität der Stadt, die viel mit einem ironischen (Linke) bis ernstgemeinten (Rechte und auch Linke) Underdoggehabe zu tun hat. Es gibt einen Twitter-Account namens ,Hat heute in Chemnitz ein IC oder ICE gehalten?', und da wird jeden Tag ein ,Nein' gepostet."
Und auch wenn es eigentlich eher eine Notlösung ist, dorthin zu gehen, wirkt der Name der Stadt (die "Stadt mit den drei o - Korl-Morx-Stodt"), als sie ankommt, dann doch wie ein Versprechen, weil er für Aufbruch und fürs Wegkommen steht, für den Beginn eines eigenen Lebens: "Das verheißungsvolle Wort ,Chemnitz' - ich würde jede Wette annehmen, dass niemals jemand zuvor so über diese Stadt gedacht hat. Es war so verheißungsvoll, weil es das erste Mal Alleinsein bedeutete, das erste Mal war, dass ich selbst etwas entschieden hatte und mir nun mein Umfeld ganz neu zusammensuchen konnte."
"Superbusen" (der Romantitel ist der Name einer später gegründeten Band) erzählt auch von der Zeit nach dem 26. August 2018, als bei einer Auseinandersetzung am Rand des Stadtfestes ein Mann durch Messerstiche getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden, rechtsextreme Gruppen aufgrund von Nachrichten zum Migrationshintergrund der mutmaßlichen Täter zu Demonstrationen aufriefen und es zu Ausschreitungen kam.
Einen Tag später gibt es einen ersten Gegenprotest - die Nazis sind in der Überzahl, es ist viel zu wenig Polizei da; hier beginnt der Roman. Aber er erzählt eben nicht aus der Perspektive all derer, die damals zum ersten Mal nach Chemnitz gucken und kommen, um Bericht zu erstatten oder mitzudemonstrieren, sondern aus der eines Mädchens, das dort vorher schon war und zumindest vorübergehend hinwollte; eine Demo-erprobte Angehörige der Antifa, die die allmählichen Veränderungen der Stadt auf der Straße mit ihren Freunden nachvollzog: Wo es in Dresden irgendwann Pegida gab, gab es in Chemnitz "Cegida" - die Leute um sie herum erleben regelrechte "Demo-Burnouts".
Diese andere Perspektive ändert alles. Sie dreht die Verhältnisse um, macht uns, die wir alles Mögliche zu Chemnitz gelesen haben, zu Außenseitern, die erst mal zuhören, sich dem entsprechenden Humor stellen müssen - und immer wieder den Neonazis. Das ist auch in "Hawaii" so, von Cihan Acar, der 1986 bei Heilbronn geboren wurde, zwei Sachbücher über den Istanbuler Fußballverein Galatasaray und über Hip-Hop geschrieben und für die Deutsche Presseagentur aus der Türkei berichtet hat. In "Hawaii", wie sie ein Stadtviertel von Heilbronn nennen, tauchen zu Beginn des Romans Bürgerwehr-Leute auf, die ständig "Heilbronn, wach auf!" rufen, für Schweinefleisch-Pflicht in den Kitas demonstrieren und die Klimakrise leugnen; die immer mehr werden und irgendwann "für jeden toten Deutschen einen toten Ausländer" fordern. Bis sich eine militante, von einem Abdullah angeführte "Kanka"-Gruppe bildet und es zu schweren Zusammenstößen kommt, bei denen - wie in Chemnitz - der Ausschreitungstourismus beginnt. "Ihr seid gar nicht aus Heilbronn", stellt Acars Protagonist Kemal Arslan fest, als er vor einer Barrikade von Neonazis steht, die, bewaffnet, damit drohen, ihn abzuschießen.
Tatsächlich sind die Neonazis gekommen, um eine Art Kriegszustand anzuzetteln - und Kemal, der nicht bereit ist, sich mit den migrantischen Gegengruppen gemein zu machen, will einfach nur weg. Er war eigentlich schon weg, ein Agent hatte ihn entdeckt und als Profifußballer in die erste Liga in der Türkei geholt. Ein Unfall, der nicht auf dem Spielfeld stattfand, machte seiner Karriere ein Ende. Und so irrt er herum, aber nicht ohne Ziel: "Ich wusste ganz genau, wo ich hinwollte. An einen Ort, an dem ich der sein kann, der ich bin. Nicht Kemal, der Fußballer, nicht Kemal, der Arbeitslose, der Herumtreiber, der Versager, der Verräter, der Verkäufer, der Typ zwischendrin. Sondern einfach nur ich. So einen Ort muss ich finden", heißt es am Ende von "Hawaii".
Wo sie wegwollen, sollten wir alle hin: nach Kaiserslautern, Chemnitz und nach Heilbronn und uns dreimal Deutschland mit den Augen von Christian Baron, Paula Irmschler und Cihan Acar angucken. Sie sehen alle drei so viel mehr als wir.
JULIA ENCKE
Christian Baron: "Ein Mann seiner Klasse". Claassen-Verlag, 288 Seiten, 20 Euro. Paula Irmschler: "Superbusen". Roman. Claassen-Verlag, 320 Seiten, 20 Euro. Cihan Acar: "Hawaii". Roman. Hanser Berlin, 254 Seiten, 22 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Eines der besten literarischen Debüts dieser Saison. Überraschend, überzeugend, überwältigend." Julia Encke Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20200301