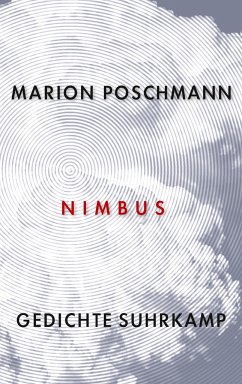Nimbus, die dunkle Wolke, ist eine Erscheinung aus Schwung, Pracht, Weite, und doch gehört sie dem Formlosen, Ungreifbaren. Sie entfaltet Wirkung, sie bestimmt die Atmosphäre, zugleich entzieht sie sich, bleibt unbeherrschbar. Mit festem Griff und Subtilität, Witz und Zärtlichkeit unternimmt Marion Poschmann in ihren neuen Gedichten den Versuch, Nähe und Ferne zusammenzudenken und die maßlosen Kräfte der äußeren Gegenwart in einen Raum der Innigkeit zu verwandeln. Aber wo ist innen? Die Erforschung Sibiriens vor Beginn der Industrialisierung, flüchtige Begegnungen mit Tieren, die Nuanciertheit eines Farbtons oder die Verletzlichkeit von Eismassen spiegeln ebenso wie die kleinen magischen Praktiken des Alltags die Einzigartigkeit der globalen Veränderung.
Nimbus ist eine Feier des Sublimen und des Schönen, mitreißend und formbewusst, unverwechselbar im Ton, lustvoll und philosophisch.
Nimbus ist eine Feier des Sublimen und des Schönen, mitreißend und formbewusst, unverwechselbar im Ton, lustvoll und philosophisch.

Zwei große deutsche Lyrikerinnen beschreiten ganz verschiedene Wege, aber die Resultate sind gleichermaßen faszinierend: Zur neuen Poesie von Marion Poschmann und Nadja Küchenmeister.
Man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. So könnte auch die Maxime lauten, wenn man Marion Poschmanns Gedichtband "Nimbus" neben Nadja Küchenmeisters "Im Glasberg" legt. Aber wie jeder weiß, ist das Äquivalenzgebot Humbug, da erst die Praktik des Vergleichens Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen lässt. Wie sehen also die markantesten Eigenschaften der beiden Bücher aus? "Farnfraktal" heißt ein Gedichttitel von Marion Poschmann, der sie umgehend als poetische Enzyklopädistin ausweist. Das so benannte Gedicht stammt aus dem Zyklus "Baum der Erkenntnis", der ebenso auf Adams und Evas Sündenfall wie auf die verzweigten Ordnungssysteme von Enzyklopädien anspielt.
"Farnfraktal" fungiert - wie die Gedichte "Nimbus", "Kurgankultur" oder "Nymphaion" - als ein Lemma, das den Lesern eine Wissenskonstellation vor Augen stellt. Farne kennt jeder. Fraktale sind mathematische Mengen, die sich in verkleinerter Form selbst enthalten. Das Bild eines Farnfraktals setzt sich aus Miniaturfarnen zusammen. Für Wissenskristallisationen dieser Art hat Marion Poschmann ein bewundernswertes Gespür. Mit ihnen setzen ihre Gedicht ein, um eine plötzliche Wahrnehmung folgen zu lassen: "Farnfraktal - wie Flügel gegen sinkendes Abendlicht." Vogelgleich schwingt sich der Farn auf und löst seinerseits eine Reaktion aus: "Und wir, wir wichen schüchtern den Schritt zurück / ins Dunkle, wo die Farnspiralen / ausharrten, dicht in sich eingewunden, / genügsam, lautlos." Die Szene mag realistisch wirken, sie ist als Fraktalbild jedoch hochgradig artifiziell. Poschmanns Simulakren wirken, als habe sich die Realität in der Imagination verdoppelt und als hätten sich die Grenzen zwischen beiden verwischt.
Dieses Bildraffinement verstärkt sich durch die merkwürdige Verdopplung der Ersten Person Plural ("wir, wir"). Von jetzt an - und das ist großartig gearbeitet - organisiert die Zwillingsform (Geminatio) die Verse, die in die Frage münden: "War ich denn jemals so - / so eingerollt in mich, völlig eingehegt / in Wald, der an mich grenzte, Wald, der / Gegenfarn bildete, größer, stiller." Die drei Gemini ("Wir, wir", "so, so", Wald, Wald) setzen das Verdopplungsspiel zusammen mit dem Farn und seinem Gegenfarn fort. Geht es noch feinsinniger? Ja! Das Faszinierende an Fraktalen ist, dass ihre bildliche Darstellung auf der Wiederholung des Immergleichen beruht, während sie mathematisch auf asymmetrischen, in sich gebrochenen Zahlenreihen. Durch Fraktale geht ein Riss.
Und ein solcher zerreißt auch Poschmanns Bildwelten. Marion Poschmann ist die Lyrikerin der ins Unbestimmte weisenden Leerstelle. Darin liegt die enge Verwandtschaft ihrer Poesie mit der asiatischen Kunst. Daher stellen auch die Gedichte in "Nimbus" detailliert gearbeitete Unschärfen vor Augen. Die "Dichtung, als Betrachtungskunst" ist für Poschmann ein "Medium bildbezogener Erkenntnis".
Diese bildbezogene Erkenntnis faltet "Nimbus" fächerartig in neun Typologien aus. Der enzyklopädische Bildraum erstreckt sich von den Schneelandschaften Sibiriens über graugrüne Facetten des japanischen Seladons bis zur ruhmreichen Nimbus-Wolke aus. Poschmanns Gestalten sind vergänglich und vorläufig, da sie erst im Verschwimmen, Tauen und Auflösen ihre zarte Schönheit offenbaren.
Diese Ästhetik des Vergänglichen rückt Nadja Küchenmeisters neuen Gedichtband für einen Augenblick erstaunlich nah an Poschmanns "Nimbus". Obwohl "Im Glasberg" sonst ganz andere lyrische Wege geht. Küchenmeister hat ihre Gedichte nicht ausgefächert, sondern gerahmt: "helle mitte" heißt der erste Zyklus, "dunkle mitte" der letzte. Der Band setzt "Im Glasberg" ein, einem Handlungsort des grimmschen Märchens "Die sieben Raben". Das letzte Gedicht legt fest: "es beginnt wo es endet". Und zwar, so könnte man mit den Brüdern Grimm sagen: in der Familie. Der erste Zyklus inszeniert eine Rückkehr in das Haus der eigenen Kindheit: "ich rauke mich heran ans wuhletal", so die Formel für Küchenmeisters Darstellung dieser befremdlichen Heimkehr nach Wuhle.
Zu den eigenen "Wurzeln" führt auch der zweite Zyklus, in dem klar wird, dass das heimgekehrte erwachsene Kind nun allein im Haus lebt, während die Eltern abwesend sind. Der dritte Zyklus ("man zittert / und das zittern hält an") zieht in Form eines beeindruckenden Langgedichts in den "mittelfellraum" ein. Naheliegend, dass an diesem Ort der Grund für die Abwesenheit der Eltern liegt.
All dies entwirft Nadja Küchenmeister im geradezu dokumentarischen Duktus. Diese Schreibweise ist für sie nicht neu. Aber in ihren beiden Bänden zuvor bildeten die realistischen Sequenzen einen Generalbass, der durch ergreifende Epiphanien, irritierende Verkehrungen und subtile Surrealismen gebrochen wurde. Jetzt sind diese Raumerweiterungen auf ein Minimum beschränkt. Nur gelegentlich blitzen sie noch auf: "die sonne ist der mond / mein auge ein stern unter sternen", heißt es. Oder "ich bin die beste schwimmerin / siebzehn Bahnen durch dein Auge". Während man bei Poschmann nie weiß, wo das Imaginäre aufhört und das Reale beginnt, richtet Küchenmeister eine identifizierbare Wirklichkeit ein.
Dazu akkumuliert Küchenmeister zum Beispiel im Zuge eines Fensterblicks einzelne Elemente: "s-bahn, u-bahn, gleise, wurzeln / im geflecht, das maisfeld, den baumbewachsenen hügel / hell im licht." Wissen der Kindheit und erlebter Augenblick überlagern sich schließlich: "im sommer rollt die sonne, eine goldene / münze, in die wuhle, im winter werfen schlitten kinder / aus der bahn." Aber poschmannsche Faltungen von Realem in Imaginäres erlaubt sich Küchenmeister nicht. Ergreifend wirkt vielmehr, wie akribisch die Gedichte die eigenen Wurzeln zu ertasten suchen, zumal die gefundenen Inventarien jetzt auf das fortschreitende Altern und die Abwesenheit der Eltern verweisen: "vogelfedern, zarte zweige / der tagesspiegel von letzter woche und deine / zähne auf dem unterteller, neben der kartoffeln / altern die gewürze . . . die schublade ist rausgezogen / wonach hast du gesucht." Gesichtete Materialen eines vergehenden Lebens lassen die (ver-)letzten Zügen einer neuen Beziehung aufblühen: "ich zähle deine hemden, socken / unterhosen, entwirre die kabel unter dem tisch, schwarze / wurzeln, die keinen anfang und kein ende haben."
In diese Konstellation bettet Küchenmeister nicht zuletzt auch die Beziehung eines Paares ein, deren Begegnungen die Fremdheit nicht abstreifen können: "du / sitzt im zug, der aus der gegenrichtung / an mir vorbeifährt, ein streifen zug im fenster / ich." So behutsam, so schlicht, so willentlich begrenzt auf ein sparsames Material schwerer Zeichen, hat Nadja Küchenmeister zuvor nicht gedichtet.
Kann man aufgrund der Unterschiede ein Urteil über die ästhetische Qualität treffen? Das größere semiologische Abenteuer bieten Marion Poschmanns Unbestimmtheitsfiguren. Und das ist nur möglich aufgrund ihrer atemraubend feinen Faktur. Aber das ist nicht alles, was gute Gedichte ausmacht. Die beiden Bände sprechen zwei völlig unterschiedliche Stimmungs- und Denklagen an und setzen ihre Poetik in bewundernswerter Konsequenz um. Für die Lyrik der Gegenwart kann es kaum Besseres geben als solch eklatante Unterschiede.
CHRISTIAN METZ
Marion Poschmann: "Nimbus". Gedichte.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 115 S., geb., 22,- [Euro].
Nadja Küchenmeister: "Im Glasberg". Gedichte.
Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2020.
112 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Rettung des Weltklimas aus dem Geist der Ode? Naturzerstörung ist Ausgangspunkt der Gedichte
Marion Poschmanns, mit Disziplin und Humor entdeckt sie darin ein Bündel anderer Fragen
VON HUBERT WINKELS
Man kann Marion Poschmanns neue Gedichte auf die Naturzerstörung beziehen. Man kann sie lesen als Abgesang auf die lebendigen Objekte unserer vorgeblichen Verehrung und faktischen Verachtung. Als sanfte Klage über das Verschwinden des ewigen Eises, über die Vernutzung der Schätze der Erde, über die Indolenz einer aggressiven Zivilisation. Das mag manch einem guttun zur Zeit, mit diesen schönen Gedichten den Aufstand gegen die Verzweckung der lebendigen Umwelt zu veredeln.
Aber sie taugen nicht dazu. Sie nehmen zwar die Naturzerstörung zum Ausgangspunkt, aber sie entdecken darin ein ganzes Bündel anderer Fragen, die sich vor allem auf die Gestalt der Klage und des Gesangs beziehen. Wer spricht aus der Überblicks-, der Sonnenposition? Wie ist der Kläger eingebunden ins Tableau der Natur? Wie hat er selbst es geformt? Wie erlebt er die Selbstbegegnung in der konkreten Anschauung? Was ist der sprachpragmatische Sinn seines Dichtens und Denkens?
Man kann schon im Titel des ersten Gedichts die ganze Spannung zwischen menschlichem Handeln und der sich entziehenden Außenwelt spüren. Ein gleitender Satz, der ein leitmotivisches Paradox inszeniert: „Und hegte Schnee in meinem warmen Händen“. Es folgt ein kurzer Rückblick auf das Schmelzen der „tiefverschneiten Berge“ als direkte Folge von touristischem Blick und naturfrommer Andacht. Wir töten, was wir lieben. Wir zerkleinern das Erhabene noch im Traum, der uns die menschliche Naturgeschichte Revue passieren lässt.
Scheitert der Versuch des Herausspringens aus der Totschlägerreihe also schon in der ersten Selbstbesinnung? „Ich war nackt wie ein Gletscher, ich stand auf den / Eisbalkonen, verkündete Schneemächtigkeit, / die Auflast weiterer Massen, aus meinem / Rachen trat Dampf …“ Von Ferne grüßt hier syntaktisch ein anderer Gesang vom Untergang: „Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung BLABLA. Im Rücken die Ruinen von Europa“, so beginnt Heiner Müllers „Hamletmaschine“.
Auch bei Marion Poschmann mischen sich begriffliche Erkenntnis und starke Bildlichkeit bis in die Details. Im zitierten Gedicht heißt es weiter: „aus meinem / Rachen trat Dampf, alle gezählten / Sterne über mir ausgehaucht, alle / moralischen Zitzen unter mir ausgesaugt ...“. Das umgestürzte Kantzitat (gestirnter Himmel über mir, moralisches Gesetz in mir) markiert einen Endpunkt der moralischen und physischen Integrität des Menschen. Er ist aktiver Teil des Unheils und des Schönredens, Dichtung genannt. Aus der Entzauberung der Welt ist die Erosion ihrer physischen Substanz geworden, das Sprechen infiziert vom Prozess der Auflösung.
Wir beginnen also mit einem zivilisatorischen Schiffbruch, doch dann macht es einen Text-Sprung, und wir gehen ins Filigrane, ins Fraktale. Wir besuchen in einer Reihe sehr luftiger Textgebilde Top-Orte der Schnee- und Eisskulpturen, geografische Gefilde, in die uns Poschmanns Sehnsucht schon häufiger geführt hat: nach China, Sibirien, in die innere Mongolei. Wir begegnen den tauenden Rändern der Eisskulptur, den Schlieren und kurzlebigen Glasformen: vergehende Gebilde in Raum und Zeit. Nicht mehr nichts und noch nicht etwas. Figur auf Abruf, mit Klima als existenziellem Kern. Langsame Drift, schwache Haftung, passagere Existenz.
Damit sind wir im Zentrum der kalten Formwerkstatt von Marion Poschmann, die starke Bilder beschwört aus schwachen Materialien, aus Staub, Luft und Unscheinbarkeit, Welt aus Nimbus- und Federwolken. Am Himmel Wasserdampf, am Boden wollene Schafe. In „Nimbus“ ziehen wir mit ihren Wolken-Schaf-Gebilden ins farbstille Sibirien, wo schon ihr „Schwarzweissroman“ spielte, und wo in etlichen Gedichten zuvor die verschwindenden Dinge in der Unermesslichkeit ein blasses Dasein fristen.
„Sibirischer Tierstil“, „Animismus“, „Stadtschamanen“, „Wettermachen“ heißen die ersten vier Kapitel des Bandes. Allesamt evozieren sie die magische Kraft von Sprachzeichen, und wenn man das fünfte, „Baum der Erkenntnis“, dazu nimmt, dann haben wir auch den Sprung in die Verallgemeinerung des Merkmals zum Allbegriff mitgemacht, biblisch: die Vertreibung aus dem Paradies in eine Welt des Benennens und Erkennens. Statt sibirischer Tiertatoos an Kuraganwänden Kants Kategorientafeln in der „Kritik der reinen Vernunft.
Hier sind wir an der besonderen Schwelle, an der Marion Poschmann ständig wacht. Sie sucht die schwankenden Orte der Verwandlung auf, beobachtet die Übergänge von Tier zu Mensch, vom Kind zum Erwachsenen, vom Diesseits zum Jenseits, vom Blick zum Bild, vom Bild zum Begriff. Sie siedelt an der Stelle, wo die Aura des dichterischen Sprechens sich vom bezeichneten Inhalt und dem pragmatischen Sinn des Sprechens trennt und gleichwohl mit ihm verbindet: ein magischer Ort vernünftiger Sprachpraxis. Denken und Zaubern in Einem. Das Paradox ist, dass die auf Dauer gestellte Selbstreflexion eines bildlich-poetischen Sprechens die intendierte Selbstbewegung des sprachlich-poetischen Stoffes aufhebt. Das Imaginäre ist auch ein indirekter Gnadenerweis einer Vernunft, die ihre Selbstbeschränkung erkennt, ohne sie abstreifen zu können. Nur starkes Denken entlässt schwache, formbare Gebilde der Schönheit.
Wie viele Hinweise geben die Gedichte auf ihre eigene schwache Verfassung, auf des Ephemere, Transitorische, Blasse, Fahle, Kleine, Leise, Faltige, Verschwindende, Unscheinbare ihrer im Nu verdunstenden Bilder! Diese Bildlichkeit ist schön – und doch auch der Effekt einer Platzanweisung durch die herrschende Vernunft. Ein ähnliches Problem findet man bei der sogenannten Philosophie des schwachen Denkens: Sie überzeugt nur mit starken Argumenten. Das Dilemma ist auch in der Poesie nicht auflösbar, anderenfalls wären die Bilder illusorisch, niedlich, nice. Und Marion Poschmann ist nicht nice, never. Im Gegenteil: Ihre kenntnistrunkenen Aufenthalte an scheinbar entlegenen Orten der Kulturgeschichte ihrer Gegenstände sind unerreicht.
Die Lust an der Vertiefung eines Stoffs, die Varianten seiner sprachlichen Durchdringung führen auch zur zyklischen Struktur der Gedichte. So gibt es sechs „Seladon-Oden“, die jene ostasiatische Keramikglasurfarbe umspielen, die durch ihre vornehme mattgrüne Glasur, durch Unauffälligkeit gewissermaßen, auffällt. Seladongefäße markieren Höhepunkte asiatischer Kultur. Ihr dem Wasser naher Farbton veranlasste Adenauer, diese Farbe für die Kölner Rheinbrücken zu verwenden. Im deutschen Farbnormsystem ist sie am ehesten unter Resedagrün zu finden (RAL 6011). Im 19. Jahrhundert wurde die nach einer bei Bienen beliebten Strauchpflanze benannten Farbe als Anstrich für Industriemaschinen aller Art verwandt. Der Name dieses gar nicht mehr so unscheinbaren Farbtrostes in Poschmanns Universum der schönen Dinge, stammt von einem sehnsüchtigen Schäfer des Barock. In Honoré d‘Urfés einst berühmtem Schäferroman „L‘Astrée“ heißt er Céladon und begehrt schmachtend die schöne Astrea.
Marion Poschmann bewegt sich traumwandlerisch sicher in der Kultur- und der Wissenschaftsgeschichte. Erst ihr Kenntnisreichtum lässt sie schließlich durch die Erscheinungen wandeln wie mit geschlossenen Augen. Parallel zu „Nimbus“ ließen sich ihre Zürcher Poetikvorlesungen von 2019 publizieren, die sich vor allem auf Quallen, Wölfe und Schafe beziehen und mit ihnen schlicht überall hin führen.
Bei aller Strenge ist Humor das Medium, das die Dinge in Fluss bringt. Er lässt den beschworenen hypnopompen und hypnagogen Einbildungen des Sch(l)äfers Raum und wacht über den schwachen Schlaf der Vernunft, der auf diese vorteilhafte Weise zum „Schaf der Vernunft“ wird. Solches ‚Einhegen des Schnees‘ leisten auch die strengen Formen, die sich die Dichterin auferlegt: Oden, mit einer Verneigung vor Klopstock, und sogar einen veritablen Sonettenkranz, der bei allen Konstruktionszwängen am stärksten eine historisch reale Geschichte erzählt, ausgerechnet!
Disziplin und Humor, davon sprechen auch die Verse gegen Ende des Bandes, die das Zeug zum Sprichwort haben, weil sie die apokalyptisch angespannten Glieder lockern:
„Rettung des Weltklimas aus /
dem Geist der deutschen Ode -
haben wir uns da nicht etwas
viel vorgenommen?“
Nö.
Marion Poschmann: Nimbus. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 119 Seiten, 22 Euro.
Viele Hinweise geben die Gedichte
in „Nimbus“ auf ihre eigene
schwache Verfassung
„ich stand auf den / Eisbalkonen, verkündete Schneemächtigkeit“ – Blick auf den Grossen Aletschgletscher in der Schweiz.
Foto: Christian Sommer/dpa
Marion Poschmann, 1969 in Essen
geboren, lebt heute in Berlin. Für ihren Roman „Die Kieferninseln“ (2017) erhielt sie den Klopstock-Preis. Foto: dpa
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»... bei Marion Poschmann mischen sich begriffliche Erkenntnis und starke Bildlichkeit bis in die Details. ... [Sie] bewegt sich traumwandlerisch sicher in der Kultur- und der Wissenschaftsgeschichte.« Hubert Winkels Süddeutsche Zeitung 20200629