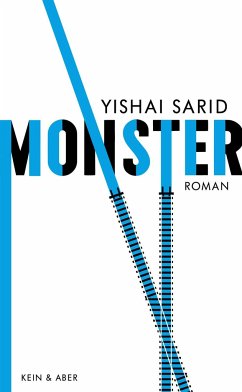Am Ende des Romans steht eine Eskalation: Ein israelischer Tourguide streckt im Konzentrationslager von Treblinka einen deutschen Dokumentarfilmer mit einem Faustschlag nieder. Wie kam es dazu? In einem Bericht an seinen ehemaligen Chef schildert der Mann, wie er jahrelang Schulklassen, Soldaten und Touristen durch NS-Gedenkstätten geführt hat und wie unterschiedlich diese mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen. Nach und nach zeigt sich, dass seine Arbeit nichtspurlos an dem jungen Familienvater vorübergeht - die Grauen der Geschichte entwickeln einen Sog, gegen den keine akademische Distanz ankommt. Gleichzeitig wächst sein Frust über die eigene familiäre und berufliche Situation. Am Ende wollen alle in erster Linie aus dem Holocaust - und dem Gedenken daran - einen Nutzen für sich selbst ziehen. Als der Erzähler das erkennt, wird er vom Beobachter zum Akteur, und der Kreislauf der Gewalt vollendet sich.Yishai Sarid, einer der bekanntesten Autoren Israels, wirft in seinem Roman ein neues Licht auf die Erinnerungskultur, wagt sich an vermeintlich unantastbare Fragen und stellt in stillem, unaufgeregtem Ton eingefahrene Denkmuster infrage.

Wie über die Schoah erzählen nach einem Dreivierteljahrhundert, wenn es bald
keine Augenzeugen mehr gibt? – So: Yishai Sarids Roman „Monster“
VON MARIE SCHMIDT
In letzter Zeit hat es wieder viel Streit gegeben um die Darstellung historischer Wirklichkeit in Romanen und Schriftstellerreden. Immer wenn in dieser Sache gezankt wird, scheint man sich die Literaturkritik als Gouvernante zu wünschen. Nur so ist es zu verstehen, dass missratene Bücher, Filme, überhaupt Kunstwerke gegen Einwände oft verteidigt werden wie vor einer strengen Erzieherin, nämlich mit dem Argument, die Kunst müsse doch alles Mögliche „dürfen“.
Damit endet die Auseinandersetzung gewöhnlich, weil niemand sich zur Instanz machen möchte, die ästhetische Freiheiten zu erlauben oder zu verbieten hätte. Von welchem autoritativen Standpunkt auch? Fragen, die dann übrig bleiben, gerade wenn sich Kunst frei an historischen Stoffen bedient, betreffen eher das „Wozu?“: Wem dient diese Darstellung der Geschichte? Welche Erkenntnisse schafft sie, welchem Verhältnis zum Gewesenen leistet sie Vorschub? Was will diese Kunst oder jene Ansprache von mir, wie soll ich mich zur Vergangenheit verhalten?
Die Antworten darauf können nicht klüger ausfallen, als sie in den betreffenden Werken angelegt sind. Deshalb stellen solche Fragen durchaus moralische Ansprüche an die Kunstwerke selber. Sie fallen besonders gewichtig aus, wenn ein Roman mit dem Menschheitsverbrechen umgeht, der Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen. Wenn es demnächst für dieses Ereignis keine Augenzeugen mehr gibt, schwächen sich die moralischen Ansprüche an seine Darstellung aber nicht ab, wie manche schon meinen, sie werden offenbar eher schärfer. Man kann diese Ansprüche mithilfe eines Romans formulieren, der sie eben wirklich selbst aufstellt: der beeindruckende dritte Roman des israelischen Rechtsanwalts und Journalisten Yishai Sarid.
Er heißt „Monster“ und hat die Form eines Briefes an eine schattenhafte Figur im Hintergrund. Sie funktioniert wie ein Vater oder Richter, vor dem ein Geständnis abzulegen wäre: „Sehr geehrter Herr Direktor von Yad Vashem, dies hier ist der Bericht über das, was dort vorgefallen ist.“ Hier hat sich wohl einer etwas zuschulden kommen lassen: ein junger israelischer Historiker, der – mangels besserer Möglichkeiten, wie er betont – Experte für das Lagersystem der Nazis geworden ist. Er scheint keine Vorfahren zu haben, die in Europa umgekommen sind, fliegt aber, um Geld zu verdienen für seine Frau und einen kleinen Sohn, regelmäßig nach Polen. Da arbeitet er als Guide in den Gedenkstätten in Auschwitz, Majdanek, Sobibor.
Während der Erzähler also im Rahmen seiner Doktorarbeit „Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Arbeitsmethoden deutscher Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg“ immer mehr Details sammelt und die grässliche Logik des Verwaltungsmassenmords studiert, sieht er an den Besuchergruppen, wie die Erinnerung an die Schoah zur abstrakten Angelegenheit wird. Sarid parallelisiert da die Abstraktheit des Vernichtungssystems mit der Routiniertheit des Gedenkens, und in diesem Vergleich besteht das Monströse, das der Titel ansagt.
In aller Sachlichkeit des Berichts an einen Vorgesetzten schildert der Erzähler, wie er an diesem Verhältnis leidet, und wie er sich deshalb nur umso rückhaltloser vor Augen führt, was geschehen konnte. Bis er die Vergangenheit an der Rampe von Auschwitz lebendig vor sich hat: „Ich versuchte zu hören, was sie sagten. … Wo sind meine Frau und das Kind. Steh gerade, hier fragt man nicht, wer seid ihr, wie lange seid ihr da. Wann bekommt das Kind was zu trinken.“ Er denkt sich dermaßen in das Lagersystem hinein und in seine Aufgabe, es zu erklären, „als wäre die Aktion in vollem Gang und ich sei mitverantwortlich für ihre Planung und Durchführung und für die Einhaltung der Zeitvorgaben“.
Dass Yishai Sarid in diesem Roman keinen Auschwitz-Überlebenden oder Lagerkommandanten sprechen lässt, sondern einen Nachgeborenen, nimmt dem, was er über die Vernichtung sagt, nichts von seinem Grauen. Es besteht gerade darin, dass man durch den Guide und Erzähler vermittelt sieht: Man kann wissen, wie viele Millionen getötet worden sind, mit welch technischem Plan. Und man kann die Leidenswege Einzelner kennen, sie sind dokumentiert. Nur beides geht nicht ins selbe Bild, das millionenfach individuelle Sterben ist undarstellbar. Was grässlicherweise dem ideologischen Kalkül der Nazis entspricht. Einer der moralischen Ansprüche, die sich an Romane über die Schoah deshalb stellen, ist, dass sie dieses Dilemma nicht verflachen. Sarids Erzählung reißt den Widerspruch neu auf. Die Stimme eines „treuen und fleißigen Agenten der Erinnerung“ ist eine redliche Form dafür, weil sie die Perspektive nicht künstlich begrenzt.
Der Roman „Monster“ erinnert deshalb auch daran, dass der Widerspruch zwischen Abstraktion und Genauigkeit von Anfang an zum Umgang mit der Schoah gehört hat. Das Bedürfnis, en gros zu verstehen, was geschehen ist und zu formulieren, was es bedeutet, war nie vermittelbar mit der Sorgfalt gegenüber den historischen Einzelheiten individueller Lebensgeschichten.
Das ist nicht erst ein moralisches Problem, seit die Zeitzeugen weniger werden. Im Grunde hat es sich zum Beispiel im Streit um Hannah Arendts „Eichmann in Jerusalem“ schon gestellt. Arendt ist für dieses Buch im New Yorker Intellektuellenmilieu, in dem sie lebte, schwer kritisiert worden. Man fragte sich, was ihre Erkenntnis bedeuten sollte, dass der Massenmord banalisiert worden war, als er in industriellem Maßstab geplant und eine ganze Gesellschaft zu Mittätern gemacht wurde. War das Sterben der Opfer deswegen Schicksal? Rechtfertigt es die Täter, die Mitläufer? In der Überzeugung, dass man das nur im Einzelfall begreifen kann, füllte die Oral History ihre Archive mit Zeitzeugenberichten. Hannah Arendt hat später darauf beharrt, dass der Schrecken der NS-Diktatur gerade darin bestand, das Töten zum Bestandteil einer „Neuen Ordnung“, zur Normalität gemacht zu haben. Was die Untertanen dieser Ordnung ihrer „persönlichen Verantwortung“ aber nicht entschlug, wie sie weiter schrieb.
Auch dieses Dilemma lässt Yishai Sarid seinen Protagonisten durchmachen. Einmal fragt er eine Gruppe israelischer Soldaten, die er durch eine Gedenkstätte führt: „Hättet ihr damals im Militär gedient, sagen wir in der Panzergruppe oder bei der Flugzeugwartung oder bei der Adjutantur oder im Funkaufklärungsbunker, und eure geliebte Heimat hätte sich im Krieg mit Feinden an allen Fronten befunden – wärt ihr dann desertiert, wenn ihr erfahren hättet, dass irgendwo weit weg, im Osten, schmutzige Arbeit getan wird?“ Ein paar Schüler hört er „in Majdanek auf dem wenige Hundert Meter langen Weg von den Gaskammern zu Mausoleum und Krematorium“ einander zuflüstern: „Araber, so müsste man es mit den Arabern machen“.
Man kann das als deutsche Leserin nicht leichtfertig lesen, und Sarid schreibt dann auch, dass es die Deutschen waren, die diese Logik verursacht haben. Seinen Erzähler machen die Trauerrituale der israelischen Besucher in den Konzentrationslagern nervös, die keinen Groll gegen die Deutschen hegen, „als sei das alles ein Beschluss des Himmels gewesen“. Man liest das auf Deutsch mit dem Gedanken daran, wie lange sich auch hier um die Tätererinnerung herumgedrückt worden ist. Und jetzt geht es ja schon wieder los, dass manche sich wegen historischen Abstands davon distanzieren wollen. Götz Aly hat in seiner Rede zum Holocaust-Gedenktag vor dem Thüringer Landtag angemahnt, dass das nicht möglich ist. Er las aus den Briefen eines Wehrmachtssoldaten vor und sagte: „Wir sollten auch seiner gedenken, allerdings mit Schaudern vor den menschlichen Abgründen, mit dem selbstkritischen und demütigen Wissen, wie schnell Menschen verrohen und das scheinbar feste Korsett bürgerlicher Kultiviertheit abschütteln können. Auch Werner Viehweg war einer von uns.“
Sarids Erzähler richtet seine Frage „Was hättet ihr getan?“ nun aber an israelische Landsleute. Womöglich geht es dabei weniger um eine Grenzüberschreitung, als um die allgemein existenzielle Überlegung, wie man sich als Einzelner zu den Systemen, Regierungen, Betrieben, Ideologien verhält, in denen man immer feststeckt und von denen man abhängt. Den Nachkommen der deutschen Täter stellt sich diese Frage in besonderer Weise – und wenn man sie noch so oft für veraltet erklärt („waren ja andere Zeiten“), oder nach Art der Generation Aufmerksamkeitsdefizit bis zur Verantwortungslosigkeit vereinfacht („Es gibt Schuld“, Takis Würger) oder grell verkehrt in Reden von „Monumentalisierung der Schande“ (Martin Walser) und „Schuldkult“ (Alice Weidel, unter anderen). Die Frage heißt: Was hätte mich daran gehindert, mich schuldig zu machen? Man darf hoffen, dass da etwas gewesen wäre, man muss wissen: eher nichts.
Diese Einsicht nicht zu verharmlosen ist der moralische Anspruch, den Yishai Sarid stellt. Zumal er ihn bis zu einem letzten Problem durchdenkt. Schon Hannah Arendt hat man die Bemerkung in „Eichmann in Jerusalem“ am übelsten genommen, dass, wenn nicht Judenräte mit den Deutschen kollaboriert hätten, „es Chaos und viel Elend gegeben“ hätte, aber nicht diese
„Gesamtzahl der Opfer“. Der Erzähler wiederholt etwas ähnliches und erklärt den Gedenktouristen: „Der animalische Drang, um jeden Preis zu überleben, und die Kapitulation des Menschen vor hemmungsloser Gewalt hielten die Maschinerie am Laufen und lagen dem deutschen System zugrunde. Ich hätte ebenso gehandelt, sagte ich ihnen“. Dass die Nazis sogar ihre Opfer in ihre Verbrechen einbezogen haben, es erzwungen haben, dass sie sich noch mitschuldig machen sollten, ist ein Aspekt des Dritten Reiches, der bei aller Gedenkroutine bis heute schwer repräsentierbar ist. Man kann es deswegen eigentlich nur so referieren, wie Sarids Erzähler. Ein essayistischer Roman ist dafür die einzig erträgliche Form. Als Geschehen, in das man sich hineinzuversetzen hätte, könnte es nur geschmacklos sein.
Nun dient alles Erklären in der Fiktion des Romans „Monster“ der Rechtfertigung gegenüber dem Direktor der Gedenkstätte Yad Vashem für einen Vorfall, der sich ganz am Ende von „Monster“ ereignet. Er soll hier nicht näher beschrieben werden, nur dass ein deutscher Regisseur eine Rolle dabei spielt, „groß gewachsen, mit markanten und sensiblen Gesichtszügen“. Und dass dieses Ende an einem keinen Zweifel lässt: Eine gemeinsame Erinnerung an die Schoah gibt es nicht. Zwischen Opfererinnerung und Tätererinnerung kann man nicht tauschen.
Yishai Sarid: Monster. Roman. Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. Kein & Aber Verlag, Zürich 2019. 176 Seiten, 19 Euro.
Ein junger israelischer Historiker
sammelt immer neue Details über
den Verwaltungsmassenmord
Das Töten wurde zum Bestandteil
einer „Neuen Ordnung“,
zur Normalität
Am Ende steht ohne Zweifel
fest: Eine gemeinsame Erinnerung
kann es nicht geben
Yad Vashem: Das Mahnmal für die Deportierten erinnert an Millionen, die mit Viehwaggons in die Lager transportiert wurden.
Foto: mauritius images / Michael Ventura
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Höchst beeindruckend findet Marie Schmidt den dritten Roman des israelischen Journalisten Yishai Sarid, der von einem jungen Historiker erzählt, der in den Gedenkstätten der Konzentrationslager als Guide sein Geld verdient und sich offenbar für ein Vergehen gegenüber dem Direktor von Yad Vashem erklären muss. Die gewählte Form des essayistischen Briefromans scheint ihr geeignet, das Abstrakte der NS-Vernichtungslager und die Routine des Gedenkens in den Lagermuseen zu parallelisieren, wie es der Autor macht. Sachlich genug scheint ihr die Schilderung des Erzählers, und doch auch plastisch und grauenvoll genug für den Leser. Moralisch geht der Autor laut Schmidt den richtigen Weg, indem er die Widersprüche seines Themas nicht verflacht, sondern "neu aufreißt", wie die Kritikerin mit Blick auf die Debatte um Takis Würgers "verantwortungslos vereinfachten" Roman "Stella" betont.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Yishai Sarids Roman "Monster" ist ein fiktionaler Bericht an den Direktor von Yad Vashem. Das Buch schlägt einen Bogen vom Holocaust zur politischen Gegenwart - und rechnet bitterböse mit der israelischen Erinnerungskultur ab.
Was bedeutet die Erinnerung an den Holocaust den wenigen, die noch leben? Und was macht sie mit denen, die Erinnerung lernen? Yishai Sarid antwortet darauf in seinem Buch "Monster", das vor allem Leser in Israel im Blick hat, wo diese Erinnerung ein identitätsstiftendes Merkmal ist, mit fast bösartiger Klarheit: Die Erinnerung hält jeden gefangen, und sie macht alle wahnsinnig.
Gleich zu Beginn gesteht der namenlose Ich-Erzähler, er habe in seinem Leben eigentlich etwas anderes vorgehabt und sei in die Holocaust-Forschung nur "aus pragmatischen Gründen" gelangt. Zur Diplomatenausbildung hatte ihn das Außenministerium nicht zugelassen, und den Job als Iran-Experte für den militärischen Nachrichtendienst wollte er nicht. Als Historiker, so wurde ihm signalisiert, blieben ihm damit nur die Holocaust-Studien - ganz so, als könne es für Historiker, die sich mit etwas anderem beschäftigen, in Israel kein Auskommen geben. Bald bietet der junge Doktorand auch Führungen durch die Gedenkstätte Yad Vashem an. Später kommen Touren durch die Konzentrationslager in Polen hinzu, die rasch zu seiner vornehmlichen Beschäftigung werden, weil sie ihn und seine kleine Familie ernähren. Als Guide von Schülergruppen, denen er in Polen die Maschinerie der Vernichtung erläutert, vergehen seine Jahre.
Das Buch von Yishai Sarid ist in Form eines fiktionalen Berichts verfasst, der adressiert ist an den Direktor von Yad Vashem. Ihm glaubt der Erzähler, Rechenschaft über seine Arbeit als Guide ablegen zu müssen, womit dem Leser von der ersten Seite an signalisiert wird, dass etwas vorgefallen sein muss. Hier und da sind weitere Hinweise auf das Unheil eingestreut, auf das der Bericht letztlich zusteuert, etwa auf die "seelischen Belastungen", die mit den Führungen durch Yad Vashem verbunden seien, die der Erzähler aber nicht sonderlich ernst nahm. Auf diese Weise entwickelt das Buch einen unheimlichen Sog, der daran erinnert, dass Yishai Sarid ein guter Thriller-Autor ist, der schon vor einigen Jahren mit "Limassol" eine spannende Agentengeschichte veröffentlicht hat.
Je häufiger der Erzähler in Sarids neuem Buch die Schüler durch Belzec, Treblinka, Sobibor, Auschwitz und Birkenau führt, desto klarer formuliert er seine Fragen. Wer wird zum Mörder? Wer nicht? Wer sind ihre Opfer? "Seltsamerweise hörte ich sie gerade in Majdanek, auf dem wenige Hundert Meter langen Weg von den Gaskammern zu Mausoleum und Krematorium, über Araber reden. In Flaggen gehüllt flüsterten sie: Araber, so müsste man es mit den Arabern machen. Nicht immer, nicht bei allen Gruppen, aber häufig genug, um mir im Gedächtnis zu bleiben." Und wenig später gibt der Erzähler die Antwort auf seine Frage selbst, warum sich der Hass ausgerechnet gegen die Araber richtet und nicht etwa gegen die Deutschen: "Aber Menschen wie die Deutschen können wir schwerlich hassen. Schaut euch die Fotos aus dem Krieg an, man muss der Wahrheit die Ehre geben, sie sahen total cool aus in diesen Uniformen, auf ihren Motorrädern, entspannt, wie Models auf Straßenreklamen. Den Arabern werden wir nie verzeihen, wie sie aussehen, mit diesen Bartstoppeln und den braunen Schlaghosen, mit ihren unverputzten Häusern, dem Abwasser in offenen Gossen und den Kindern mit Gerstenkorn im Auge, aber dieses helle, saubere europäische Äußere möchte man gern imitieren."
Nicht nur an diesen Stellen, an denen Yishai Sarid den Bogen vom Holocaust zur politischen Gegenwart schlägt, liest sich sein Buch wie ein bitterböser Kommentar, wie eine Abrechnung mit der Erinnerungskultur seines Landes. Den Höhepunkt erreicht diese Kritik mit den Vorbereitungen zu einer Gedenkveranstaltung, die aus Anlass des 75. Jahrestages der Wannseekonferenz organisiert werden soll. Der Erzähler wird gebeten, mit einer kleinen Delegation ein für die Feierlichkeiten geeignetes Lager in Polen zu suchen. Eine Zeremonie soll dort stattfinden, aber nicht in Form einer Parade, sondern einer "echten simulierten Operation", bei der Juden von israelischen Kampfsoldaten vor dem Tod gerettet werden. Der Erzähler sieht diesen Plan bald als "Choreographie" vor Augen, die auf gespenstische Weise an jenes Holocaust-Computerspiel erinnert, das ein paar junge Leute zur selben Zeit in Israel entwerfen ("Die Leute mögen grausame Spiele") und für das ebenfalls sein Rat eingeholt wurde: "Ein landender Hubschrauber wirbelt Staub auf, kräftige Soldaten springen geschmeidig heraus und bemächtigen sich mit kriegstänzerischen Schritten des Lagers, offenes Gelände, bebautes Gelände, rennen voll bewaffnet die Lagerpfade entlang, gegen einen unsichtbaren Feind, um der Asche Leben einzuhauchen." So verkommt die Erinnerung zur Performance. Woran niemand Anstoß zu nehmen scheint außer dem Erzähler, der mit seinem Fachwissen zu den Details der Massenvernichtung dieser Entwicklung paradoxerweise stets zu Diensten war.
Das bleibt nicht ohne Folgen. Im alltäglichen Umgang mit ihnen sickern die Details über das Grauen nach und nach tief in sein Denken und setzen einen Prozess der psychologischen Zerrüttung in Gang, der letztlich zum Kontrollverlust führt. Yishai Sarid erweist sich auch hier als ein Meister der Andeutungen. Es beginnt mit Kleinigkeiten, die aber obsessive Kräfte entfalten, etwa wenn sich der Erzähler beim Hören der Musik von Bach plötzlich fragt, ob dieser vor dreihundert Jahren wohl einen Klezmer aus Polen als Schüler angenommen hätte oder ob er auch ein Antisemit war. Bei seinen Führungen verliert er immer häufiger den Faden, beschreibt überausführlich, wie den jüdischen Frauen die Haare geschoren wurden und die Schädel bluteten. Und verliert völlig die Fassung, als die Wälder zu ihm zu sprechen beginnen, er Schemen sieht und ein Kind seine Mutter auf dem Weg in die Gaskammern fragen hört: Mama, warum ziehst du dich aus?
Schließlich, als er einem deutschen Dokumentarfilmer, der ihn verhöhnt und benutzt, in Treblinka ins Gesicht schlägt, ertappt man sich als Leser bei dem Gedanken, dass es genau den Richtigen trifft (nämlich einen Deutschen) und dass der Erzähler endlich das Richtige tut (er wehrt sich) - bis einem klar wird, dass man mit diesen Gedanken genau dort ist, wo Yishai Sarid seine Leser haben will: Er macht sie selbst zu Monstern. Er lässt sie auf ebenso virtuose wie furchterregende Art am eigenen Leib erfahren, dass die Erinnerung an den Holocaust vor nichts und niemandem haltmacht.
LENA BOPP
Yishai Sarid: "Monster".
Roman.
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. Verlag Kein & Aber, Zürich 2019. 176 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main