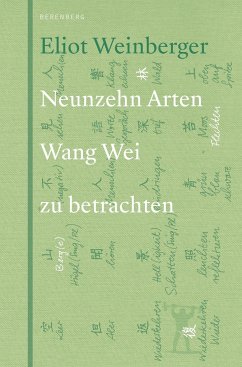Auf so klare wie elegante Weise führt Eliot Weinberger in diesem originellen Buch die Schwierigkeiten (und die Notwendigkeit) von Übersetzung vor. Er präsentiert ein einziges kurzes Gedicht aus der Tang-Dynastie in unterschiedlichen Übersetzungen - von einer wörtlichen Aufschlüsselung der chinesischen Schriftzeichen bis zu freien zeitgenössischen Interpretationen amerikanischer Dichter und ausgewählten internationalen Übertragungen. "Eliot Weinbergers äußerst prägnante Kommentare", schreibt der Nobelpreisträger Octavio Paz in seinem Nachwort, "zu den Übersetzungen dieses kleinen Gedichts von Wang Wei illustriert nicht nur die Entwicklung der Übersetzungskunst in der Moderne, sondern auch die Wandlung des poetischen Empfindens." Ein unverzichtbarer Klassiker für jeden, der sich für Sprache und literarische Übersetzung interessiert.

Zeichen zum Wundern: Eliot Weinberger prüft die Übersetzungen eines Gedichts von Wang Wei
Es sind nur zwanzig Zeichen in vier Zeilen, in denen es darum geht, dass Sonnenlicht auf Moos fällt. Doch dem New Yorker Essayisten Eliot Weinberger (unvergessen sein aufrührender "Lettre"-Text "Was ich hörte vom Irak" aus dem Jahr 2005) gelingt es in einem kleinen genialen Buch, dieses berühmte, aber unscheinbare chinesische Gedicht aus der Tang-Zeit (gut zwölfhundert Jahre alt) zum exemplarischen Fall der Übersetzbarkeit zwischen Kulturen überhaupt zu machen.
Die zwanzig Zeichen sind gut gewählt, denn diese Verse des buddhistischen Malers und Dichters Wang Wei sind auch ein Beispiel dafür, dass die Lektüre eines Gedichts einen ganz anderen Status haben kann als den des ästhetischen und intellektuellen Wohlgefallens, das etwa Europäer von ihr erhoffen. Weinberger schreibt nun keine systematische Abhandlung darüber, sondern reiht einfach in kurzen Kapiteln das chinesische Original, die Umschrift in lateinischen Buchstaben, eine Interlinearübersetzung aller einzelnen Zeichen und dann sechzehn verschiedene Übertragungen aneinander, vor allem ins Englische, aber auch ins Französische und Spanische. So werden all die verschiedenen Zwischenphasen, die beim bloßen Lesen einer Übersetzung unterschlagen werden, sichtbar. Dem Autor ist es wichtig, dass auch der Sprachunkundige sich den unmittelbaren Eindruck vor Augen führt, den die Schriftzeichen selbst auf den Betrachter machen:
Weinberger weist darauf hin, dass im klassischen Chinesisch jedes Schriftzeichen ein Wort darstellt, doch nur ein Teil von ihnen bildhaft ist. Im zweiten Zeichen der ersten Zeile kann man zum Beispiel einen Berg sehen, im letzten Zeichen derselben Zeile einen Menschen. Das vierte Ideogramm der ersten Zeile war Ezra Pounds Lieblingszeichen: Er wollte darin ein Auge auf Beinen erkennen, und tatsächlich ist es das Zeichen für "sehen".
Gleich eingangs nimmt das im englischen Original schon 1987 erschienene Buch sich vor, den Wanderungen und Verwandlungen durch die Zeiten und Kulturen nachzugehen, die ein Text in all seinen Übersetzungen unternimmt: "Was geschieht, wenn aus einem einst chinesischen und nach wie vor chinesischen Gedicht ein Stück englischer, spanischer, französischer Dichtung wird?" Doch wenn man nun eine beschaulich-wohlwollende Blütenlese erwarten würde, hätte man sich getäuscht. Weinberger schreckt nicht vor harscher Kritik an Verfälschungen und Missdeutungen zurück; genau genommen überwiegen solche Aburteilungen sogar. Zu einem Versuch aus dem Jahr 1929 zum Beispiel meint er, dessen chinesischer Dichter schreibe "aus den flüchtigen Nebeln einer tastenden Halbwahrnehmung heraus", so als betrachte er "die Welt durch einen Opiumschleier". Solche Deutungen erregen wohl vor allem deswegen Weinbergers Zorn, weil sie dann wieder als Beweis für den angeblich "mystischen, unergründlichen Osten" herhalten.
Das Original dagegen ist von äußerster Genauigkeit und Konkretion. Eine Übertragung, die Weinbergers Gnade findet, ist die von Gary Snyder aus dem Jahr 1978: "Jedes Wort Wangs wurde übersetzt, nichts hinzugefügt, und doch besteht die Übersetzung als amerikanisches Gedicht".
Empty mountains:
no one to be seen.
Yet - hear -
human sounds and echoes.
Returning sunlight
enters the dark woods;
Again shining
on the green moss, above.
Gary Snyders Übertragung ist ein Beispiel für die völlig unwahrscheinliche und unerwartbare Nähe, die vor allem amerikanische Modernisten des zwanzigsten Jahrhunderts, von Ezra Pound bis William Carlos Williams, zu den alten chinesischen Dichtern empfanden. Sie entdeckten in ihnen, schreibt Weinberger, die "absolute Präzision, Prägnanz und die Verwendung alltäglicher Sprache", die sie selbst anstrebten. Der Titel des Buchs, "Neunzehn Arten Wang Wei zu betrachten", ist wohl selbst eine Hommage an einen dieser amerikanischen Neuerer, Wallace Stevens und dessen Gedicht "Thirteen Ways of Looking at a Blackbird".
Bei dem Beat-Poeten Gary Snyder mag hinzugekommen sein, dass er sich auch als Liebhaber der Wildnis und als Buddhist dem Chinesen Wang Wei nahe fühlt. Denn anders als die meisten Übertragungen das nahelegen, ist das Gedicht alles andere als eine Naturidylle, die sich in romantische Vorstellungen von Waldeinsamkeit einpassen ließe, wie sie speziell in Deutschland beliebt waren; auch die Einführung eines Ichs, das sich in der Natur spiegeln will, führt in die Irre. Ein Subjekt spielt in dem Original vielmehr gar keine Rolle; Menschen kommen in diesem Augenblicksbild nur als Echos von Stimmen vor, Teil der Natur wie alles andere und insbesondere wie das plötzliche Leuchten eines Sonnenstrahls auf einem Stück Moos. Es ist ein Augenblicksbild reiner Gegenwärtigkeit und kann insofern als ein Vollzug dessen gelesen werden, was Buddhisten als Zustand der Leere anstreben - und dies völlig unangestrengt und beiläufig, ohne auch nur im Geringsten eine religiöse Sondersprache zu benutzen. Eine solche Art Präsenzerzeugung lässt sich in eine andere Sprache wohl kaum übertragen.
Großartige Neuerfindungen dagegen sind möglich. Unter den zehn weiteren Übersetzungen, die ein Anhang für Weinbergers Neuausgabe von 2016 umfasst (auch der aus der Tiefe des deutschen Waldes sprechende Günter Eich ist dabei: "Die waldigen Berge liegen / verlassen, menschenleer. / Nur Stimmen höre ich schallen / von irgendwoher"), findet sich der kühne Versuch des amerikanischen Sinologen David Hinton, der mit einem Zeilensprung einen Eindruck von der Dichte des Originals gibt: "Entering these deep woods, late sun- / light ablaze on green moss, rising." Je mehr man sich auf die Eigenarten der unterschiedlichen Angänge einlässt, desto mehr kann man Weinbergers Behauptung zustimmen: "Beim Übersetzen von chinesischer Lyrik, wie bei allem andern, ist nichts schwieriger als Einfachheit."
Der deutsche Band bietet außerdem einige eigens für diese Ausgabe in Auftrag gegebene Nachdichtungen deutschsprachiger Autoren, von Ulrike Draesner über Michael Krüger bis zu Ilma Rakusa. Ein Spiel kommt so in Gang, an dem mit Hilfe der Interlinearübersetzung der Zeichen auch jeder Leser teilnehmen kann, um sich mit seiner eigenen Übersetzung in den Strudel der Kulturen und Bedeutungen zu werfen, ein großer Spaß.
MARK SIEMONS
Eliot Weinberger: "Neunzehn Arten Wang Wei zu betrachten".
Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender. Mit einem Nachwort von Octavio Paz. Berenberg Verlag, Berlin 2019. 112 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

eine Amsel
Eliot Weinberger plädiert für die
Auflösung des Übersetzer-Egos
Für die Dichterin Elke Erb sind Gedichte Lebewesen. Selbständige Geschöpfe, die nach Aufmerksamkeit verlangen, mit eigenen Körpern und Bedürfnissen. So ist es nur konsequent, wenn der amerikanische Essayist Eliot Weinberger auch Übersetzungen als lebendige Organismen betrachtet. Original und Übersetzung verhalten sich für ihn ein wenig wie Elternteil und Kind. Die übersetzten Gedichte schleichen sich in die Köpfe ihrer Leser ein, zetteln im glücklichsten Fall Gedanken an, manche hängen zu sehr am Original, „andere proben unablässig den Aufstand“.
Was für Geschöpfe sind Übersetzungen eigentlich, lautet die Grundfrage seines Bändchens „Neunzehn Arten, Wang Wei zu betrachten“. Im Mittelpunkt steht ein kleines Gedicht des chinesischen Dichters Wang Wei aus dem 8. Jahrhundert, vier Zeilen, eine Überschrift. Weinberger lehnt sich mit seinem Bekenntnis zu Variationen lose an Wallace Stevens’ Zyklus „Dreizehn Arten, eine Amsel zu betrachten“ an, der so beginnt: „Unter zwanzig Schneegipfeln / regte sich einzig / das Auge der Amsel.“ In Wang Weis Gedicht indes ist „niemand zu sehen“, nicht einmal eine Amsel, es gibt nur einen Berg, einen Wald und das Licht der untergehenden Sonne, das auf etwas Moos fällt.
Aber heißt es wirklich „etwas Moos“? Und „gibt es“ den Berg einfach – oder ist er nicht doch eher durch das Auge eines impliziten Betrachters anwesend, der ihn wahrnimmt?
Mit solchen Fragen ist man schon mitten in der Übersetzung, um die sich bei Weinberger alles dreht. Das fängt beim klassischen Chinesisch an, in dem das Gedicht geschrieben ist. Stellt hier ein Schriftzeichen tatsächlich ein Wort dar? Ist es bildhaft zu verstehen? So spinnen sich die Fragen fort, von der Transliteration in modernes Chinesisch bis zu Schreibtraditionen, die im Hintergrund wirksam sind: „Chinesische Lyrik basierte auf der genauen Beobachtung der fassbaren Welt.“ Wie unterschiedlich die Übersetzung sein kann, zeigt allein der Titel: „Hirschgatter“, „Hirschpark-Einsiedelei“, „Tief in der Bergwildnis“ oder schlicht „Der Wald“.
Das Buch ist 1987 erstmals erschienen, Weinberger hat es stetig um neue Arten erweitert. Nun kann man es in einer hübschen kleinen Ausgabe auch auf Deutsch lesen, von Beatrice Faßbender sehr schön übertragen.
Es ist ein Bändchen, das klug, komisch und überaus lehrreich ist. Man möchte es jedem Übersetzer, gerade von Lyrik, dringend ans Herz legen. Nahezu chronologisch geht Weinberger die verschiedenen Übersetzungsversuche durch. Und spart nicht mit bissigen Bemerkungen, wenn ihm etwas nicht gefällt. „Langweilig, aber einigermaßen direkt“, gehört da noch zu den höflicheren Varianten. Andernorts heißt es: „Für mich klingt das wie Gerard Manley Hopkins auf LSD.“ Oder: „In dieser Übertragung scheint Wang die Welt durch einen Opiumschleier zu betrachten, gespiegelt in hundert weingefüllten Fingerhüten.“
Dabei sind die kleinen Kommentare kein Selbstzweck. Weinberger zeigt, wie sich die Prägung durch die jeweilige Zeit oder poetologische und persönliche Vorlieben der Übersetzer hinterrücks in jede Übersetzung einschreiben. Vor allem aber geht es ihm um so etwas wie das Wesen oder die Kunst des Übersetzens.
Der Dichter H. C. Artmann hat einmal eine „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen actes“ geschrieben. Mühelos ließe sich aus Weinbergers Sätzen eine „Acht-Punkte-Proklamation des übersetzerischen actes“ destillieren. Einer der wichtigsten Punkte darin wäre: „Übersetzung – eine eigene Art spiritueller Übung – hängt von der Auflösung des Übersetzer-Egos ab: eine unbedingte Demut vor dem Text. Eine schlechte Übersetzung ist die aufdringliche Stimme des Übersetzers.“
Natürlich ist auch Weinbergers Idee vom Übersetzen relativ. Es gibt andere Vorstellungen, die das Persönliche des Übersetzers und die Angleichung an die jeweilige Gegenwart viel stärker betonen würden. So findet man auch in den Übertragungen, zu denen Beatrice Faßbender elf deutschsprachige Autorinnen und Autoren eingeladen hat, ganz unterschiedliche Stimmen. Manche von ihnen sind sehr nah am Original, manche würden sich mit ihrem Versuch der Aktualisierung vermutlich die eine oder andere kritische Bemerkung Weinbergers einhandeln.
Aber es sind eben verschiedene Ansätze. Hans Thills „spitzes moos“ kann einen beim Lesen so begeistern wie Uljana Wolfs „moosdisplay („Alle Angaben ohne Geweih.“). Also auf nach Hirschheim, wo in Dong Lis Übersetzung die Abendsonne durch den dichten Wald bricht, „in blühendem Grün“!
NICO BLEUTGE
Eliot Weinberger:
Neunzehn Arten Wang Wei zu betrachten.
Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender. Mit einem Nachwort von Octavio Paz.
Berenberg Verlag, Berlin 2019. 112 Seiten, 18 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de