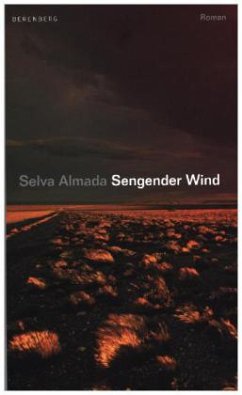Weit, trocken und öde ist die Pampa. Wer hier liegen bleibt, für den ist guter Rat teuer. Auch für Menschen mit direktem Draht zu Gott, wie den Prediger samt schlecht gelaunter Tochter und übler Familiengeschichte, dessen Wagen den Geist aufgibt. Zum Glück auf dem Schrottplatz eines alten Gringo, der im Verlauf eines Tages und einer Nacht nicht nur das Auto repariert. Umtost von einem nächtlichen Unwetter trägt er mit seinem ungebetenen Gast einen Zweikampf aus, während sich zwischen seinem schweigsamen Sohn und der Tochter des Gottesmannes ganz andere Beziehungen anbahnen.
Ein Roman aus Argentinien - klar und trocken wie die Gegend, in der er spielt, geschrieben in einer lakonischen, wunderbar unverputzten Prosa.
Ein Roman aus Argentinien - klar und trocken wie die Gegend, in der er spielt, geschrieben in einer lakonischen, wunderbar unverputzten Prosa.

Selva Almada ist die Bildhauerin der argentinischen Literatur: Jetzt ist ihr aufregendes Debüt "Sengender Wind" zu entdecken
Alles an dem Debüt der argentinischen Schriftstellerin Selva Almada wirkt konzentriert und präzise. Nur 128 Seiten umfasst der Roman, seine Sprache ist klar, seine Bildlichkeit prägnant, sein Fokus richtet sich streng auf ein Figurenquartett, seine Handlung beschränkt sich auf die Begegnung dieser vier, die sich ihrerseits im Laufe eines Tages und einer Nacht abspielt, sein Handlungsort könnte schlichter kaum sein. "Sengender Wind" spielt in einer abgelegenen Autowerkstatt irgendwo im Nichts. Extrem öde geht es in der unendlich weit wirkenden Landschaft zu, und doch ist sie auch unendlich fruchtbar. Keine zehn Pferde würden einen Einwohner von Buenos Aires dazu bringen, einen Fuß in dieses leergefegte Nirgendwo zu setzen, dessen Fruchtbarkeit zugleich das Land ernährt.
Extrem karg, unglaublich poetisch, so könnte auch das Motto für Selva Almadas Schreiben lauten. Aus der Provinz Entre Ríos stammend, seit Jahren in Buenos Aires lebend, ist sie die Bildhauerin der argentinischen Literatur. Sie bearbeitet und schleift ihr Material so lange, bis sie das Wesentliche herauspräpariert hat. Ihre Poetik radikaler Verknappung hat ihr das schöne Paradoxon eingehandelt, es komme in ihren Romanen mehr darauf an, was sie wegstreiche, als auf das, was tatsächlich stehenbleibe. Das trifft zwar ins Schwarze, stimmt aber auch nicht ganz. Natürlich kommt es bei Literatur darauf an, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Aber anders als bei Bildhauern entsteht keine monolithische Skulptur, sondern eine löchrige, poröse Textur, in deren Leerstellen sich die Einbildungskraft der Leser einnisten kann. Romane müssen manchmal zwar als Lückenbüßer herhalten, vor allem aber sind sie Lückenbegrüßer. Selva Almada ist eine Meisterin der Lückenpflege.
In eine unerzählte Lücke fällt bereits der Anfang des Romans. Als die Erzählung einsetzt, haben sich seine vier Protagonisten schon längst gefunden. Auf der einen Seite sind das der evangelikale Wanderprediger Reverend Pearson und seine fünfzehnjährige Tochter. Seit der Reverend eines Tages Lenas Mutter auf der Straße hat stehenlassen, ziehen Vater und Tochter gemeinsam von Stadt zu Stadt. Reiseroute und Dauer des jeweils Aufenthalts bleiben der göttlichen Führung überlassen. Man braucht keine große Phantasie, um zu ahnen, dass so ein gottergebenes, von Dauerpredigt und Missionarseifer geprägtes Leben eine Fünfzehnjährige nur in Maßen begeistert.
Auf der anderen Seite steht der Automechaniker Gringo Brauer mit seinem elfjährigen Gehilfen Tapoica. Auch sie strahlen eine seltsame Schicksalsergebenheit aus. In ihrer Autowerkstatt tun sie, was an Autoreparaturen getan werden muss. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Merkwürdige Gelassenheit strahlt schon der Moment aus, an dem die beiden zusammengekommen sind: Eines Tages steigt eine Frau vor der Werkstatt aus einem Laster. Während ihr achtjähriger Junge beginnt, mit den Hunden zu spielen, erklärt sie dem Mechaniker knapp, dass der Junge sein Sohn sei und sie nicht vorhabe, ihn weiter zu versorgen. Jetzt sei eben Brauer dran. Der Junge bleibt und ist seither Brauers Gehilfe. Von der Vaterschaft weiß er nichts. Aber die beiden haben sich in ihrer einsamen Zweisamkeit denkbar gut eingerichtet.
Was passiert an diesem einen Tag? Die einen haben eine Panne, die anderen eine Werkstatt. Während Brauer am Motor schraubt, kann es der Reverend nicht lassen, dem Jungen die Verlockungen des Glaubens vor Augen zu stellen. Ein Reparaturangebot kommt selten allein. Und Tapoica und Lena merken ihrerseits schnell, dass sie mehr teilen, als die Lücke, welche die fehlende Mutter jeweils in ihr Leben gerissen hat. Die Kargheit des Plots steht im Kontrast zur Fürsorge, mit der Selva Almada den Gedanken und Gefühlen ihrer vier Figuren nachgeht. Almada erschafft eindringliche Erinnerungsszenen, die ein merkwürdiges Konzentrat von höchstem Pathos und unterkühlter Beiläufigkeit bilden. Der Reverend, von dem zudem drei Predigten im Wortlaut in die Handlung eingelegt sind, ruft sich die verstörenden Momente seiner eigenen Flusstaufe in Erinnerung, umkreist jenen Moment seiner Kindheit, als er den Selbstmord des damaligen Nachbarn entdeckte, oder entspinnt rosige Zukunftsszenarien, wenn er nur erst Tapoica missioniert habe. Der schweigsame Brauer steuert unter anderem die Geschichte bei, wie sich einst zwei Gringos in der Kneipe seiner Eltern an die Gurgel gingen, und bei Tapoica und Lena kehren die Gedanken immer wieder zum Verlust der Mutter zurück.
"Sengender Wind" könnte ein Vater-Kind-Roman sein, würden die abwesenden Mütter nicht die heimliche Hauptrolle spielen. Bei aller Annäherung an das Innenleben bleiben die vier Figuren so fremd, dass sie einen in Bann schlagen. Es gibt diese Tage, an deren Morgen man schon spürt, dass sich die Spannung am Abend in einem Gewitter entladen muss. In Entre Ríos beginnen viele Tage mit diesem Gefühl, ohne dass das ersehnte Gewitter tatsächlich eintritt. So staut sich die Hitze auf bis zu jenem Tag, an dem sich Pearson, Brauer, Lena und Tapoica begegnen. Deren Emotionen erhitzen sich ihrerseits, bis am Abend endlich das erlösende Gewitter eintreten müsste. Oder bleibt es nur beim "sengenden Wind", der über das Land weht? So viel ist klar: Als die vier am nächsten Morgen wieder ihrer Wege gehen, wird nichts passiert sein, und doch ist alles verändert.
Selva Almadas Debüt ist eine luzide philosophische Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen der Reparatur. Der Roman macht eine Kulturtechnik stark, die in der Wegwerfgesellschaft zurückgedrängt scheint. "Sengender Wind" spielt durch, was passiert, wenn man sich wie der Monteur oder der Priester dem maroden oder verwundeten Material annimmt, um es mit einer Schweißnaht oder einem heilenden Wort wieder in Ordnung zu bringen. Der Roman interessiert sich für das seltsame Hybrid, das aus Reparatur entsteht, weil sich ein Material mit einem anderen verbindet. Das ist nicht nur eine Motoren- oder Seelenfrage, sondern zugleich eine Frage der Kultur. Um ein kulturelles Hybrid handelt es sich auch bei der Landschaft nordöstlich von Buenos Aires, die einst - Brauers Name spielt darauf an - von Belgischen Einwanderern geprägt wurde. Nach Almadas Roman ist auch Einwanderung letztlich eine Reparaturangelegenheit und damit eine Frage nach den Rissen und Wunden.
In Argentinien hat Almadas Roman den Nerv ihrer Zeit getroffen. Da ihr zudem das seltene Kunststück gelungen ist, direkt im Anschluss an ihr Sensationsdebüt von 2012 mit "Ladrilleros" (Die Ziegelbrenner) und "Chicas muertas" (Ermordete Mädchen) zwei weitere Bücher von Gewicht folgen zu lassen, ist sie in kürzester Zeit zu einer der gefragtesten Autorinnnen des Landes aufgestiegen. Verglichen wird ihr Schreiben seither mit dem der großen Einzelgängerinnen der amerikanischen Literatur wie Flannery O'Connor oder Carson McCuller. Kurzzeitig flammte sogar ein Streit auf, ob eine Frau überhaupt so kühl schreiben dürfe. Oder ob die Hemingway-Tradition nicht doch Männern vorbehalten bleiben solle.
Im deutschsprachigen Raum wirkt "Sengender Wind" wie ein wundersames Hybrid aus Rolf Lapperts gefühlvollem Adoleszenzroman "Pampa Blues" und Klaus Merz' Romankonzentrat "Der Argentinier". In jedem Fall ruft der Roman in Erinnerung, dass es poetische Schönheit gibt, die aus radikaler Verknappung erwächst. Wenig schreiben, viel erzählen, darauf versteht sich dieses kurzweilige wie eindringliche Romandebüt.
CHRISTIAN METZ
Selva Almada: "Sengender Wind". Roman.
Aus dem Spanischen von Christian Hansen.
Berenberg Verlag,
Berlin 2016. 128 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
In Selva Almadas Roman "Sengender Wind" treffen zwei Väter inmitten der argentinischen Wüste aufeinander, die sich ihren Kindern nur ungeschickt und vermittelt durch ihre Profession nähern können, erzählt Rezensentin Sonja Stöhr. Der eine von ihnen, Reverend Pearson, ist Wanderprediger und möchte Tapioca, den gutgläubigen Sohn des Mechanikers Gringo Bauer, zu einer Priesterlaufbahn überreden. Gringo Bauer dagegen hat für Religion nichts übrig. Während beide Männer um die Laufbahn und das Seelenheil des Jungen buhlen, hat Elena, die Tochter des Reverends, für den Glauben ihres Vaters nur Verachtung übrig. Stöhr entwickelt kein Urteil zu dem Roman, doch liefert er ihr einen "Schnappschuss" auf einen kargen, unbekannten Landstrich Argentiniens. Das muss man wohl als karges Lob verbuchen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH