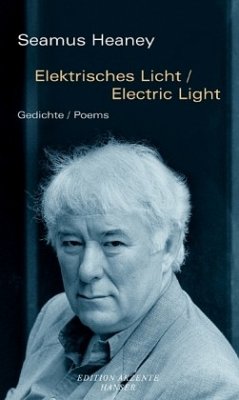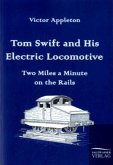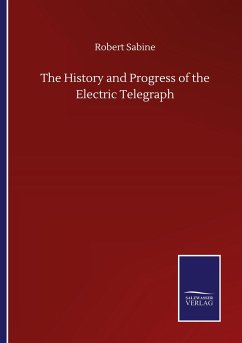Irische Sagen und Legenden, Räubergeschichten und Räuberpistolen, Eklogen und Elegien, Epigramme und Scherzgedichte, Meditationen und liebevolle Nachrufe auf die Weggefährten Joseph Brodsky, Zbigniew Herbert und Ted Hughes - der neue Band von Seamus Heaney zeigt alle sprachlichen und metrischen Möglichkeiten, für die der irische Dichter und Nobelpreisträger bekannt ist und verehrt wird. Und immer wieder Erinnerungen an die Kindheit, als plötzlich das elektrische Licht die dunklen Ecken der bäuerlichen Welt ausleuchtete, an die Schule, die Reisen, das Vertrautwerden mit der dichterischen Tradition. Die poetische Summe eines Dichters, dessen Werk wie kein anderes die Notwendigkeit und den Reichtum der Poesie in einer unpoetischen Welt bezeugt.

Strom der Zeit: Seamus Heaneys lichte Lyrik / Von Tobias Döring
Der Titel täuscht. Zwar mag "Elektrisches Licht" - nach "Die Hagebuttenlaterne" oder "Die Wasserwaage", wie sein zuerst und sein zuletzt auf deutsch erschienener Gedichtband hießen - als Hinweis auf urbane und künstlich angestrahlte Lebenswelten gelten. Doch bei der Lektüre zeigt sich bald, daß Seamus Heaney auch in dieser neuen Sammlung, seiner elften, der oft bezeugten Vorliebe für ländliche Lokalitäten, abseits des Stroms von technischer Modernisierung, treu geblieben ist. Ein "Stall-Kind" sei er, lesen wir, ein Dichter, der "die Merkmale des Bodens" mit Worten abschreitet, "die einem das Gefühl geben, / Im Wort ,trittsicher' Tritt zu fassen, / Und auch im Grund des eigenen Verstehens". Diesen Grund findet Heaney seit jeher in seiner nordirischen Kindheitslandschaft Derry, deren Schichten er mit seinen Verszeilen durchpflügt und erinnernd oder forschend umgräbt. Das Bedeutende seiner Lyrik aber liegt darin, wie sie das so Geborgene wandelt und die handgreifliche Substanz der Sprache in weltumspannende Denkbilder weitet. Denn Heaneys Bodenständigkeit ist stets beharrlich, nie behaglich und geht in seinen besten Texten mit so gelassener Weltläufigkeit einher, daß die feste Erdung jeden Versfuß erst zu weitreichender Beziehungsfülle führt.
So hat das "elektrische Licht" des Titelgedichts, das in der Erinnerung an ein großmütterliches Bauernhaus aufscheint, nichts grell Erhellendes, sondern eher etwas Magisches, wenn es - ganz wie das alte Radio mit seinen leuchtenden Skalen und wundersamen Lauten - eine randständige Lebenswelt auf geisterhafte, zugleich sinnlich erfahrbare Weise mit anderen, fernen Welten in Verbindung bringt. 1995 eröffnete Heaney seine Nobelpreisrede im Nachsinnen über diese Kindheitsszene, als ihm zum ersten Mal der Name Stockholm in den Ohren klang. Jetzt, da er den neuen Gedichtband damit schließt, ist sein Gestus eher bestaunend als beschwörend und hält meisterlich Balance zwischen der beglückenden Vergegenwärtigung von Herkunftsmomenten und ihrer unweigerlichen Distanzierung im Gedächtnisakt unserer "verlaufenden" Gegenwart. "Der Raum, aus dem wir kamen, ich und die andren, / Bleibt reine Wirklichkeit, in der ich für mich steh, / Den Strom der Zeit ausstehend."
Die Zeilen entstammen einem der eigenwilligsten und einprägsamsten Texte der Sammlung: "Aus der Tasche" beginnt mit der minutiösen Erinnerung an die unheimliche Doktortasche, die im Elternhaus auftaucht, bevor ein neues Familienmitglied zum Vorschein kommt; diese kindliche Verständigung über den rätselhaften Geburtsvorgang überlagert sich mit irritierenden Momentaufnahmen eines viel späteren Geschehens beim Besuch im griechischen Epidauros, wo die flirrende Mittagshitze derartige Erscheinungen gebiert. So verschränkt Heaney das Erinnerte mit den Bedingungen, die es hervortreiben, und befragt seine poetischen Gesichter und Geschichten hartnäckig auf ihre verborgene Herkunft.
All dies geschieht in souveräner Nutzung und Anverwandlung klassischer dichterischer Formen, wie es schon Titel dieser neuen Sammlung - "Ekloge aus Glanmore", "Sonette aus Hellas", "Die kleinen Lobgesänge von Asturien" - vielfach anzeigen. Der Tonfall ist oft spielerisch, manchmal anekdotisch - bespielsweise im skizzenhaften Porträt von Hans Magnus Enzensberger "in Panama und Roh- / Leinenanzug, wie aus dem Ei gepellt. Ihm läßt / Man's durchgehen" - und doch durchgehend von leiser Melancholie grundiert. Dabei fällt auf, daß diesmal dem Theater und seiner Umformung von Identitäten besondere Bedeutung zugemessen wird. Ein Schlüsselgedicht heißt "Die richtigen Namen" und ist Brian Friel gewidmet, dem irischen Dramatiker, mit dem Heaney in den achtziger Jahren die Theatergruppe "Field Day" führte und zu einer der wichtigsten Plattformen zur Auseinandersetzung um postkoloniale Kultur- und Erinnerungsarbeit machte. Das Gedicht schildert zwar frühere Bühnenszenen, zumeist Bruchstücke von Shakespeare-Dramen, jedoch geht es mit der dramatischen Erkundung solcher "Englandromantik" demselben zentralen Problem nach, der Frage, wie ein irischer Autor sich verhält zum Erbe des englischen Literaturkanons, das ihm mit der Sprache aufgegeben ist. Die "Wechselbälger" auf der Bühne mögen da für den Versuch einstehen, den unvergessenen Figuren alter Dichtung probehalber neue Statur zu verleihen, ohne die Differenz zum eigenen "Namen", der auch anderen Traditionen zugehört, aus dem Gedächtnis zu verlieren.
Vor drei Jahren ist Heaney ebendies mit seiner Neudichtung des angelsächsischen Heldenliedes "Beowulf" großartig gelungen. Spuren davon durchziehen auch die aktuelle Sammlung, zumal ihren zweiten Teil, der eine Reihe von poetischen Nachrufen und Elegien auf den Tod großer Dichterfreunde wie Ted Hughes oder Joseph Brodsky enthält. In der weiten Echokammer geisterhafter Dichterstimmen, die sich hier begegnen und durchkreuzen, klingt sogar das alte nordische Kriegsepos weniger nach Schlachtenlärm und Racheschwüren als nach dem gewaltigen Trauer- und Klagegesang, der es immer auch ist. "Schon im Beowulf", heißt es hier im Gedenken an den verstorbenen englischen Poet Laureate Hughes, "Ist das Betäubende des Wehs, das Herzhärmende / Versteckten Leids das Beste am Gedicht".
Für viele deutsche Leser ist sicher das Beste am vorliegenden zweisprachigen Gedichtband, dem Erfindungsreichtum und subtilen Deutungsvermögen nachzuspüren, mit dem Giovanni und Ditte Bandini diesen Texten eine deutsche Gestalt verliehen haben. Auch wenn sie mitunter einen etwas hohen Ton anschlagen, der Heaneys unangestrengte Sprachkraft zuweilen übersteigt (der Konjunktiv "vermöchte" beispielsweise gehört, obwohl grammatisch korrekt, in ein höheres Register), muß das bewährte Übersetzerpaar als Glücksfall für Lyrikübertragungen gelten, die so schöpferisch wie kenntnisreich und mutig mit dem Original zu Werke gehen. Und wenn sie an einer Stelle den Ausdruck "translator" mit "Kenner" wiedergeben, darf man dies getrost als Selbstbeschreibung nehmen. Ihre Kennerschaft bezeugen nicht zuletzt die zahlreichen Anmerkungen, die sie den Gedichten beigeben - wenngleich sie hier, wo diese über Worterklärungen hinausgehen, des Guten auch zu viel tun: wenn Anklänge an Bibelstellen oder andere Anspielungen sorgsam protokolliert und mit Versangabe nachgewiesen werden, dämpft das womöglich die Entdeckerlust von Lesern, die den vielstimmigen Verbindungen der Gedichte eigensinnig folgen wollen.
Denn in ihren tastenden, oft mehrfach wiederholten Annäherungen an einen konkreten Gegenstand zeigen Heaneys Texte sich schon selbst als Übersetzung und als ein Versuch, das sinnlich Wahrgenommene der Welt in Worte einzufangen: "Sie standen. Sie standen für etwas . . . / Abwartend. Nicht verfügbar. Aber da / Gewiß. Unbeugsam, selbstgewiß." Was hier beschrieben oder, im magischen Wortsinn, besprochen wird, sind Lupinen, wie der Titel sagt. Doch bei aller Präzision, mit der die folgenden Verse sie entwerfen, vermittelt das Gedicht zugleich die stete Gewißheit, daß jene Blumen auch etwas ganz anderes darstellen, das der Sprache unzugänglich bleibt. Daraus ergibt sich der elegische Grundton dieser Sammlung, aber wohl auch ihre Zuversicht in unbeugsame Wirklichkeiten jenseits gängiger Begriffe. Das Titelgedicht jedenfalls schließt mit der Vorstellung daran, wie die Großmutter im "Derry-Grund" begraben ruht. Im Andenken an sie und die vielen anderen Toten, die in diesem wunderbaren Band bedacht werden, wird letztlich Heaneys "Elektrisches Licht" zu einer Erscheinungsform von "lux perpetua", da es unseren begrenzten Grund und Boden gewiß mit einer weiteren, wenn auch unverfügbaren, Welt verbindet.
Seamus Heaney: "Elektrisches Licht / Electric Light". Gedichte / Poems. Zweisprachige Ausgabe. Aus dem Englischen übersetzt von Ditte und Giovanni Bandini. Hanser Verlag, München 2002. 173 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Seamus Heaney entzündet ein Licht und bleibt sich treu
Im letzten Gedicht, das dem neuen Bändchen den Titel geliefert hat, sitzt ein Kind – und es ist zweifellos der 1939 in einer katholischen nordirischen Familie geborene spätere Dichter selber – neben einer alten Frau: Elektrolicht schien über uns, ich fürchtete / Den schmutzädrigen Riß und Flintstein ihres Nagels, / So plektronhart, grindglitzrig, dass er sicher / Noch zwischen Rosenkranz und Wirbeln ruht im Derry-Grund. Die Erde als letzter Ort und letztes Wort: Fast zwanghaft kehrt die poetische Einbildungskraft von Seamus Heaney immer wieder zu ihr zurück. In Deutschland, befangen gegenüber allem, was nach Herkunftsromantik klingen mag, kommt ein solches Thema nicht leicht an, zumal der Dichter auch in Vorträgen fast eigensinnig „das Einheimische an sich” („the indigenous per se”) verteidigt. Seine „Heimatdichtung” ist allerdings nie idyllisch. Vielmehr ist das Heimische durch das Gefühl des Mangels getragen: durch Armut, politische Unfreiheit und sogar durch das Fehlen einer eigenen Sprache.
In der Erde von Castledawson im County Derry westlich von Belfast verwest er jedenfalls nicht, jener zerschundene Daumennagel der traumatischen Kindheitserinnerung. Im Text steht schnoddrig: „it must still keep”. Das sollte man vielleicht doch nicht mit dem gar zu harmonischen „ruhen” übersetzen, sondern lieber so: „Da hat er sich (der Daumennagel) / Zwischen Rosenkranz und Rückenwirbeln bestimmt gut gehalten in der Erde von Derry” – eben unverweslich wie das Trauma in der Seele des vom Lampenlicht geblendeten Kindes.
Ohne dem Dichter daraus einen Vorwurf machen zu wollen, hat ein amerikanischer Kritiker hervorgehoben, dass dieses Bändchen rückwärtsgewandt sei, das Werk eines alternden Dichters. Das ist nicht falsch, auch weil viele der Gedichte den Freunden und Kollegen – und vor allem den toten – gewidmet sind. Aber eben wenn es richtig ist, war Seamus Heaney nie wirklich jung! Ihm ging es schon immer um das poetische Abarbeiten alles dessen, was unabgegolten in der Erde nicht etwa ruht, sondern versteinert auf eine Art Erlösung durch das Wort der Lebenden wartet.
Schlagen wir den Bogen zurück zum ersten Gedicht. Es heißt „Bei Toomebridge”, ein auf den ersten Blick idyllisches Wasserwehr, „wo negative Ionen unter freiem Himmel / Mir reine Poesie sind. Wie einst einmal / Der Schleim und Silberglanz des fetten Aals.” Doch da ist, dem unverweslichen Daumennagel vergleichbar, ein harter Kern: „Wo früher der Kontrollpunkt war. / Wo ’98 der Rebell gehenkt wurde.” Hierzu gibt es eine Anmerkung: Der Rebell ist Roddy McCorley, einer jener Aufrührer, die im Geiste der französischen Revolution die englische Krone bekämpften und die britischen Landeigentümer heimsuchten. Obwohl die Engländer sich scheuten, Märtyrer zu machen, wurde McCorley an der damals von den Rebellen zerstörten Brücke von Toome gehängt und „seziert”. Und das heißt: Er wurde mit heraushängenden Eingeweiden als Abschreckung zur Schau gestellt. Die Erinnerung an ihn wuchs zum Mythos.
Aber das Einheimische an sich ist keineswegs auf die Heimat beschränkt. Es erfasst, verwandelt und assimiliert schließlich jede Ferne, die poetische Ferne der Antike ebenso wie die geographische Ferne bereister Länder. Eine kleine Gruppe von Gedichten ist mit „Sonette aus Hellas” überschrieben. Sie sprechen tatsächlich von dem fernen Griechenland, aber die geographische Ferne hat hier doch immer auch eine zeitliche Dimension, welche direkt in die Antike weist. Auch sie wird heimisch, auf vielen verschlungenen Wegen, die doch alle unweigerlich in die „Gaeltacht” führen.
So bekommt auch der Parnass seinen irischen Namen! Das Sonett mit dem Titel „Pylos” evoziert zwar den momentanen Blick des Dichters vom Balkon auf das Meer, aber seine Gedanken schweifen ab, in die homerische Welt zu dem jungen Telemach, in dem er sich selber erkennt ... und zu seinem Lehrer Robert Fitzgerald, dem „Harvard-Nestor”. Ja, Pylos ist der Ort des sagenumwobenen Palastes des weisen Königs Nestor, dessen Geist, hier auf dem Balkon in Pylos, über Homer auf den Harvard-Professor und seinen Schüler überzugehen scheint.
Eine ganze neue Heimat erschließt sich der Dichter im Rückgriff auf Vergil, der gleich zu Anfang in der „Ekloge vom Bann-Tal” zu seinem ironischen Ratgeber wird. Es folgt dann eine fast wörtliche Übersetzung der IX. Ekloge in den freieren Blankvers. Keine Anspielung auf den Fluss Bann oder Lough Neagh ist hier nötig; Vergil formuliert selber jene Grunderfahrung, aus der Seamus Heaney seit seinen Anfängen dichtet: „Ein Fremder kommt und sagt, er hätt ein Anrecht / Auf unser Stückchen Land.” Was der Hirte Lycidas und der alte Knecht Moeris behalten, auch wenn das Gut ihres so schön dichtenden Herrn Menalcas konfisziert wird, sind ihre und seine Lieder. Es folgt, als ernste Parodie, die „Ekloge aus Glanmore” – und der Dichter singt, was ihm verblieben ist, das Lied, in vierhebigen Vierzeilern – hört man nicht den ältesten überlieferten englischen Kanon darin mit seinem Kuckuck? – und manchmal stellt sogar der Wunsch nach einem Reim sich ein.
Ein kürzerer, zweiter Teil des Bändchens spricht fast nur noch von Toten, zum Andenken an Ted Hughes, Joseph Brodsky, „an den Schatten Zbigniew Herberts”, dazu ein geheimnisvolles „Von Clonmany nach Ahascragh – zum Andenken an Rory Kavanagh”, den der Leser nicht kennen kann. Wenn wir nicht wüssten, wer Joseph Brodsky war, gäbe es wohl auch keine Totenklage von Seamus Heaney über ihn. Aber wenn die Poesie aus dem ganz Heimischen schöpfen will, sollte sie dessen Realität nicht verschweigen. Die Totenklage auf diesen Rory Kavanagh würde nichts verlieren, sondern dichterisch gewinnen, wenn eine Anmerkung sagen würde, dass dieses Gedicht bei seiner Beerdigung vorgetragen worden ist.
Unter diesen Gedichten ist kaum ein anthologiefähiges, sich selbst genügendes zu finden. Aber der eigensinnige Dichter ist vielleicht nicht auf dem falschen Wege, wenn er Gedichte veröffentlicht, die sich gerade nicht genügen, sondern beinahe schmerzlich den Autor und den Leser fordern. Heaneys Entscheidung für das Heimische birgt gewiss ein unabsehbares Risiko. Und doch sichert sie ihm jenen Hauch von Authentizität, der seine deutschen Leser auch noch durch die Übersetzung hindurch anweht.
HANS-HERBERT RÄKEL
SEAMUS HEANEY: Elektrisches Licht. Gedichte. Zweisprachige Ausgabe. Aus dem Englischen übersetzt von Giovanni und Ditte Bandini. Carl Hanser Verlag, München 2002. 168 Seiten, 17,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Souverän findet Rezensent Florian Döring im neuen Gedichtband des Nobelpreisträgers "Nutzung und Anverwandlung klassischer dichterischer Formen". In den Gedichten findet er außerdem poetische Gesichter und Geschichten "hartnäckig auf ihre verborgene Herkunft" befragt. Auch in dieser Sammlung bleibe Heaney seiner "oft bezeugten Vorliebe für ländliche Lokalitäten, abseits des Strom von technischer Modernisierung" treu, obwohl der Titel anderes assoziiere. Hier klingt, respektverhangen, auch eine Spur Enttäuschung mit an. Für viele deutsche Leser sei am vorliegenden zweisprachigen Gedichtband sicher das Beste, befindet schließlich der Rezensent, dem "Erfindungsreichtum und subtilen Deutungsvermögen" der deutschen Übersetzung nachzuspüren. Auch wenn Ditte und Giovanni Bandini mitunter einen "etwas hohen Ton" anschlagen, gehen sie doch "ebenso schöpferisch wie mutig" mit dem Original zu Werke, schreibt Döring. Ihre Kennerschaft konnten sie dem Rezensenten auch in den zahlreichen Anmerkungen bezeugen, die sie den Gedichten "beigegeben" haben. Gelegentlich allerdings findet Döring die Bedeutungsquellen mancher Gedichte etwas zu ausführlich protokolliert und wäre ihren vielstimmigen Verbindungen gern etwas eigensinniger gefolgt.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
"Heaneys Fähigkeit, die uns vermeintlich so vertraute Welt unvertraut erscheinen zu lassen und sie durch die Sprache und Imagination zu bannen und zu formen. ... Mischung aus sinnlichen, ja fast mit Händen zu greifenden Eindrücken wie dem wunderbaren "Melkerdunkel" und gedanklicher Reflexion. ... wie selbstverständlich er das globale poetische Erbe für den irischen Kontext fruchtbar zu machen versteht ... stellt es eine Bereicherung dar, neben Heaneys langjährigen Übersetzern auch das Original lesen zu können. Diese Wahl steigert das Vergnügen ..."
Jan Wagner, Der Tagesspiegel, 01.12.02
Jan Wagner, Der Tagesspiegel, 01.12.02