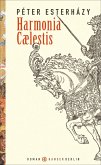Peter Nadas schildert, wie ihn auf offener Straße ein Herzinfarkt in den Griff nahm und über den schmalen Grat führte, hinter dem der Tod beginnt. Nach dreieinhalb Sekunden ins Leben zurückgeholt, schildert der Dichter minutiös die Wahnehmungen eines Grenzgängers, den Schmerz wie die kuriosen Begebenheiten am Rand - eine Erzählung von Ungeheuerlichem und zugleich Alltäglichem.

Der ungarische Schriftsteller Péter Nádas hat eine philosophische Erzählung über den eigenen Tod geschrieben
Einmal ist der Dichter gestorben. Es mache ihn glücklich, dachte er noch, dass die erhabenen Dinge „so banal wie im Märchen” seien, und dann dachte er gar nichts mehr. Er sah, wie eine große, blonde Krankenschwester Notizbuch und Bleistift von sich warf, er sah, wie ein Mann in weiß sich auf seinen Brustkorb stürzte, um ihn mit beiden Händen fest zu drücken. Er sah, wie ein anderer das Infusionsgestell zu halten versuchte, das in diesem Durcheinander umzustürzen drohte. „Der große Hauptschalter ist betätigt worden.” Doch nach dreieinhalb Minuten – oder nach einer Ewigkeit – rochen Haut und Haare auf der Brust verbrannt, und die beiden Gestalten in weiß waren wieder vor den Augen des Dichters zu sehen. „Sie lachten und hoben ihre Köpfe in das grelle Licht.” Einmal war der Dichter gestorben, und dann war er wieder da.
Péter Nádas widmet sein jüngstes Buch dem Tod, und zwar dem eigenen. Im Alter von einundfünfzig Jahren warf ihn ein Herzinfarkt nieder, und für eine kurze Zeit muss er ausgesehen haben, als sei es mit ihm vorbei. Und für eine kurze Zeit – oder für gar keine, oder für eine unendlich lange Zeit, er will sich da nicht entscheiden – ist er , dem eigenen Bericht zufolge, in einen euphorischen, aber ganz und gar konturlosen Zustand hinaus befördert worden, in eine Art Allseits- , Ganzheits- und Urerlebnis. Aus dieser Erfahrung ist das Buch entstanden, kein Roman, kein Essay, ja nicht einmal ein Fotobuch, obwohl zahlreiche Fotografien darin enthalten sind. „Der eigene Tod” ist viel mehr als das, nämlich ein Stück erzählender Philosophie von großer Ernsthaftigkeit, wie es seit Sören Kierkegaards „Die Wiederholung” und „Furcht und Zittern” nur noch selten eines gegeben hat.
Dabei fängt alles beinahe harmlos an. Der Dichter muss in die Stadt fahren, um Besorgungen zu machen. Das Wetter macht ihm zu schaffen, denn es ist plötzlich Sommer geworden. „Prächtiges Wetter, redete ich mir zu, doch mein Körper sträubte sich. Wann immer möglich, wechselte ich auf die schattige Seite der Straße.” Von der ersten Zeile an ist der Bericht von der kommenden Katastrophe gezeichnet, auf höchst subtile Weise: Denn die dunkle Ahnung höhlt die Wahrnehmung aus, sie kündigt das Einverständnis mit dem Naheliegenden, dem Vertrauten und dem Praktischen, sie zerfrisst alles Gewöhnliche.
Und so trifft der Dichter im Café Gerbaud eine junge Frau, mit der er ein offenbar juristisches Problem zu besprechen hat. „Als wolle sie keinen Augenblick auf den Genuß der Sinne verzichten, erläuterte sie es mit geschlossenen Augen. / Sie präsentierte ihre blau bemalten, schamlos zitternden Lider.” Als der Dichter diese schäbigen Versuche der erotischen Verschönerung wahrnimmt, zählt er eigentlich schon nicht mehr zu den Lebenden, er ist schon umgefallen, aus dem Dasein gekippt wie ein Baum im Sturm, aber es hatte gar keinen Wind gegeben. „Jetzt aber begriff ich mit vor Todesangst geweiteten Augen, daß wir uns immer aneinander orientieren und in jedem Augenblick unsere eigene Lage an derjenigen der anderen messen und die der anderen an uns selbst.” Diese Verbindung ist nun gekappt, ein- für allemal.
„Der eigene Tod” ist ein Bilderbuch. Es enthält trotz seiner fast dreihundert Seiten nicht viel Text. Manchmal steht nur ein Satz auf der Seite, ein Satz wie „Durch den Körper bleibt die Seele unberührt.” Lakonisch könnte man diesen Stil nennen, wenn das Lakonische nicht längst zu einer Pose verkommen wäre, in der sich nur eine kompliziertere Variante des Pathos verbirgt. Dagegen muss man sich die Sätze im Totenbuch von Péter Nádas wie Eintragungen in einem Journal vorstellen. Sören Kierkegaard hatte sein kleines Buch von der großen Wiederholung einen „Versuch in der experimentierenden Psychologie” genannt. Es ist der Stil der Beobachtung, der beide Bücher trägt.
Begleitet wird der Bericht von zahlreichen Bildern. Sie zeigen alle denselben Baum, eine wilde Kirsche im Garten des Dichters – im Sonnenschein und unter tief hängenden Wolken, mit und ohne Blätter, morgens, mittags und abends. Diese Bildern sind Fotografien, gewiss, aber in der konsequenten Wiederholung haben sie die Kontingenz abgestreift, die zur Fotografie gehört. In der langen Serie verwandeln sie sich stattdessen in Löcher, die der Fotograf in die Mauer am Ende der Welt schlägt. Schaut man hindurch, erblickt man in die reine Transzendenz: das, was ist, als Abstraktion von sich selbst.
Und was erlebt der Dichter auf der anderen Seite des Todes? Manches, was er zu berichten hat, ist erstaunlich konkret: „Es ist eine indirekte, sozusagen verschleierte Helligkeit, als hätte man eine Mattscheibe vor eine in Wahrheit sehr starke Lichtquelle geschoben.” Anderes klingt nach philosophischer Schulung: „Frei werden, zuerst von den ewigen Körperempfindungen, dann vom Denken, das man für so wichtig gehalten hat. Rückkehr zu einem Urzustand, wo es kein begriffliches Denken gibt, weil der Unterschied zwischen Anschauung und Empfindung aufgehoben ist.” Aber stets weicht Péter Nádas vor dem Allgemeinen zurück – wenn es ihm schon gelingen soll, das Dasein auf der anderen Seite des Todes zur Sprache zu nötigen, dann mit dem Vorbehalt, als einzelner, nur für sich allein zu sprechen.
Was Péter Nádas nach seinem Tod widerfuhr, wird man eine religiöse Erfahrung nennen müssen, obwohl auch er in jenen Bereichen keinen Gott zu erkennen vermag. „Zwar ist Gott auch im Universum des Lichts nicht auffindbar, dennoch ist Licht für ihn die glaubwürdigste Metapher.” Und entscheidender als die Frage, wem man auf der anderen Seite begegnet – und ob man überhaupt einem begegnet – ist die Frage nach dem Wie. Und das scheint Péter Nádas nicht unangenehm gewesen zu sein: Keine Sehnsucht pocht mehr in der Brust, keine Not und keine Begehrlichkeit treibt den Menschen voran, keine Ideen brausen durch den Schädel, die Wünsche haben aufgehört zu plärren, und den Gedanken hat es die Sprache verschlagen.
Das große, unfreiwillig vollzogene Experiment von Péter Nádas lässt sich kaum wiederholen. Das unterscheidet diesen Versuch von den Experimenten in den angewandten Naturwissenschaften. Dem Dichter ist das Experiment als Ausnahme gewährt worden, und auch wenn man selbst nicht nach einer solchen Ausnahme strebt, so ist doch zu verstehen, was Péter Nádas an jener Erfahrung nicht nur gefiel, sondern geradezu mit elementarer Gewalt einleuchtete: dass es ein Ich, eine Identität, nur als Zentrum von Bedrängnis, Not und Schmerz gibt. Und dass die Umkehrung dieser Erfahrung zwar tödlich sein muss, aber alles andere als schmerzhaft sein kann.
Das Totenbuch von Péter Nádas besteht aus zwei Teilen: aus der Erinnerung an das unfreiwillige Experiment des Sterbens und aus der schier endlosen Wiederholung desselben Motivs. Das Schreiben ist die Erinnerung, die Fotografie ist die Wiederholung, jenes schreit rückwärts, dieses voran. „Wiederholung, das ist Wirklichkeit, und ist des Daseins Ernst,” heißt es bei Sören Kierkegaard. „Wer die Wiederholung will, erweist sich als zum Ernst herangereift.” Im Baum liegt alle Zukunft.
THOMAS STEINFELD
PETER NADAS: Der eigene Tod. Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer. Steidl Verlag, Göttingen 2002. 288 Seiten, 39 Euro.
Aus den Aufzeichnungen des vom Tode zurückgekehrten Fotografen und Dichters Péter Nádas, seine Lage nach dem Experiment beschreibend: „Lange wagte ich mich nicht aus der Wohnung, weil mir schwerfiel, die reale Existenz der Dinge ernst zu nehmen, da ich ihr Wesen nun einmal zu kennen glaubte.” Den Kommentar dazu sprach der Philosoph Sören Kierkegaard vor hundertfünfzig Jahren: „Hat man das Dasein umsegelt, so wird sich zeigen, ob man den Mut hat, das Leben als Wiederholung zu verstehen, und Lust hat, sich der Wiederholung zu freuen. Wer das Leben nicht umsegelt hat ehe er zu leben begann, kommt nie dazu, daß er lebe.”
(Foto a. d. bespr. Band)
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Was bedränget dich so sehr: Péter Nádas überlebt den Dreiminutentod mit der Kamera in der Hand / Von Wilfried Wiegand
Schon beim Erwachen merkte ich, daß nichts so war, wie es sein sollte, doch ich hatte in der Stadt viel zu tun, ich ging los." Mit diesem Satz beginnt der ungarische Schriftsteller Péter Nádas sein neues Buch, und schon die wenigen Worte lassen das Unheil ahnen, das den Erzähler unweigerlich ereilen wird. Nádas erzählt, wie er einen Herzinfarkt bekommt. Es passierte vor neun Jahren in seiner Heimatstadt Budapest auf offener Straße, der Autor war damals einundfünfzig Jahre alt.
Anfangs stört ihn nur das warme Wetter, dann ekelt er sich vor dem Essen, schließlich fragt er sich, warum er so entsetzlich schwitzt, auf dem Behandlungsstuhl des Zahnarztes ist er klitschnaß am ganzen Körper. Noch hilft er sich mit kleinen Tricks über die Runden. Den schwitzenden Körper überlistetet er, indem er sich ins eiskalte Treppenhaus stellt und abwartet, "bis mein aschgraues Seidenhemd einigermaßen trocken war", und die anstürmenden Fragen beschwichtigt er mit Vermutungen: Könnte es sich nicht beispielsweise um eine Nikotinvergiftung handeln? Und hat er nicht in letzter Zeit wirklich zuviel gearbeitet?
Erst als er nicht mehr in der Lage ist, "die sanfte Steigung des Gehsteigs zu bewältigen", beginnt er, die eigenen Ablenkungsmanöver zu durchschauen. Sarkastisch macht er sich klar, wie eitel der Mensch ist: Man bewundert sogar noch, "zu welchen Sensationen man im letzten Moment des Lebens doch imstande ist". Allmählich aber wächst die Einsicht, daß er sich selbst zum Rätsel geworden ist: "Man hat keine blasse Ahnung, was im eigenen Organismus vor sich geht." Kausal läßt sich das alles nicht erklären, zumal der Mensch sich bis zum letzten Moment gegen die Wahrheit wehrt. "Es gibt Ursachen", macht er sich klar, "die so peinigend sind, daß man sie nach den Regeln des inneren Monologs nicht einmal vor sich selbst anzudeuten wagt, darum sind auch die ursächlichen Zusammenhänge nicht durchschaubar."
Der Text bedeckt nicht immer die ganze Seite, auf mancher steht nur ein einziger Satz. Zum Beispiel "Nach einer Weile wurde es besser, ich konnte weiter" oder "Ich verstand nicht, was vor sich ging". Das Layout macht jeden Satz zu einem Minidrama. Wo Drama ist, gibt es auch Katastrophen. Sie kündigen sich in ebenso knappen Sätzen an. Unvermittelt heißt es nach der Zahnarzt-Episode: "Die kläffenden Höllenhunde wünschen, daß ich den Mund halte, daß ich nicht davon erzähle", und ein paar Seiten weiter, nachdem längst schon wieder von anderem die Rede war, sind die apokalyptischen Köter plötzlich wieder da: "Sie bellen und jaulen aus Leibeskräften, damit ich die passenden Sätze nicht finde." Wer ist es, dem der Zorn der Höllenhunde gilt? Ist es der Mann, der vor Jahren auf der Straße vom Infarkt angefallen wurde? Oder ist es der Autor, der nachträglich kommentierend zu deuten versucht, was ihm damals geschah? Man weiß es nicht so recht, und man muß es wohl auch nicht wissen, vielleicht ist ja beides im Spiel. Im Angesicht des Todes sind die Gesetze des chronologischen Erzählens außer Kraft.
Das Buch ist nicht in Kapitel unterteilt, aber der Stoff in drei große Blöcke gegliedert. Der erste schildert, ohne sich streng an die Chronologie zu halten, das Vorspiel des Infarkts, und der dritte, ebenfalls ausführlich, behandelt die Zeit im Krankenhaus. Dazwischen steht der Kern der Erzählung, der kaum mehr als vier Seiten füllen würde, wenn der Text ohne Unterbrechung gedruckt wäre. Diese vier Seiten schildern das, "wovon eigentlich erzählt werden soll", den Infarkt.
Lakonisch stellt Nádas fest, daß er keineswegs das Bewußtsein verliert, sondern bloß das "Alltagsbewußtsein". Sein Geist bleibt "wacher als je zuvor", aber staunend bemerkt er, wie die herkömmliche Zeitrechnung kaum noch gilt. Merkwürdigerweise akzeptiert das Bewußtsein diesen Umstand so selbstverständlich, als würde es sich an eine frühe Epoche vor Jahrmillionen erinnern, als nur die Zeitlosigkeit des Universums herrschte. Alles, was der Erzähler in seinem Leben gefühlt hat, ist präsent, aber wenn er sich jetzt daran erinnert, empfindet er nichts dabei. Das eigene Leben mit "dem ganzen großen sinnlichen Theater" ist zum Zitat geworden, zu einem Schauspiel. Er kann sich selbst zuschauen, und "das von der körperlichen Empfindung gelöste Bewußtsein nimmt als seinen letzten Gegenstand den Mechanismus des Denkens wahr". Kaum hat dieser Gedanke Besitz von ihm ergriffen, ereilt ihn der Tod. "Jetzt geschieht es." Der allerletzte Gedanke ist eine Art Abschied vom Körper und wird von der Beobachtung überlagert, daß "die Lebenden . . . fachgerecht und leidenschaftlich versuchten, mich in den Reihen der Ihren zu behalten". Im Krankenhaus erfährt Nadas, daß er dreieinhalb Minuten klinisch tot war, ehe er reanimiert werden konnte.
Wäre "Der eigene Tod" ein Film, käme jetzt ein Schnitt, so aber blättern wir nur die Seite um und erfahren, daß der Erzähler von nun ab zur Chronologie zurückkehren will, "um einige wichtige Details verständlich zu machen". Während der Krankenhauszeit horcht Nádas auf die Erinnerungen des Körpers und der Seele, und er läßt sich bei der quälend schwierigen Deutungsarbeit von Lichtphänomenen leiten. Er ist sogar ein bißchen stolz darauf, daß er sich durch seine fotografische Arbeit mit dem Licht auskennt und dadurch einen kleinen Wortvorrat besitzt, der beim Verstehen helfen könnte. Gott, das sagt er ausdrücklich, ist ihm in den kosmischen Riesenräumen, die er nun betritt, nicht begegnet, aber das Licht scheint ihm eine akzeptable Metapher dafür. Das Eintauchen in die Erinnerung des Körpers führt ihn schließlich zur Erinnerung an die eigene Geburt und zur Identifikation mit dem Körper der Mutter. Mit der Psychoanalyse hat Nádas dabei freilich ebensowenig im Sinn wie Canetti in "Masse und Macht". Beide Autoren mühen sich, Grundmuster der Psyche zu enträtseln, meiden die Psychoanalyse dabei aber wie die Pest. Denn deren Entzauberung würde den Gegenstand ihres staunenden Analysierens vorschnell hinweginterpretieren. Nádas' gedankliche Umgangsformen sind nicht die der kausalen Logik, deren Unzuständigkeit er bei seiner Reise in die innere Zeit konstatieren muß. Methodische Anleihen macht er am ehesten bei Denkfiguren der Mystik: Das Eine wird eins mit dem Anderen, das Kleinste ist mit dem Größten identisch, die Geburt gebiert den Tod, und durch den Tod kehren wir zurück zur Geburt.
Nádas aber versteht die Wahrnehmungen des Kranken nicht als Halluzinationen. Was der Kranke erlebt, sind Botschaften in einer eigenen Sprache, für die uns die Worte und Begriffe fehlen. Er geht davon aus, daß sein Körper Wahrheiten kennt, mit denen die von Gesunden bevölkerte Welt wenig anfangen könnte. Doch wenn es darum geht, die Welt zu erklären, sind die Kranken nicht gefragt. Das heißt nicht, daß sie uns nichts zu erzählen hätten, wenn wir sie nur anhören würden. Es war schon immer Sache der Künstler, diese Stimmen in sich selbst zu entdecken, wie sie in der Ekstase, im Wahn und Rausch zu uns sprechen, und ihnen, so gut es geht, zum Ausdruck zu verhelfen. Nádas fügt sich in eine große Tradition.
"Der eigene Tod" ist ein aufwendig gemachtes Buch. Hundertsechzig Bilderseiten durchschießen den Text. Die Fotos zeigen auf schwerem Kunstdruckpapier jedes Mal den gleichen Wildbirnenbaum. Péter Nádas hat ihn in seinem Garten aufgenommen. Im Wandel des Lichts und der Jahreszeiten verändert sich der Baum, aber viel imponierender ist, wie gleich er sich trotz allem bleibt. Er lebt, aber unendlich langsamer als wir, seine Zeit ist nicht die menschliche. Mehr Botschaften sollte man den Aufnahmen aber nicht entnehmen, würde man das Buch als Erbauungstraktat und Weisheitsfibel mißverstehen. Derartige Grenzerlebnisse zeitigen keine Ergebnisse, die sich mitteilen oder gar wissenschaftlich exakt benennen lassen. Es läßt sich nicht definieren, nur umschreiben. Nádas mischt erlebnishafte Erzählung mit begrifflicher Reflexion, er distanziert sich vom Gesagten durch eine Ironie, die auch vor sich selbst nicht haltmacht. Das ähnelt, wenn man ein Vorbild sucht, manchmal dem Rilke-Ton am Anfang des "Malte Laurids Brigge".
Nádas war Pressefotograf, ehe er Schriftsteller wurde, und seit seinem Bildband "Etwas Licht" von 1999 kennen und schätzen wir seinen unprätentiösen Blick. Der macht jetzt auch den Charme der Baumporträts aus. Fast amateurhaft wirkt das naive Interesse am Gegenstand, vergleich man es mit dem Standard unserer kommerzialisierten Fotokunst. Nádas praktiziert eine Fotografie im Zustand stilistischer Unschuld, unberührt vom Designbedürfnis der westlichen Welt. Er sieht den Baum, ohne an dessen Layout zu denken, und er sieht im Sucher seiner Kamera nur ihn, während der normale Berufsfotograf ihn schon als Gegenstand kommerzieller Verwertung wahrnimmt. Die Bäume von Nádas taugen weder zur Kunstpostkarte noch zum Poster, sie sind als Zeitschriftenseite ebenso ungeeignet wie als Kalenderblatt oder Werbung. Als Fotograf praktiziert Nádas eine Ästhetik der Verweigerung, seine Aufnahmen sprechen die visuelle Umgangssprache.
"Der eigene Tod" ist ein großes Buch, leicht zu lesen und kaum auszuschöpfen. Es folgt der klassischen Methode, die größten Dinge mit den einfachsten Worten zu sagen. Trotz aller Liebe zur Umgangssprache geht der Autor nie unter sein eigenes Niveau, so daß er beispielsweise eine gewisse medizinische Allgemeinbildung und seine Vertrautheit mit philosophischen Begriffen nicht zu kaschieren sucht. Aber es ist dennoch kein populärmedizinisches oder weltanschauliches Sachbuch geworden, sondern eine große Prosadichtung, etwas, was selbst das allerbeste Sachbuch nicht zu leisten vermag, was einzig Domäne der Dichtung ist. Ein einfaches Gedankenspiel: Stellen wir uns vor, Péter Nádas hätte den Infarkt gar nicht selbst erlebt, sondern das ganze Buch einem fiktiven Icherzähler in den Mund gelegt - was für einen Unterschied würde das machen? Gar keinen. Für ein Sachbuch bedeutete das den Verlust aller Glaubwürdigkeit, nicht aber für eine Dichtung dieses Ranges. Die Phantasien der Dichter sind nicht Lügen, sondern Bilder: hochgerechnete Lebenserfahrungen, die anders nicht auszudrücken sind, da sie die bilderlose Sprache überfordern würden.
Péter Nádas: "Der eigene Tod". Aus dem Ungarischen übersetzt von Heinrich Eisterer. Steidl Verlag, Göttingen 2002. 288 S., 160 Fotos des Autors, geb., 39,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Thomas Fitzel ist begeistert von Nadas´ Protokoll, Reflexion und literarischen Bearbeitung einer enttäuschenden Nahtoderfahrung. Enttäuschend insofern, als Nadas nach erlittenem Herzinfarkt zwar eine typische Nahtoderfahrung machte - deren Beschreibung sich zunächst, Fitzel zufolge, zwar nicht von der anderer Überlebender und Mystiker unterscheidet - dann aber lakonisch feststellen muss, dass Gott "leider nicht zu entdecken" war. Entsprechend unvollkommen bleibe notwendigerweise Nadas´ Bericht vom erlebten, eigenen Tod. Aber "welch vollkommene Form fand er dafür!", schwärmt Fitzel. Der Rezensent lobt vor allem die Metaphern und den erzählerischen Rahmen, die Nadas für den erlebten, aber ausgebliebenen Tod sowie für die anschließende "Wiederbeseelung" gefunden habe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH