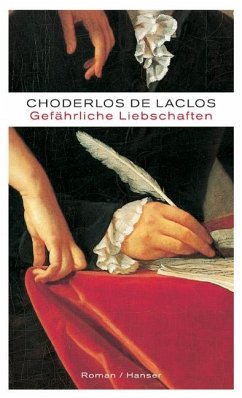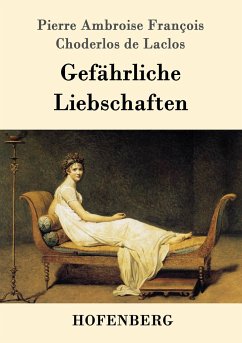Der große Klassiker über Liebe, Macht und Intrigen. 1999 von der Academie Goncourt zum wichtigsten Werk der französischen Literatur gekürt, ist dieser Liebesroman - jetzt in neuer Übersetzung - auch heute noch ein unvergessliches Leseerlebnis: ein Sittenbild der korrupten höfischen Gesellschaft im Frankreich vor der Revolution. Gesellschaftskritik, Fallstudie und Psychokrimi in einem.

Ein Abgrund von Bosheit: Choderlos de Laclos’ sonderpädagogisches Projekt „Gefährliche Liebschaften” in einer neuen Übersetzung
Wie immer ist es Goethe, bei dem das Schlimmste verzeichnet ist. Es dämmert schon in den „Wahlverwandtschaften”, und feucht steigt es herauf vom See. Ottilie hat sich stumpf gelesen an ihrem Roman und will zurück übers Wasser mit dem ihr anvertrauten Kind. Sie steigt in den schwankenden Kahn, ergreift das Ruder, das Kind, und mag nicht lassen von dem Buch, aus dem sie nicht herausgefunden hat. „Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn.” Alles entgleitet ihr, Ruder, Buch, auch das Kind, und tot nur birgt sie es aus dem Wasser. Wie’s eben so geht mit der verteufelten Romanlesesucht.
Zwei Bücher gibt es, die führten die Kunst des allesverderbenden Romans bereits im 18. Jahrhundert auf einen Gipfel, den weder Sentimentalisten wie Charles Dickens noch solche Groß-Schmunzler wie Thomas Mann je zu erreichen vermochten: der „Tristram Shandy” (1760) des Pfarrers Laurence Sterne und die „Gefährlichen Liebschaften” (1782) des anpassungsfähigen Militärs Choderlos de Laclos. Unseren lieben „Werther” einmal ausgenommen, ist in diesen beiden Büchern schon alles entfaltet, alles in der Länge, Breite und Tiefe ausgeschritten, was der Roman und niemand besser kann: verführen und erobern. Von nun an ging’s, wie es im Liede heißt, von nun an ging’s bergab.
Zwar trugen in diesem 18. Jahrhundert in Paris aufklärungsbegierige Männer eine ganze Enzyklopädie zusammen, die Wissenschaft blühte mit hundert Blumen, es wurde debattiert, geplant, verworfen, aber bei all dem Vernünftigtun herrschte eine fiebrige Zwischenkriegszeit. Dieses klägliche Europa erlebte eine unsichere Latenz, musste ständig neu verteilt, neu zugeschnitten, neu zerrissen werden. Da nun aber jahrzehntelang keiner draußen im Felde stehen konnte und auch nicht jeder gleich nach Nordamerika zu verkaufen war, spielten die Strategen die großen Schlachten im Sand oder auf dem Papier nach.
Dabei war das Rokoko nicht weniger sexbesessen als die rocaillenlose Gegenwart. Alles dreht sich bei Laurence Sterne um dieses Thema, das den Autor zu immer neuen vielsagenden Auslassungszeichen nötigt. Nur das eine spricht er fast klipp und klar aus. Woher denn Onkel Tobys Kälte gegen das schöne Geschlecht rühre? „Ja, Madam, durch den Stoß von einem Stein, der bei der Belagerung von Namur durch eine Kanonenkugel aus der Brustwehr eines Hornwerks gebrochen wurde und justament auf meines Onkel Tobys Schamleiste schlug.”
Onkel Toby, my uncle Toby, ist impotent.
Der Krieg oder das Kriegsspiel hilft ihm übers Ärgste hinweg. Dieser „Gentleman von unvergleichlicher Züchtigkeit” verströmt sich notbehelfs in nachgestellten Schlachten. Toby gibt zu, dass er „den Frieden von Utrecht verurteilte und bedauerte, dass der Krieg nicht noch ein wenig länger heftig fortgeführt worden sei”. So träumt er denn von Schanzkörben und Breschen, die er schlägt, von den feindlichen Linien, ins tiefste Herz Frankreichs will er vorstoßen und nicht ruhen, ehe er die Standarte, seine, auf den Turm der Bastille gepflanzt.
Es ist, als hätte der Offizierssohn Sterne zwei Dutzend Jahre vor den „Liaisons dangereuses” bereits das Schwanzstück dazu geschrieben, die Farce zur Tragödie. Denn die „Liebschaften” selber sind, wie alle grausamen Bücher, vor allem humorlos. Laut Robert Gernhardt gibt es keine ironische Erektion. Sex, vor allem, wenn nur darüber geredet wird, ist bitter ernst, ist Krieg und kein Spiel. Der Waffengang, in den Laclos seine Soldaten schickt, kann nur tödlich enden. Er treibt seine Figuren mit einem Ingrimm in den Untergang, den sonst nur rechte Kriegsgurgeln aufbringen.
Echter Männerhumor
Das Buch ist die Reißbrettarbeit eines Kriegsingenieurs und Festungsbauspezialisten. Ein eitles Rachegelüst treibt die Marquise de Merteuil. Das Hascherl Cecile ist frisch aus dem Kloster einem ihrer abtrünnigen Liebhaber versprochen, der, soviel Spaß muss sein, in der Hochzeitsnacht mit einer bereits entjungferten Braut überrascht werden soll. Der Vicomte de Valmont soll als Komplize das schöne Werk vollenden. Das ist echter Männerhumor, aber er kommt von einer Frau, von der göttlichen Marquise, die sich und damit die Männer vollständig in der Gewalt hat. Sie mögen artig um sie herummenuettieren, sich ihr auf dem Bauche liegend nahen oder selbst als Eroberer: „Nein”, schreibt sie dem doch annähernd so bösen Vicomte, „der ganze Hochmut Eures Geschlechts würde nicht hinreichen, die Kluft zwischen uns auszufüllen.” Sie ist „geboren, mein Geschlecht zu rächen und das Eure zu bemeistern”.
Valmont hat es nicht eilig mit der dargebotenen Lockspeise, die Aufgabe ist ihm zu leicht, außerdem möchte er lieber die tugendhafte Präsidentin Tourvel erobern. Mehrfach droht die Marquise ihrem Valmont den Gunstentzug, weil „Ihr weniger zu siegen wünscht als zu kämpfen”. Noch ist der Sieg über die Prüde nicht sein. Eine Finte wird die Präsidentin gewinnen: Der Schurke Valmont lässt sich dabei beobachten, wie er Gutes tut, denn ein Wohltäter kann kein ganz schlechter Mensch sein. Er fordert, sie weicht zurück, er beschämt sie, sie weist ihm die Tür, er fleht um ihre Vergebung, verschreibt sich ihr so inständig, bis sie ihn erhören muss. „O, ergeben soll sie sich, aber kämpfen soll sie, dass sie, ohne die Kraft zu siegen, die zum Widerstehen habe.”
Denn in der Liebe und im Krieg, nicht wahr, Madam, so haben Sie es doch gelernt, ist alles erlaubt.
Die Marquise, der die Fortschritte in diesem langen Feldzug jeweils depeschiert werden, beherrscht den gleichen Wortschatz: „Ich brannte darauf, mit Euch Leib an Leib zu kämpfen.” Nach allen Regeln der Kunst, denn es ist eine, wird die Frau belagert, das Herz in Brand gesteckt, die Festung bestürmt, werden Glacis und Burggraben überwunden, die Mauern berannt, gestürmt, geschleift. Am Ende ist die Veste erobert, ausgeräuchert und dem Erdboden gleichgemacht wird sie, denn der Schreibtischstratege Laclos ist ein Feldherr der verbrannten Erde.
Schauplatz des Kampfes ist das Papier, sind die 175 Briefe, die das Romanpersonal wechselt, und zwar nicht bloß hin und herschickt, sondern auch noch abschreibt, umleitet, weitergibt, nacherzählt. Sie schreiben sich unaufhörlich, sie schreiben so viel, dass sie gar keine Zeit haben, alle Briefe zu lesen. „Anstatt zu schlafen, was ich für mein Leben gern täte”, klagt die Marquise ein wenig scheinheilig, „muss ich Euch einen langen Brief schreiben”, um, aber was denn sonst, ihre teuflischen Pläne neuerlich zu präzisieren. Es ist ein sehr trockenes Empfinden, dieser ewige theoretische Genuss („Ich stand auf und las meine Epistel erneut”), aber schließlich weiß auch Onkel Toby sein Lied davon zu singen.
Das 18. Jahrhundert war so – hemmungslos oversexed. Von dem wahren Begehren durfte die Rede nicht sein, statt dessen probierten, von der französischen Königin abwärts, die Liebenden ein Schäferleben, spielten eine künstliche Natur, da es die echte doch nicht gab, und das eine oder andre Mädchen führte statt des Mannes ein Lämmlein am rosa Benzel spazieren. Beim Kriegsmann Laclos geht es hinaus ins feindliche Leben: Seine Liebenden sind durch die Bank genasführt, gehörnt, verraten, betrogen. Das Gänschen wird bestraft für seine Naivität, der jugendliche Liebhaber zum Roué umerzogen, das Alptraumpaar Merteuil und Valmont exzelliert in erlesenster Bosheit. Wenn das Böse, nachdem der Teufel die Welt verlassen hat, noch einen Platz in ihr hat, dann in diesem Buch.
Die Sitten meiner Zeit
Das immer gern als Erotikon für den schon reiferen Herrn (Alas, poor uncle Toby!) missverstandene Werk ist allerdings ein einziges Missverständnis: der böse Autor meinte es gut. Der „Nouvelle Héloïse” Rousseaus entnahm Laclos das Motto für sein sonderpädagogisches Projekt: „Ich sah die Sitten meiner Zeit und machte diese Briefe bekannt.” Es ist sein Roman auch keiner, sondern besteht, wie der nicht weniger moralisierende Untertitel ankündigt, aus „Briefen, gesammelt in einer Gesellschaft und veröffentlicht zur Unterweisung einiger anderer”. Die offenbare Unmoral seiner Briefeschreiber bekräftigt 1782, sieben Jahre vor der Revolution, dass das ancien régime überreif war, nämlich verderbt bis ins Mark. Zwar sprechen die Immoralisten Brief für Brief für sich, aber ganz kann es ihr Ingenieur doch nicht lassen, in Einleitung und Fußnoten auf eine ganz besonders verrottete Gesinnung zu verweisen oder einen weiteren Abgrund an moralischer Verkommenheit zu entdecken.
Es ist aber Hoffnung selbst in diesem Teufelswerk: Als der gute Onkel Toby dann doch vom sandkastenförmigen Schlachtfeld abkommt („Liebe mag daher sein, was sie will – mein Onkel Toby fiel ihr anheim”), kommt er doch nicht vom Wege ab, sondern macht sich, seines Handicaps nicht achtend, an die „Belagerung der Witwe Wadman”. Die Merteuil lässt nicht ab vom Kampf („Man muss siegen oder untergehen”), doch Valmont verliebt sich in sein Opfer – sollte es am Ende die reine, die nicht ausgeklügelte, die untaktische Liebe doch geben?
Wolfgang Tschöke hat diese schillernde Kriegsfibel nach Bonin, Heinrich Mann, Kauders und Walter Widmer neu übersetzt. Von ein paar unnötigen Modernismen abgesehen, ist ihm das meisterlich gelungen.
Laclos, der gelegentlich als Autor dilettierende Offizier Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, wo Sie schon danach fragen, wird schon die eine oder andre Frau gekannt haben, während er jahrelang ohne echten Krieg in der Garnison von Grenoble lag und in La Rochelle, aber dann belagerte er eine wenig schöne Frau, die ihn seines Skandalromans wegen erst nicht empfangen wollte, schlich über eine geheime Tür zu ihr, schwängerte sie nach Art der Roués, die er so lebensnah geschildert, und heiratete sie dann, nur um glücklich mit seiner Marie-Soulange zu leben bis an sein selig Ende, in Tarent, 1803, am südlichen Rand des napoleonischen Reiches, das sich eben anschickte, noch viel größer und gewaltiger zu werden, indem es die Tugend und den Terror der Französischen Revolution über fast ganz Europa verbreitete.
Laclos hat sich nach seinem skandalösen Erfolg mit Fragen der Frauenerziehung befasst oder dem nicht weniger pikanten Thema, dass das wahre Glück nur zuhaus bei der Familie zu finden sei, ansonsten aber seinen wechselnden Auftraggebern gedient. Er wurde zwar vorübergehend Premier (bei Philippe Égalité), aber bald ins Exil vertrieben, diente in der Revolution den Jakobinern, saß kurz im Gefängnis und kam bei Napoleon endlich zu den ersehnten militärischen Ehren.
Nach dem öden Kasernendienst, nach seinem teuflisch-theoretischen Buch zog es den Krieger Laclos wieder hinaus ins Feld. Es war allen Berichten zufolge Laclos’ logistischem Geschick zu verdanken, dass die Revolutionstruppen 1792 bei der Kanonade von Valmy jene der Allianz zurückschlugen, so dass sich der Schlachtenbummler Goethe dreißig Jahre später den leitartikelfähigen Satz in den Mund legen konnte: „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.”
Als er starb, an einer besonders scheußlichen Ruhr, konnte Laclos seiner Witwe immerhin einen prächtigen Uniformrock hinterlassen und den Skandal, einen der zwei größten Romane seines Jahrhunderts geschrieben zu haben.
Weh dem, der liest.
WILLI WINKLER
CHODERLOS DE LACLOS: Gefährliche Liebschaften. Roman. Aus dem Französischen von Wolfgang Tschöke. Mit einem Nachwort von Elke Schmitter. Hanser Verlag, München 2003. 542 Seiten, 27,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Die "Gefährlichen Liebschaften" des Choderlos de Laclos, neu übersetzt / Von Martin Mosebach
Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des achtzehnten Jahrhunderts, des "Zeitalters der Vernunft", daß es in seinen größten Kunstwerken, in "Faust" und "Don Giovanni", Teufelspakt und Höllenfahrt zum Thema machte. Am Vorabend der Revolution ist nicht mit rationalem Optimismus von den kommenden herrlichen Zeiten die Rede, sondern von dem "sich selbst erkennenden Bösen", wie Baudelaire den Satanismus genannt hat. Die Autonomie des von allen Beschränkungen befreiten Individuums bestätigt sich in den rituellen Schlacht-Orgien des Marquis de Sade.
Auch wenn nicht von Tod und Teufel die Rede ist, in den spieluhrenartigen Komödien à la "Così fan tutte" ist der Mensch ein Automat, dessen innere Stahlfedern ihn zum Bösartigen hin ausschlagen lassen. Und genau zwischen "Così fan tutte" und de Sade ist der berühmte Briefroman des Choderlos de Laclos, "Les liaisons dangereuses", angesiedelt, die "Gefährlichen" - nach Heinrich Mann "Schlimmen Liebschaften". Zu den Triumphen eines Erzählers gehört, wenn er eine Figur erschaffen hat, die über das Buch hinaus zur Legende wird. Laclos ist eine solche Schöpfung gelungen: Die Marquise de Merteuil ist eines der großen Monstren der Weltliteratur. Ohne die Sadeschen Requisiten der Blasphemie, ohne die Aura von Blut und Gestank, die sie vermutlich geschmacklos gefunden hätte, ist sie die vielleicht reinste Sadesche Persönlichkeit. Das Böse ist ihr Lebensmotor. Berauscht von ihrer eigenen Kälte, beschreibt sich diese Frau als Kunstwerk ihres Intellekts. Der vollkommene, in der Flamme der Reflexion durchgeglühte Mensch, das ist sie. In ihrer Welterkenntnis könnte sie eine gelassene Quietistin sein, die in der bloßen Einsicht in die Umstände ein stilles Vergnügen findet. Sie ist schön, reich, klug, sie wird begehrt und bewundert - warum ist sie nicht gut? Oder wenigstens nett? Das Böse ist das Unbegreifliche, das mit den Mitteln der Psychologie, die in diesem Roman so meisterhaft angewandt werden, letztlich nicht Faßbare.
Die altertümlichsten Kategorien bieten sich an, um diese Bosheit zu erfassen, obwohl nicht die leiseste Andeutung in dieser Richtung fällt: Besessenheit. Auch Laclos' Zeitgenosse Diderot zeigte sich in "Rameaus Neffe" fasziniert von einer zur Bewunderung zwingenden vollendeten Bosheit. Die platonische Trinität ist gesprengt: Das Wahre und das Schöne müssen keineswegs gut, sie können sogar sehr böse sein.
Unter den Briefromanen sind die "Liaisons dangereuses" der Archetypus, der Höhepunkt der Gattung. Heute erscheint es als Kunstgriff, einen Kreis von Personen unentwegt über sämtliche Details des täglichen Lebens korrespondieren zu lassen, aber in der Welt des Laclos waren die Mitglieder der von ihm beschriebenen Milieus besessene Briefschreiber. Voltaire schrieb achtzig Briefe am Tag und wechselte mit seiner Freundin Madame du Châtelet sogar Briefe, als er mit ihr in demselben ziemlich kleinen Schloß wohnte.
Wer die Effekte der "Liaisons dangereuses" im Naturzustand genießen möchte, der schlage etwa den "Biedermann" auf, die Sammlung von Briefen der Zeitgenossen Goethes, in der man immer wieder ein und dasselbe Ereignis von fünf oder sechs verschiedenen Briefschreibern geschildert finden kann: naiv und eingeweiht, hämisch und devot, snobistisch und brav; ein Ganzes entsteht nicht aus den vielen verschiedenen Aspekten, sondern der Verdacht, alles sei in Wahrheit noch einmal ganz anders gewesen. Der Leser wird in solche Korrespondenzen hineingezogen; er wird zum Detektiv, der sich aus reichen Indizienfunden sein Bild von der Sache selbst zusammensetzt. Ganz allmählich ahnt er an winzigen Zeichen, daß Madame de Merteuil, wie es bei Teufelspakten zu sein pflegt, die Betrogene ist. Die Liebe hat sie in sich vernichten können, nicht aber die Eifersucht, die ihr und ihrem Spießgesellen Valmont schließlich nach vielen Meisterintrigen das Grab gräbt. Es ist, als habe Laclos hier in viel grelleren Farben das Schicksal der bereits erwähnten Madame du Châtelet nachzeichnen wollen, die stets hochgemut gelehrt hatte, es komme in der Liebe darauf an, etwas weniger als der andere zu lieben, und die schließlich durch die Liebe zu einem kühlen jungen Mann beinahe verrückt wurde.
"Les liaisons dangereuses" haben im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert rechtschaffene Empörung und lüsterne Neugier ausgelöst. Der Roman galt als wichtiges Belastungsmoment in dem Prozeß, den die Französische Revolution gegen die Aristokratie des Ancien régime führte. Schönheit und Eleganz konnte man einer Schicht nicht absprechen, die in Häusern und Möbeln lebte, die zum Vollkommensten gehörten, was die Menschheit hervorgebracht hat, und auch der literarische Stil dieser Leute war in Schlankheit und Präzision unübertrefflich: Wenn Madame de Merteuil sich auf einen Stuhl an einen Tisch setzte, um einen Brief zu schreiben, setzte sie sich auf ein Kunstwerk an ein Kunstwerk, um ein Kunstwerk abzufassen. Die ästhetische Exklusivität dieser Welt läßt der Roman übrigens nur ahnen, sie ist selbstverständlich, nur der Hauch der Mühelosigkeit, der über allem liegt, zeugt von ihr. Aber dieser Glanz kontrastiert nur noch unbarmherziger die Schwärze, Leere und Kälte in den Herzen dieser Könige des Lebens. Sinnlos und funktionslos ist ihre Existenz, sie sind weder Soldaten noch Regenten, sie tragen keine Verantwortung und glauben nur an ihr Vergnügen: Dies besteht darin, andere Menschen zu quälen und zugrunde zu richten. Der perverse Libertin ist die einzige Form der Freiheit, die in der absoluten Monarchie möglich ist. Da war die Guillotine der Revolution kein Instrument der Strafe, sondern der kluge Aderlaß eines menschenfreundlichen Arztes, der die Menschheit von solchen Geschwüren befreite.
Wie der Arzt hieß, ist bekannt. Er war auch gar kein Arzt, sondern Rechtsanwalt: Maximilien de Robespierre. Wenn er während seiner Reden eine Pause machte und durch kleine Brillengläser ins Publikum sah, wurde es den Zuhörern ungemütlich. Dann wandte er sich wieder seinem Manuskript zu. Das aber hatte häufig niemand anders verfaßt als Choderlos de Laclos.
Auch heute noch werden die "Liaisons dangereuses" vielfach als "Sittenroman", als getreuliches Abbild einer Gesellschaft und einer Zeit gelesen. Ja, so sollen sie gewesen sein, die Draculas in seidenen Kleidern, die mit höchster Delikatesse Jungfrauenblut tranken. Daß Choderlos de Laclos die Welt, die er beschrieb, nicht gekannt hätte, daß er sich den Phantasien der Kolportageschriftsteller hingegeben hätte, wird man ihm nicht nachsagen können.
Genau die Schicht, die er beschrieb, den Adel, der sich vom Hof fernhielt und keine Pflichten übernahm, hat er aus größter Nähe studieren können. Laclos war vor der Revolution Privatsekretär des Herzogs von Orléans, eines königlichen Prinzen aus der jüngeren Linie der Bourbonen, in der der Haß auf den König erblich war. Dieser Orléans war einer der großen Förderer der Revolution; er unterstützte die Aufstände des Jahres 1789, auch den Sturm auf die Bastille, mit Geld und Agenten. Müßig ging der Adel um den Herzog von Orléans gerade nicht, dazu war er zu intensiv mit der Vorbereitung der Revolution beschäftigt. Laclos' Held, der unwiderstehliche, grausame Vicomte de Valmont, hätte, wenn er gelebt hätte, gute Chancen gehabt, ein revolutionärer Todesengel à la Saint-Just zu werden.
In den Kreisen des Herzogs von Orléans mischte sich mittelalterliche Frondeursgesinnung mit den philosophischen Ideen der Enzyklopädisten. Die "réaction nobiliaire", die zu den wesentlichen Auslösern der Revolution gehörte, versammelte große Namen: Mirabeau, Lafayette, Talleyrand. Verglichen mit ihnen war Laclos nur ein kleiner Zuträger. Aber für die eigentümliche Funktion, die der literarischen Pornographie und Obszönität im vorrevolutionären Kampf zukam, durfte er eine Schlüsselrolle übernehmen. Dabei bleibt er viel dezenter als seine Gesinnungsgenossen Mirabeau, Restif de la Bretonne, Crébillon und Sade.
Obszön sind die Empfindungen der Merteuil, niemals ihre Worte. Das hemmungslose Treiben in dieser Literatur war in hochpolitischer Absicht gegen die moralischen Säulen der alten Herrschaft gerichtet. Die Libertins verbreiteten amoralische Literatur, um die Macht der Kirche und der patriarchalischen Ordnung zu erschüttern. Kaum war die Revolution gelungen, drehten dieselben Leute den Spieß um: Ihre eigene Literatur wurde nun zum Beweis genommen, wie dekadent die Aristokratie sich betragen habe. Mirabeau malte seinen Lesern aus, wie ein Vater seine zwölfjährige Tochter in die Freuden der physischen Liebe einführte, aber im Prozeß gegen Marie Antoinette wurde Ernst aus dem süßen Rokoko-Spaß: Dort hielt der Ankläger ihr vor, ihren eigenen Sohn mißbraucht zu haben. Die wildesten Perversionen wollte Marats Zeitschrift "L'ami du peuple" der Königin zutrauen, einer Tochter Maria Theresias aus dem strenggläubigen Wien. Eine mondäne zynische Intrigantin, eine Messalina sollte sie gewesen sein - erkennt man nicht in diesen Charakteristika die Silhouette der Madame de Merteuil?
Als die Merteuil entlarvt ist und alle ihre Teufeleien in der Welt sind, erlebt sie in der Oper, daß das gesamte Publikum sich bei ihrem Eintritt erhebt und sie allein dastehen läßt - das war das Urteil der Gesellschaft, das die Kreise um Laclos auch der Königin zugedacht hatten; der Gesellschaftsvertrag mit der Monarchie sollte aufgekündigt werden. Ein Beispiel engagierter Kunst sind die "Liaisons dangereuses" also. Da ist es erstaunlich, wie frisch und erschreckend sie bis auf den heutigen Tag geblieben sind. Der Grund dafür ist einfach: Der Autor hat sich in seine böse Heldin verliebt. Sie ist ein wahrhaftes Ungeheuer, überlebensgroß, ehrfurchtgebietend, geheimnisvoll, und wenn sie auch wie Don Giovanni in die - gesellschaftliche - Hölle fährt, so schließt diese Hölle ewiges Leben keineswegs aus.
Ist die neue Übersetzung von Tschöke ein dringendes Desiderat gewesen? Heinrich Manns Übersetzung liegt immerhin auch noch vor. Mann ist gelegentlich eleganter als Tschöke, aber oft nicht so genau; wo er, zur Charakterisierung der jungen Cécile etwa, Jargontöne anklingen läßt, ist er veraltet. Die neue Ausgabe bringt außerdem die nicht unwichtige Vorrede von Laclos und einen - leider - sehr knappen Kommentarteil. Der Türspalt, der den deutschen Blick auf das einzigartige Werk gestattet, ist ein bißchen weiter geöffnet.
Choderlos de Laclos: "Gefährliche Liebschaften". Roman. Aus dem Französischen neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Wolfgang Tschöke. Nachwort von Elke Schmitter. Hanser Verlag, München 2003. 542 S., geb., 27,90 [Euro].
Choderlos de Laclos: "Gefährliche Liebschaften". Roman. Aus dem Französischen von Heinrich Mann. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2003. 532 S., br., 12,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Bewundernd und bewundernswert bespricht Martin Mosebach diesen Briefroman aus dem 18. Jahrhundert, den er zum "Höhepunkt" seiner Gattung erklärt. Seine Heldin, die Marquise de Merteuil "ist eines der großen Monstren der Weltliteratur", erklärt Mosebach, "der vollkommene, in der Flamme der Reflexion durchgeglühte Mensch, das ist sie". Ihr einziges Vergnügen besteht darin, das Leben und die Liebe anderer Menschen zu vernichten. Damit, so Mosebach, ist sie zugleich ein vollkommenes Beispiel für die französischen Aristokraten des 18. Jahrhunderts, die Freiheit in der absoluten Monarchie nur als "perverse Libertins" erringen konnten. Choderlos de Laclos, übrigens einer der Redenschreiber Robespierres, wie wir erfahren, hat mit diesem Roman die französische Revolution mit auf den Weg gebracht. Die Merteuil, schreibt Mosebach, galt den Revolutionären als Beispiel für die Verkommenheit und Nutzlosigkeit des Adels. Ist das heute noch interessant? Ja, meint Mosebach, denn der Roman habe nichts von seiner Frische und seinem Schrecken verloren, vor allem, weil sich de Laclos in seine böse Heldin verliebt habe. So grandios habe er sie in ihrer Bösartigkeit gezeichnet, dass sie noch in der Hölle unsterblich wurde. Die neue Übersetzung von Wolfgang Tschöke findet Mosebach besser als die alte von Heinrich Mann. Tschöke sei vielleicht manchmal nicht so "elegant" wie Mann, aber dafür "genauer". Auch klinge Manns Übersetzung dort, wo er beispielsweise Cecile Jargon sprechen lässt, veraltet. Auch den Abdruck der "nicht unwichtigen" Vorrede von de Laclos in dieser Neuausgabe empfindet Mosebach als Bereicherung. Lediglich der Kommentar ist für seinen Geschmack zu knapp ausgefallen. Insgesamt aber bringe diese Neuausgabe die "Gefährlichen Liebschaften" dem "deutschen Blick" etwas näher.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
"Der Türspalt, der den deutschen Blick auf ein einzigartiges Werk gestattet, ist ein bißchen weiter geöffnet." Martin Mosebach, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.10.03
"Wolfgang Tschöke hat diese schillernde Kriegsfibel nach Bonin, Heinrich Mann, Kauders und Walter Widmer neu übersetzt [...] und es ist ihm meisterlich gelungen."
Willi Winkler, Süddeutsche Zeitung, 12.01.04
"(Wolfgang Tschöke) gelingt das Kunststück, die Eigenheiten der Figuren anschaulich zu fassen und ohne störende Archaismen die Komplexität und Eleganz des Französischen der Aufklärung ins Deutsche zu bringen." Carolin Fischer, Die Welt, 30.08.03
"Die Vielfalt der sozial kodierten und von Wolfgang Tschöke hervorragend ins Deutsche übersetzten Stilebenen und Tonlagen nimmt den Leser von Anfang an gefangen."
Maike Albath, Der Tagesspiegel, 04.01.04
"Tschökes Übersetzung hat zwar einen rauen Klang, passt sich so aber der französischen Präzision besser an. Die vertrackten Pläne der Figuren, gespiegelt in der Artistik ihrer Sprache, vermag seine Übersetzung durch Exaktheit wiederzugeben. [...] Nimmt man das elegant geschriebene und kenntnisreiche Nachwort von Elke Schmitter hinzu, so könnte der Roman durch diese Edition, nachdem sich in letzter Zeit nur Kinobesucher damit beschäftigt haben, wieder Leser gewinnen." Hannelore Schlaffer, Stuttgarter Zeitung, 04.09.03
"Pierre Choderlos de Laclos' Briefroman 'Gefährliche Liebschaften' löste bei seinem Erscheinen 1782 wegen seiner moralischen Unentschiedenheit einen Skandal aus, wohingegen man ihn heute durchaus auch als frühes Plädoyer für die - wenn auch schief gegangene - Befreiung der Frau lesen kann."
Die Rheinpfalz, 31.01.09
"Wolfgang Tschöke hat diese schillernde Kriegsfibel nach Bonin, Heinrich Mann, Kauders und Walter Widmer neu übersetzt [...] und es ist ihm meisterlich gelungen."
Willi Winkler, Süddeutsche Zeitung, 12.01.04
"(Wolfgang Tschöke) gelingt das Kunststück, die Eigenheiten der Figuren anschaulich zu fassen und ohne störende Archaismen die Komplexität und Eleganz des Französischen der Aufklärung ins Deutsche zu bringen." Carolin Fischer, Die Welt, 30.08.03
"Die Vielfalt der sozial kodierten und von Wolfgang Tschöke hervorragend ins Deutsche übersetzten Stilebenen und Tonlagen nimmt den Leser von Anfang an gefangen."
Maike Albath, Der Tagesspiegel, 04.01.04
"Tschökes Übersetzung hat zwar einen rauen Klang, passt sich so aber der französischen Präzision besser an. Die vertrackten Pläne der Figuren, gespiegelt in der Artistik ihrer Sprache, vermag seine Übersetzung durch Exaktheit wiederzugeben. [...] Nimmt man das elegant geschriebene und kenntnisreiche Nachwort von Elke Schmitter hinzu, so könnte der Roman durch diese Edition, nachdem sich in letzter Zeit nur Kinobesucher damit beschäftigt haben, wieder Leser gewinnen." Hannelore Schlaffer, Stuttgarter Zeitung, 04.09.03
"Pierre Choderlos de Laclos' Briefroman 'Gefährliche Liebschaften' löste bei seinem Erscheinen 1782 wegen seiner moralischen Unentschiedenheit einen Skandal aus, wohingegen man ihn heute durchaus auch als frühes Plädoyer für die - wenn auch schief gegangene - Befreiung der Frau lesen kann."
Die Rheinpfalz, 31.01.09