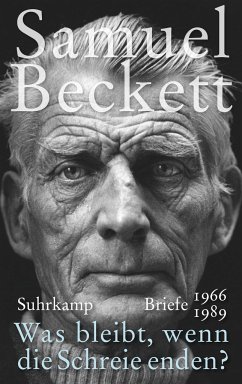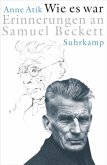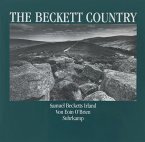Dieser Band beschließt die große vierbändige Ausgabe der Briefe Samuel Becketts. Er enthält Briefe aus den letzten 23 Lebensjahren, in denen sich das Werk des seit Warten auf Godot (1953) berühmten Autors weiter entfaltet.
1969 erhält Beckett den Nobelpreis - und flieht nach Tunesien. Aus der Lawine der Glückwünsche und sonstigen Zuschriften kann er, der gewissenhafte Korrespondent, sich kaum befreien. Immer wieder, zum Beispiel zu den Geburtstagen, wird er in dieser Weise verschütt gehen, sich beklagen und aufs Neue berappeln. Denn weiterhin drängen Texte ans Licht. Zahlreiche Theater- und Fernsehstücke entstehen ebenso wie Prosa, so die Trilogie Gesellschaft, Schlecht gesehen schlecht gesagt und Aufs Schlimmste zu.
Beckett inszeniert die eigenen Stücke in Paris, London und häufig in Berlin - sowie Fernsehstücke in Stuttgart. Dauernd ist er mit Selbstübersetzungen (französischer Texte ins Englische, englischer Texte ins Französische) beschäftigt. Er bekommt es - unwillig und dann doch kooperativ - mit BiographInnen zu tun, Deirdre Bair, dann James Knowlson (Samuel Beckett. Eine Biographie, 2001). Urlaube, die er mit seiner Frau auf Malta, an der nordafrikanischen Küste oder in den Alpen verbringt, sind auch Fluchten vor dem Pariser und internationalen Kulturbetrieb, den er haßt und in dem er doch unermüdlich mitwirkt.
Zuletzt lassen die Kräfte nach. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett im Pflegeheim. Unweigerlich pointiert und trocken, immer noch in diesem unnachahmlichen Ton, bescheidet eines seiner letzten Schreiben den Briefpartner: "Mein Hirn ist Matsch, kann nicht helfen. Bonne continuation."
1969 erhält Beckett den Nobelpreis - und flieht nach Tunesien. Aus der Lawine der Glückwünsche und sonstigen Zuschriften kann er, der gewissenhafte Korrespondent, sich kaum befreien. Immer wieder, zum Beispiel zu den Geburtstagen, wird er in dieser Weise verschütt gehen, sich beklagen und aufs Neue berappeln. Denn weiterhin drängen Texte ans Licht. Zahlreiche Theater- und Fernsehstücke entstehen ebenso wie Prosa, so die Trilogie Gesellschaft, Schlecht gesehen schlecht gesagt und Aufs Schlimmste zu.
Beckett inszeniert die eigenen Stücke in Paris, London und häufig in Berlin - sowie Fernsehstücke in Stuttgart. Dauernd ist er mit Selbstübersetzungen (französischer Texte ins Englische, englischer Texte ins Französische) beschäftigt. Er bekommt es - unwillig und dann doch kooperativ - mit BiographInnen zu tun, Deirdre Bair, dann James Knowlson (Samuel Beckett. Eine Biographie, 2001). Urlaube, die er mit seiner Frau auf Malta, an der nordafrikanischen Küste oder in den Alpen verbringt, sind auch Fluchten vor dem Pariser und internationalen Kulturbetrieb, den er haßt und in dem er doch unermüdlich mitwirkt.
Zuletzt lassen die Kräfte nach. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett im Pflegeheim. Unweigerlich pointiert und trocken, immer noch in diesem unnachahmlichen Ton, bescheidet eines seiner letzten Schreiben den Briefpartner: "Mein Hirn ist Matsch, kann nicht helfen. Bonne continuation."

"Vorsätze Doppelpunkt Null Stop - Hoffnungen Doppelpunkt Null Stop": In Samuel Becketts späten Briefen klingt der Abschied durch jede Zeile.
Becketts letzter Brief geht an einen Fernsehmann, der "Murphy" verfilmen will. "Lieber Michael Kuball", schreibt er am 19. November 1989 auf eine Briefkarte, "Ich bin krank & kann nicht helfen. Leider. Also: machen Sie ohne mich weiter." Am 6. Dezember wird der Dreiundachtzigjährige ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ihn seine Schwester bewusstlos im Zimmer des schlichten Pariser Pflegeheims gefunden hatte. Am 11. Dezember fällt Beckett ins Koma, zwei Tage vor Heiligabend stirbt er. Die Briefe, die er in den Monaten vor seinem Tod schreibt, sind genauso wie die, die er in den Jahren zuvor geschrieben hatte: Der Abschied dringt klaglos durch jede Zeile.
Selbst in den schlichtesten Ausführungen zu Reiseverläufen oder Wetterlagen, Rechtefragen oder Inszenierungsfehlern schleicht sich ein kurzes, schneidendes Wort vom Ende ein. Schon im Dezember 1968 heißt es lapidar: "Einziger Ehrgeiz: passendes Loch finden und nicht mehr aufstehen", seinem deutschen Verleger Siegfried Unseld stellt Beckett sich im März 1969 "als endender, wenn nicht geendet habender Schriftsteller" vor, und an seine langjährige Geliebte Barbara Bray schreibt er aus Tanger im Sommer 1975: "Kann kaum glauben, dass ich jemals zwei Wörter zusammengebracht habe." In Erwiderung auf eine Geburtstagskarte heißt es dann 1983 nur noch knapp: "Der Esel stirbt weiter."
Becketts letzte Briefe. Zusammengefasst in einem knapp tausendseitigen "letzten Band", der ein großangelegtes, mehr als dreißig Jahre dauerndes Editionsprojekt abschließt: Korrespondenz aus 24 Jahren, von 1966 bis zu seinem Tod, wobei nur Becketts Schreiben abgedruckt sind und nicht die der Gegenseite. Ausgewählt wurden sie von einem Herausgebergremium, das sich Becketts schwierigem Wunsch verpflichtet hat, es sollten nur Briefe veröffentlicht werden, die "für mein Werk von Belang sind". Natürlich ließe eine solche Willenserklärung "Raum für Interpretationen", gestehen die Herausgeber einleitend zu, beteuern aber auch, dass nach bestem Wissen kein Brief ausgeschlossen wurde, "der neues Licht auf Becketts Werk oder Leben geworfen hätte". Insgesamt sind trotzdem nur zwölf Prozent der verfügbaren Briefe aus dem angegebenen Zeitraum berücksichtigt worden - die ungeheure Zahl, die insbesondere nach der Nobelpreis-Verleihung im Oktober 1969 noch einmal sprunghaft ansteigt, überfordert wohl jeden Herausgeber und Verlag.
Beckett korrespondierte mit unermüdlicher Ausdauer. Kein Freund des Telefons und auch dem persönlichen Gespräch gegenüber misstrauisch - "am Telefon bin ich nicht zu gebrauchen, das ist noch schlimmer als Auge in Auge", schrieb er 1966 an seine langjährige Freundin Jocelyn Herbert -, verschickte er trotz nachlassender Kräfte Antwortschreiben in alle Welt. Vorzugsweise benutzte er dafür Brief- oder Korrespondenzkarten mit aufgedrucktem Absender, aber auch Kunstpost- und Ansichtskarten, um dem eigenen Schreiben von vornherein Grenzen zu setzen.
Vieles, eigentlich das meiste in diesem Briefband ist technischer Natur. Es geht um Erklärungen von Passagen in seinem Prosawerk und um nachdrückliche Vorgaben zur Inszenierung seiner Stücke. Verfilmungen werden abgelehnt, Bitten um mögliche Geschlechterwechsel bei der Besetzung ausgeschlagen und wiederholt nachdrücklicher Widerwillen gegen eine Biographie geäußert. Ärztliche Ratschläge werden weitergegeben ("Verbot, die zwei Brillen gleichzeitig zu tragen. Weniger trinken. Weniger rauchen"), Warnungen an Verehrer ausgesprochen: "Halten Sie sich von meiner Arbeit fern" rät Beckett 1970 einem schwärmerisch-suizidgefährdeten Medizinstudenten.
Was der irische Dramatiker nicht mag, sind Fragen nach seinen literarischen Einflüssen: "Es gibt keine Anspielung auf Platons Phaedo in Molloy, von der ich wüsste", schreibt er, oder: "Nein, ich habe nichts von Wittgenstein." Gegenüber engen Freunden wie dem Maler Avigdor Arikha, der Theaterwissenschaftlerin Ruby Cohn oder dem Verleger Jérôme Lindon zeigt er sich jedoch einfühlsam, mitunter fast herzlich. Weit über hundertmal enden seine Briefe in jenen Jahren mit der Ermutigungsformel "Bon courage". Er selbst hingegen beschreibt lapidar seine Verzweiflung: "Worum geht es letzten Endes, für uns alle, vom ersten Schrei an, als darum, es hinter sich zu bringen?", heißt es in einem Brief an seine Tante Peggy 1976. Und an Barbara Bray, an die mit Abstand die meisten seiner späten Briefe gehen, schickt er im Mai 1986 sechs Zeitungsartikel über sein Werk und fügt in Anspielung auf die Schlusssätze im "Letzten Band" hinzu: "Ich will sie nicht zurück. Nicht bei all der Asche in mir jetzt."
Was dem Gegenwartsleser von heute sofort auffällt, ist das nahezu vollständige Desinteresse gegenüber politischen Ereignissen. Wenn Beckett wiederholt auf die "Geschichte von 68" zu sprechen kommt, meint er damit einen Lungenabszess aus diesem Jahr, nicht die "Pop-Krawalle" der Studenten. An Adorno schreibt er im Februar 1969 über die "Marcusejugend": "War jemals soviel Rechthaben mit soviel Torheit verbunden?" Eine Aufführung seiner Stücke vor segregiertem Publikum in Südafrika verbietet er trotzdem und widmet seinen Einakter "Katastrophe" dem inhaftierten Václav Havel. Aber zum "Bloody Sunday" in Nordirland, zum Tod Titos oder zum Fall der Berliner Mauer äußert er sich nicht. Stattdessen Berichte über Rugby-Matches und Schachweltmeisterschaften. Nur ganz selten ein peripher-politischer Satz als eine Art Gedankenblitz: "Ist Nixon die einzige Hoffnung? Mein Gott."
Beckett hält auch sonst vorsichtig Abstand zur sogenannten Gegenwart. Kein Bericht von Kinobesuchen oder Romanlektüren, schon gar keine Liebesbriefe ("Bitte mich nicht, mir das Herz aufzureißen. Grässlich schwarzes Zeug käme da raus" ist das Äußerste, was er Barbara Bray an Intimität offenbart). In Becketts Briefen geht es um Arbeit, immer wieder und eigentlich bis zum Ende um nichts anderes als Arbeit. "Nichts ist wichtig außer dem Schreiben. Um etwas anderes ist es nie gegangen", schreibt er, dem seine Lebensgeschichte wie ein "von Anfang bis Ende völlig irrelevantes und uninteressantes Arbeitspensum" vorkommen will. Das Theater ist ihm Ausweg und "Falle" zugleich. Immer wieder reist er nach Berlin und Stuttgart, um dort seine Stücke selbst zu inszenieren oder fürs Fernsehen einzurichten. Verzweifelt über seine eigene Dogmatik bei der Regieführung schreibt er fast wehmütig: "Ich träume davon, ohne Text oder fast ohne Text in ein Theater zu gehen und mich mit allen Beteiligten zusammenzusetzen, bevor ich wirklich zu schreiben beginne." Aber dann versorgt er jeden, der danach fragt, doch mit peinlich genauen Regieanweisungen und Bewegungsvorgaben - "Krapp: Maximale Intimität mit dem Bandgerät", "Sag ihm, er soll ganz stillsitzen, wenn er die Aufnahme anhört".
Die Kollegen kommen nur am Rande vor. Mit Harold Pinter ist Beckett befreundet, in Cioran erkennt er eine "brüderliche Stimme" ("In Ihren Ruinen fühle ich mich wohl", schreibt er ihm 1969 aus Ussy, seinem vom Autobahnbau zunehmend bedrohten Landsitz), mit "Brechts Verfremdungs-Quatsch" will er nichts zu tun haben, sondern lieber mit Ezra Pound fünfzehn Minuten lang schweigend zusammensitzen und Champagner trinken. Paul Auster, dessen frühes Stück "Eclipse" unter dem Eindruck einer Begegnung mit ihm entstand, schreibt Beckett anerkennend zurück, dem "genervten" Rolf Hochhuth weicht er während eines gemeinsamen Aufenthalts an der Berliner Akademie der Künste im August 1967 aus und isst lieber allein "holländische Austern" in seinem Stammrestaurant "Giraffe". Die Briefe geben Beckett als einen leidenschaftlich paneuropäischen Zeitungsleser zu erkennen, der die Frankfurter Allgemeine Zeitung genauso konzentriert zur Kenntnis nimmt wie "La Stampa" und die "Times".
An ebenjene schickt er am Silvesterabend 1983 ein Telegramm, weil sie aus London nach seinen Vorsätzen und Hoffnungen für das kommende Jahr gefragt hatten: "Vorsätze Doppelpunkt Null Stop - Hoffnungen Doppelpunkt Null Stop Beckett". Zwei Jahre später fragt er Ruby Cohn in San Francisco: "Was bleibt, wenn die Schreie enden?" Der Satz gibt dem Band seinen Titel.
Es ist ein schweres Stück Literaturgeschichte, das einem hier in schwarzem Umschlag mit Becketts zerfurchtem Geistesgesicht auf dem Titelbild präsentiert wird. Aber die Lektüre lohnt sich. Und sei es nur, um zu verstehen, wie einer schrieb, der schreiben musste. Nicht anders konnte als bis zum Schluss nach den richtigen Worten zu suchen. Um jeden Preis. Und um beruhigt festzustellen: "Weder noch".
SIMON STRAUSS.
Samuel Beckett: "Was bleibt, wenn die Schreie enden?". Briefe 1966-1989. Hrsg. von George Craig u.a.
Aus dem Englischen von Chris Hirte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 1008 S., Abb., geb., 68,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
» ... durchweg faszinierende Briefe ... « Friedhelm Rathjen Neue Zürcher Zeitung 20190423