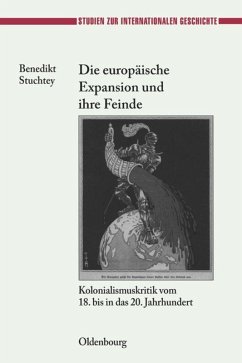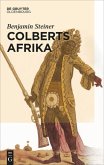Die koloniale Expansion Europas wurde seit ihren Anfängen von kritischen Stimmen begleitet, die als präzise Kolonialismustheorien zutage traten. Durch den Streit der Imperialismusgegner und -befürworter gewannen beide Seiten ein scharfes Profil. Benedikt Stuchtey untersucht die kommunikativen Kontexte der gelehrten Öffentlichkeiten der Kolonialmächte und bezieht dabei auch den amerikanischen Imperialismus vom 18. bis ins 20. Jahrhundert ein. Kolonialismuskritik kann im Zusammenhang transnationaler Verflechtungen von der europäischen Aufklärungsphilosophie bis zur pluralisierten Massenkommunikationsgesellschaft des 20. Jahrhunderts nachvollzogen werden.

England sei doch immer der Hafen des Fortschritts und der Freiheit gewesen, empörten sich die Kolonialismus-Kritiker. Benedikt Stuchtey präsentiert ihre Argumente.
Der aggressive Imperialismus, der den Steuerzahler teuer zu stehen kommt, der für den Produzenten und Händler nahezu ohne Wert ist und der mit unkalkulierbaren Gefahren für den Bürger behaftet ist, stellt hingegen eine Quelle großen Gewinns für jenen Investor dar, der im Heimatland für sein Kapital keine profitablen Anlagemöglichkeiten findet." Diesen Satz, den John Atkinson Hobson in seiner berühmten, 1902 publizierten Schrift "Imperialism" formulierte, brachte die zentrale Kritik am Britischen Empire um die Jahrhundertwende auf den Punkt: Großbritannien als Ganzes habe wenig von imperialen Investitionen und Handel oder leide gar darunter. Lediglich eine kleine Clique von Finanziers mache kräftige Gewinne.
Wichtiger Anlass für Hobsons kritisches Imperialismus-Buch war der Südafrikanische Krieg, der sogenannte Burenkrieg, der 1899 begann. Er zählte zu den härtesten und blutigsten Auseinandersetzungen der Kolonialgeschichte. Die burischen Republiken in Südafrika hatten Großbritannien den Krieg erklärt, wollten endgültig zu gleichberechtigten Mitgliedern der Staatengemeinschaft werden, die Briten sie dagegen ihrem Kolonialreich einverleiben.
Angesichts des burischen Guerrillakrieges entwickelten die britischen Militärs ebenso gründliche wie brutale Gegenmaßnahmen. Sie zerstörten systematisch die Bauernhöfe und brannten die Erde nieder, um den burischen Kommandos die Versorgung abzuschneiden. Sie internierten Frauen und Kinder in Lager, die sie selbst als concentration camps bezeichneten. Schließlich überzogen sie das Land mit einem Netz von Stacheldrahtzäunen und Blockhäusern, um die Bewegungsfreiheit der Buren einzuschränken. Doch erst im Mai 1902 akzeptierten diese die von London diktierten Friedensbedingungen.
Obwohl der britische Sieg nur eine Frage der Zeit war, gab die Erfahrung, eine Armee von 450 000 Soldaten eingesetzt zu haben, um zwei der weltweit kleinsten Agrarstaaten zu beugen, der imperialen Gesellschaft reichlich Stoff zur Selbstreflexion. Zugleich empörte sich eine "Internationale der Kritiker" aus unterschiedlichsten Gründen und mit entsprechend diversen Argumenten über die britische Südafrikapolitik während des Krieges. Theodor Mommsen etwa beklagte einen Verlust an Illusionen. Man habe in Europa England stets als "Hafen des Fortschritts, als Land politischer und intellektueller Freiheit" gesehen. Nun beginne man daran zu zweifeln, ob Großbritannien längerfristig den großen Nationen Europas und Amerikas gewachsen sein werde.
Mark Twain schrieb, der Sündenfall der Briten in Südafrika sei ebenso unverzeihlich wie der Amerikas auf den Philippinen. Auffallend war der offene Antisemitismus, mit dem zahlreiche Kolonialgegner die "jüdischen Finanziers" in Pretoria und Johannesburg beschuldigten, die Briten zu instrumentalisieren, um sich gegen die Buren zur Wehr zu setzen. Hobson schlug mit seiner These, der Finanzkapitalismus sei ein Motor des Imperialismus gewesen, deutlich antisemitische Töne an, wie überhaupt die wenigsten Kolonialkritiker, ganz unabhängig von ihrer Nationalität, vor Rassismus und Antisemitismus gefeit waren.
Die Diskussion über den Südafrikanischen Krieg markierte eine wichtige Etappe in der Geschichte der Kolonialkritik, wie sie Benedikt Stuchtey in seiner Konstanzer Habilitationsschrift für den Zeitraum vom achtzehnten bis in das frühe zwanzigste Jahrhundert auf breiter Literaturbasis untersucht hat. Der stellvertretende Direktor des Deutschen Historischen Instituts in London analysiert differenziert und mit großer Detailfülle Gemeinsamkeiten und Unterschiede im kolonialkritischen Denken in Westeuropa und partiell auch den Vereinigten Staaten. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Parallelen und Brüche der europäischen Kolonialherrschaft. In diesem Zusammenhang stellt der Autor heraus, dass die verbreitete Vorstellung, "Antikolonialismus sei ein mit einer Geschichte des okzidentalen Freiheitsstrebens fest verwobener Teil", nicht zutreffe. Dem stehen, wie seine Studie im Einzelnen zu zeigen vermag, die Verschiedenartigkeit der maritimen und siedlungskolonialen, vormodernen und modernen Imperialismen, ihre unterschiedlichen Diskontinuitäten sowie die Vielfalt der Formen kolonialer Herrschaft in den jeweiligen historischen Kontexten entgegen.
Stuchteys Geschichte der Kolonialismuskritik ist zugleich eine Würdigung der vorrangigen Bedeutung der britischen Geschichte für die Geschichte des neuzeitlichen Imperialismus: "Die ,Zentralität Europas' in dem Sinne, dass insbesondere das 19. Jahrhundert eine ,Epoche Europas' war, ein europäisches Jahrhundert schlechthin, basierte", so der Autor, "an vorderster Stelle auf der Zentralität Großbritanniens." Entsprechend stehen Entwicklungen auf der Insel im Mittelpunkt der Darstellung, wobei vergleichende Aspekte vor allem in Bezug auf Frankreich und Deutschland immer wieder einfließen. Der Fokus richtet sich explizit auf "metropolitane Diskurse" über den Imperialismus, während außereuropäische Stimmen kaum eingefangen werden. Der Autor argumentiert in seiner sehr substantiellen Einleitung mit durchaus guten Gründen für eine europazentrierte Perspektive auf die Kolonialismuskritik. Gleichwohl hätte man sich an einigen Stellen den systematischeren Einbezug der Kolonisierten und ihrer Aussagen gewünscht. Deren Bedeutung auf den europäischen und internationalen Bühnen wuchs im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts stark an, in einer Periode, die im vorliegenden Buch allerdings ohnehin nicht im Zentrum steht.
Methodisch hat sich Stuchtey vom Konzept der "intellectual history" anregen lassen, wie es im angelsächsischen Raum etwa Stefan Collini vertritt. Die Geschichte der Kritiker der europäischen Expansion wird nicht als ideengeschichtlich logische Erzählung entworfen, sondern am Beispiel von Einzelstudien erzählt, von "Charakterstudien", wie der Autor sie nennt. Unter Einbeziehung ihrer politischen und sozialen Hintergründe erfasst er die Kolonialismustheoretiker als "public moralists", als "Intellektuelle, deren Ideen so dem Wandel unterworfen waren, wie ihre politischen und gesellschaftlichen Profile vom Wandel der Zeiten geprägt wurden". Auf diese Weise ist ein faszinierendes Porträt einer über Generationen und über nationale Grenzen hinwegreichenden engagierten Öffentlichkeit entstanden, welche die Geschichte der kolonialen Expansion wesentlich mitgeprägt hat.
ANDREAS ECKERT
Benedikt Stuchtey: "Die europäische Expansion und ihre Feinde". Kolonialismuskritik vom 18. bis in das 20. Jahrhundert. R. Oldenbourg Verlag, München 2010. 470 S., geb., 59,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Benedikt Stuchtey schreibt eine Ideengeschichte der Kritik am Kolonialismus – die schärfsten Anklagen kamen von Akteuren mit einschlägiger Erfahrung
Eric Arthur Blair, britischer Snob und Rebell seiner Zeit, auch bekannt unter seinem Pseudonym George Orwell, war zwischen 1922 und 1927 Polizeioffizier in Burma. In seiner Kurzgeschichte „Einen Elefanten erschießen“, die er 1936 veröffentlichte, berichtet er von einem Ereignis, das er als biographische Schlüsselszene darstellt. Wahrscheinlich am 22. März 1926 riefen ihn die Bewohner des Dorfes Moulmein. Er sollte einen Elefanten erschießen, der in der Brunft zuvor einen Menschen totgetrampelt hatte.
Der Polizeioffizier hält in dem Moment inne, als er seine Winchester in Anschlag bringt. Auge in Auge mit dem Tier, das sich friedlich Gras und Bambus ins Maul wirft, bekommt er Zweifel an seinem Auftrag, die Ordnung des Empires vor Ort mit der Waffe zu sichern. Eine Hälfte von ihm sah im Raj, wie die britische Herrschaft über Indien genannt wurde, eine schreckliche Tyrannei, eine andere war überzeugt, dass es die größte Befriedigung in der Welt sein musste, einem buddhistischen Priester ein Bajonett in die Gedärme zu stoßen. Gefühle wie diese seien normale Begleiterscheinungen des Imperialismus. Doch die umstehende Menge drängt zum Handeln.
Orwell, der den Elefanten schließlich erschießt, geht als scharfer Kritiker der britischen Kolonialherrschaft davon. Später schreibt er autobiographisch in „The Road to Wigan Pier“: „Um den Imperialismus zu hassen, musst du Teil von ihm sein.“ Tatsächlich kam die schärfste Kritik mit der nachhaltigsten Wirkung von Akteuren mit Kolonialerfahrung. Eine weltumspannende Kolonialerfahrung fand sich in England. Dort gab es auch die meisten Kolonialkritiker.
Es waren viele, die das Empire kannten und ablehnten. Benedikt Stuchtey, der stellvertretende Direktor des Deutschen Historischen Institutes in London, zeichnet die Geschichte der Kolonialismuskritik von der Aufklärung bis ins Zeitalter der beginnenden Entkolonialisierung in drei großen Schritten nach: für das Zeitalter der Aufklärung, für das britische Empire im 19. Jahrhundert und für den deutschen, französischen und nordamerikanischen Kolonialismus. Im 18. Jahrhundert wandten sich die aufgeklärten Kritiker gegen koloniale Missstände, Beamte und Gouverneure, auch bereits gegen das koloniale Prinzip als solches. Bekannt sind Edmund Burkes Reden gegen Warren Hastings, den ersten britischen Generalgouverneur von Ostindien, auf den ein Amtsenthebungsverfahren wegen tyrannischer Willkür und Geldverschleuderung wartete.
Methodisch nimmt sich Stuchtey eine Intellectual History im Sinne Stefan Collinis vor, quasi eine Argumentgeschichte anhand exemplarisch ausgewählter Autoren. Mehrere tragende Argumente gegen den Kolonialbesitz gewannen unter den Aufklärern auf dem Kontinent und den britischen Inseln an Gewicht. Herders Zentralbegriff der Humanität, auch entscheidend für dessen Nationskonzeption, hielt jedes Volk in seiner Eigenheit für inkommensurabel und daher für schützenswert, was einer Kolonialisierung entgegenstand.
Edmund Burke entwickelte diesen Gedanken weiter in der Rede vom „sense of place“, der unverfügbar sei und jedem Volk zukomme. Hinzu kam in der Nachfolge Edward Gibbons die Vorstellung von Aufstieg, Blüte und Niedergang der großen Reiche. Das Schicksal des antiken Roms würde auch auf das britische Empire zutreffen. Adam Smith und später die britischen Freihändler um Richard Cobden setzten auf den Handel, nicht die Eroberung, um Völker zu verbinden und die Entwicklung zu befördern. Wie Benjamin Constant vermuteten sie hinter jeder Revolution den Willen zur kolonialen Expansion. Als Gegenmittel empfahlen sie Commerce statt Conquest. Die gewaltige Expansion des Empires im viktorianischen Zeitalter nach Indien und Afrika machte aus England in der Sicht der New Imperialists um Thomas Babbington Macaulay und Charles Edward Trevelyan nicht etwa ein Mutterland mit Kolonien, sondern eine „imperiale Nation“, deren Berufung es sei, Kolonien wie Indien zu erobern, zivilisierend tätig zu werden und dann endlich die indische Witwenverbrennung, den höchsten Gräuel für die imperiale Elite, zu verbieten. Expansionsgeschichte und Nationalgeschichte wurden für sie eins. Die Expansion war aus ihrer Sicht ein natürliches Verhalten der Briten, nicht das Ergebnis absichtsvoller Planung.
Dagegen regte sich allenthalben Widerstand, sodass Benjamin Disraeli, der spätere konservative Premier, bereits 1847 von den „two Englands“ sprach. Vertreter des Freihandels, die 1846 mit der Abschaffung der Corn Laws ihren Durchbruch erzielten, allen voran Richard Cobden, sahen im Empire eine illegitime Schließung des Prinzips freien Marktzugangs. Aus genuin ökonomischen Gründen war für Freihändler das Empire kontraproduktiv. Im September 1852 schrieb Disraeli an Außenminister Lord Malmesbury, die Kolonien seien Mühlsteine um den Hals der Regierung. Verstärkt wurde die Kritik am Empire durch Krisen. 1857 brach der große Sepoy-Aufstand, die Indian Mutiny los, auf Jamaika gab es 1865 die Eyre-Affäre. Zwar hätte man erwarten sollen, dass dies die Stunde der Kritiker werden würde. Doch kam es anders. Premier Benjamin Disraeli wandelte sich, einmal im Amt, zu einem Imperialisten reinsten Wassers. 1876 peitschte er eine Vorlage durch das Unterhaus, die Queen Victoria im folgenden Jahr zur Kaiserin von Indien machte. Sein Gegenspieler William Gladstone, von Hause aus ein liberaler Kritiker des Kolonialenthusiasmus, befahl 1882 die Besetzung Ägyptens. Wer als Kolonialkritiker solche Freunde hatte, brauchte keine Feinde mehr. Sowohl die Kritiker als auch die Verteidiger des Empires kamen aus der Mitte der viktorianischen Gesellschaft. Die Kritiker forderten die Imperial Federation, den föderalen Umbau des Empires. Andere wurden zynisch. Der Imperialist Rudyard Kipling brachte die koloniale Selbstermächtigung mit Zivilisationsauftrag auf die poetische Formel: „Take up the white man’s burden.“ Der kompromissloseste aller Kolonialkritiker Wilfried Scawen Blunt konterte: „White man’s burden is the burden of his cash.“
Unübersichtlich war auch die Kolonialkritik in Deutschland und Frankreich. Noch nicht einmal die Arbeiterbewegung war sich einig darüber, warum man die Kolonien eigentlich ablehnte. Karl Kautsky lehnte sie ab, um die kapitalistische Wirtschaftsordnung zu überwinden, die auch in den Kolonien galt. Für August Bebel konnte Kolonialpolitik dagegen sogar eine Kulturtat sein. Eduard Bernstein bekämpfte den „Colonialchauvinismus“, ließ aber keinen Zweifel am zivilisatorischen Mehrwert des Kolonialbesitzes und verteidigte das Interventionsrecht „höherer Zivilisationen“. War die Kolonialkritik kapitalismuskritisch gewürzt, konnte sich auch eine Brise Antisemitismus darunter mischen.
Kolonialkritik führte nicht einfach zum Antikolonialismus. Sie wies Brüche, Diskontinuitäten, Konversionen und Umkehrungen der politischen Frontstellungen auf. Es gab nicht ein einziges großes ethisches Meisternarrativ, sondern deren viele. SIEGFRIED WEICHLEIN
BENEDIKT STUCHTEY: Die europäische Expansion und ihre Feinde. Kolonialismuskritik vom 18. bis in das 20. Jahrhundert. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010. 470 S., 59,80 Euro.
Für die Anhänger des Freihandels
war das Empire aus ökonomischen
Gründen kontraproduktiv
Kritiker wie Verteidiger des
Empires kamen aus der Mitte
der viktorianischen Gesellschaft
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Nur positiv lässt sich Rezensent Andreas Eckert über diese Studie zur Kolonialismuskritik vernehmen, die Benedikt Stuchtey als Habilitationsschrift vorgelegt hat. Dabei habe Stuchtey keine lineare ideengeschichtliche Chronik geschrieben, sondern die exponierten Kritiker des Kolonialismus einzeln porträtiert. Im Zentrum stehen dabei die europäischen Diskurse, besonders die britischen, was Eckert damit erklärt, dass der von den Briten ziemlich brutal geführte Krieg gegen die Buren in Südafrika besonders viele Kritiker auf den Plan rief. Was der Rezensent als Ergebnis bemerkenswert findet, ist, dass das Freiheitsstreben in Europa nicht unbedingt immer mit dem Antikolonialismus einherging, und dass sich einige Kolonialismuskritiker unangenehmer antisemitischer Ressentiments bedienten (das "Finanzkapital"). Bedauerlich findet Eckert allerdings, dass nicht auch außereuropäische Stimmen hier zu Wort kommen, vor allem aus den kolonisierten Ländern selbst.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein faszinierendes Porträt einer über Generationen und über nationale Grenzen hinwegreichenden engagierten Öffentlichkeit, welche die Geschichte der kolonialen Expansion wesentlich mitgeprägt hat." Andreas Eckert, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Juli 2010 "Stuchtey liefert (...) eine brilliante Analyse der zahlreichen historischen Konstellationen von Kolonialkritik und Kolonialkrise" Jonas Hübner, H-Soz-u-Kult "Benedikt Stuchtey hat fachlich hinsichtlich einer Geistesgeschichte und "Geistespolitik" nicht nur der Kolonialkritik, sondern des Kolonialdenkens überhaupt Beeindruckendes geleistet." Comparativ, 1/2010