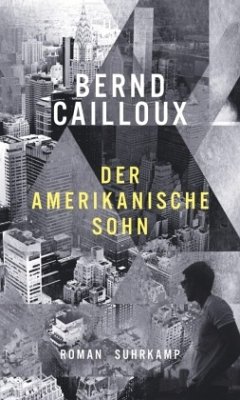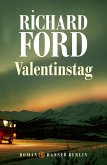Und du? Hast du Kinder? - Ja, einen Sohn, in Amerika. Danach Schweigen. Die am Rande einer Podiumsveranstaltung arglos gestellte Frage rührt an ein Lebenstrauma. Von seiner Vaterschaft erfuhr der Altachtundsechziger vor dreißig Jahren per Zufall auf der Tanzfläche. Der Junge namens Eno wuchs in Jamaika auf, später in den USA, Kontakt gab es keinen. Die Mutter, eine Hamburgerin, ging eigene Wege. Und so hatte die Existenz des Sohns den Vater, der als Aktivist und Hippie-Businessman von Familie nicht viel wissen wollte, bisher nie wirklich gekümmert. Doch 2014 lädt ihn eine Stiftung nach New York ein. Eine Chance, mit der verdrängten Geschichte ins Reine zu kommen. Je mehr er in die Stadt eintaucht, an alten und neuen Orten den Spuren des Undergrounds der Siebziger bis zu den Vorzeichen der Präsidentschaft Donald Trumps folgt, umso mehr gewinnt die Frage nach dem nahen fernen, längst erwachsenen Kind an Dringlichkeit.
Selbstironisch und mit warmer Lakonie geht Bernd Cailloux aufdie Suche nach dem verlorenen Sohn, auf einen USA-Trip in die eigene Vergangenheit und fremde Gegenwart - als New-York-Flaneur zu Fuß, zögerlich im Internet und zuletzt im Flugzeug Richtung Menlo Park, ans westliche Ende der westlichen Welt.
Selbstironisch und mit warmer Lakonie geht Bernd Cailloux aufdie Suche nach dem verlorenen Sohn, auf einen USA-Trip in die eigene Vergangenheit und fremde Gegenwart - als New-York-Flaneur zu Fuß, zögerlich im Internet und zuletzt im Flugzeug Richtung Menlo Park, ans westliche Ende der westlichen Welt.

Ein Achtundsechziger will doch noch seinen Sohn kennenlernen: Mit „Der amerikanische Sohn“
vollendet Bernd Cailloux seine fiktiv-autobiografische Romantrilogie
VON HELMUT BÖTTIGER
Bernd Cailloux ist ein Stroboskop-68er, kein politischer. Das unterscheidet ihn von vielen seiner Generationsgenossen. Er hatte das schon in seinem fulminanten Roman „Das Geschäftsjahr 1968/69“ aus dem Jahr 2005 rhythmisch flackernd eingefangen: Der Ich-Erzähler stand damals als Anfang 20-Jähriger am Beginn einer glänzenden kapitalistisch-popkulturellen Karriere, in seiner Firma wurde die Diskokugel mit dem Stroboskoplicht erfunden und man richtete zukunftstrunkene Events aus – mit Frank Zappa in der Essener Grugahalle zum Beispiel war man damals so auf der Höhe der Zeit, wie man es heute immer noch wäre. Es war der erste Roman einer „autobiografischen Trilogie“, wie es der Klappentext etwas verschmitzt nennt, und nach „Gutgeschriebene Verluste“ (2012) bildet „Der amerikanische Sohn“ nun ihren dritten Teil.
Dass das Autobiografische natürlich immer eine Fiktion ist, bildet die selbstverständliche Basis für diese drei Romane. „Der amerikanische Sohn“ spielt unbedingt in der Jetztzeit, der sarkastische und selbstironische Ich-Erzähler erkennt das spätestens daran, wenn er auf sein Gesicht im Spiegel schaut. Aber die Düsseldorfer Kunst- und Subkulturszene Ende der Sechzigerjahre ist immer noch gegenwärtig, als sie mit Lötkolben und diversen Bauteilen an einem neuen Discoflair laborierten und Joseph Beuys gleichzeitig anfing, mit Filz und Fett die Politik zu unterlaufen. Wild zusammengewürfelte junge „Artish People“ versuchten da, in immer wieder neu designten Szenelokalen Theorie und Kunst zu einer neuen avantgardistischen Lebensform zusammenzumixen.
Seinen damaligen Kompagnon Andreas Büdinger trifft der Ich-Erzähler am Anfang des neuen Buches nach Jahrzehnten in Berlin wieder. Sie hatten sich nach dem zunächst steilen Aufstieg ihres in einer Gartenlaube gegründeten Start-up-Hippiekollektivs zerstritten. Es machte damals binnen kurzer Zeit viel zu hohe Umsätze, um den Gemeinschaftsgedanken durchhalten zu können, und Geschäftsführer Büdinger erwies sich als der Kriegsgewinnler. Der Ich-Erzähler hält sich seit Jahrzehnten in der Berliner Subventionskultur und Kreativwirtschaft zwar durchaus gekonnt, aber doch eher unterprivilegiert über Wasser – wie genau, wird nur angedeutet. Und auch, wodurch er das dreimonatige Stipendium einer ominösen „Unterwaldt-Stiftung“ in New York ergattert hat, von dem er Büdinger erzählt, bleibt im kunst- und poptheoretischen Ungefähr. Die Begegnung mit dem alten Mitstreiter und Karrieristen hat vor allem die Funktion, die gesamte Lebensspanne des hier fabulierenden Protagonisten auszumessen und beiläufig das Motiv einzuführen, das den Roman durchzieht. Auf die lauernde Frage von Büdingers Frau, wie es mit Frau und Kindern bei ihm aussieht, kommt etwas lange Verdrängtes zur Sprache: der Erzähler hat einen Sohn, der jetzt ungefähr 30 Jahre alt sein muss und den er zum letzten Mal zufällig als Dreijährigen gesehen hat – und er lebt anscheinend in den USA.
Der streunende Held, der die 70 längst überschritten hat und als lonesome rider durch die Berliner Kneipen und Restkunstmilieus streift, sieht sich plötzlich mit einer Sehnsucht konfrontiert, die ihm nie so richtig bewusst war: Ein Sohn bedeutet so etwas wie Bindung und Verantwortung, letztlich sogar für sich selbst. Und bei dem Gedanken, sich in New York auf die Suche nach seinem unbekannten Sohn zu machen, stellt sich eine Nervosität ein, die ihm in ihrem Flackern merkwürdig bekannt vorkommt. Der Roman findet immer wieder traurig-komische, groteske und skurril-witzige Sehnsuchtsbilder für diese Spannung: der Mann, der sein Leben immer à point durchgezogen hat und recht unverbrüchlich zu seinen Maximen stand, wird eingeholt von einer Vergangenheit, die andere Konnotationen haben könnte als die, an die er sich gewöhnt hat.
Der Ton, den der Autor Cailloux seinen Ich-Erzähler anschlagen lässt, ist ein verblüffend lockerer, für seine Generation untypischer. Die politischen Prägungen eines 68ers scheinen zwar durch, er zeigt Ansätze zu einer linken Kunstmarkt- und Kapitalismuskritik, aber er wirkt nicht verbittert, sondern versucht, seine frühen Eskapaden nachzuvollziehen und nachzuleben. Er spielt mit sich als einer Theaterfigur, manchmal bis hin zu einer Karikatur, aber wenn er das San Francisco der frühen Siebzigerjahre beschwört oder das New York der Achtziger, wird klar, dass ihm die amerikanische Subkultur den entscheidenden Kick gegeben hat und auch hier den Drive des Erzählens ausmacht. Der Besuch in New York bei der Direktorin der „Unterwaldt-Stiftung“ ist in seinem satirisch gefärbten Duktus ein kleines Kabinettstückchen, wie überhaupt der direkte Blick auf die Kommunikations- und Verhaltensriten der einschlägigen Kunst-Klientel erfrischend und erhellend wirkt.
Das riesige Flachdach, das er von seinem Schreibtisch in der Stipendiatenwohnung in der Bleecker Street beschreibt, „zwei blau grundierte Fußballplätze groß und auf der langgezogenen Außenbahn bereits belebt von ersten Joggern“, erinnert im Übrigen stark an jenes, das die New York-Stipendiaten des Deutschen Literaturfonds von ihrem Fenster aus sehen – man kann hier also sehr schön die Transformation einer realen Ausgangssituation in einen literarischen Kosmos aufspüren. Der Erzähler erinnert sich bei seinen einsamen Ausflügen in die Stadt an frühere Aufenthalte in Manhattan, da schieben sich die Zeiten und die Altersstufen ineinander, und eingestreut sind einige knappe, die betreffende Zeit aber äußerst plastisch inszenierende Passagen, in denen seine fünfmonatige Liaison mit Nina in Hamburg beschrieben wird – dabei ist sein Sohn gezeugt worden, und wie planvoll das Nina angestellt hatte und wie zielstrebig sie dann ihre Auswanderung nach Jamaika ins Werk gesetzt hat, ist eine stimmige, raffiniert ausgeleuchtete Milieu- und Psychostudie.
Das Ganze ist zwar sehr süffig geschrieben, mitunter wie am Tresen einer intellektuell versierten Kneipe formuliert, immer mit einem mitlaufenden Subtext, aber der Roman ist dabei kunstvoll gebaut und lebt von seinen Anspielungen und Querverweisen. Gleich am Anfang seiner rückblickenden New-York-Exkursion fällt dem Erzähler ein Restaurant auf, das „Negril“ heißt, wie ein Strand auf Jamaika, und dass dieser karibische Küstenort im weiteren Verlauf noch eine große Rolle spielen wird, wird verblüffend salopp, aber dezidiert vorweggenommen. Nina hat dort eine Zeit lang ein Café betrieben, ist aber mit dem kleinen Eno irgendwann nach Atlanta in die USA gezogen, ein Mr. Harris spielte dabei eine gewisse Rolle. Wie der Erzähler das alles langsam im Internet herausfindet und durch den Sohn einer schrägen alten Berliner Bekannten unterstützt wird, die sich im mittlerweile gentrifizierten Harlem niedergelassen hat – das ist voller Situationskomik, hat aber auch eine kunstvoll in der Schwebe gehaltene existenzielle Dimension.
Es gibt eine Art Showdown in Menlo Park in Silicon Valley. Der Erzähler weiß mittlerweile, dass sein Sohn Sportreporter geworden ist – und dass das der frühere Traumberuf des hier Schreibenden war, geht eine unauflösliche Verbindung mit einschlägiger US-Literatur ein, von Richard Fords Reporterroman bis zu Philip Roths „Great American Novel“. Bernd Cailloux nimmt all diese Vorlagen souverän auf und macht aus einem Stoff, der eigentlich nur eine melancholisch durchtränkte und wehmütige Elegie sein kann, darüber hinaus einen spritzigen, unberechenbaren und zwischen allen Gefühlslagen changierenden Lebensroman.
Bernd Cailloux: Der amerikanische Sohn. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 223 Seiten, 22 Euro.
Seit Jahrzehnten hält sich der
Ich-Erzähler in der Berliner
Subventionskultur über Wasser
Cailloux macht aus dem
Stoff keine Elegie, sondern
einen Lebensroman
Wo die deutschen Stipendiaten wohnen: Der Deutsche Literaturfonds stellt deutschen Schriftstellern eine Wohnung in der New Yorker Bleecker Street zur Verfügung. Gelegentlich taucht sie deshalb in Romanen auf, unter anderem jetzt bei Bernd Cailloux.
Foto: Stephan Valentin/unsplash
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Eno, te absolvo: Bernd Cailloux sucht in den Vereinigten Staaten Erlösung von der Vaterlosigkeit
Häufiger noch als die Frage nach dem Alibi hört man in neueren Fernsehkrimis eine andere: "Haben Sie Kinder?" In der Regel erbleicht der Kommissar an dieser Stelle, beschämt von so viel überwältigender emotionaler Dringlichkeit. Kinderlose gelten heute als verantwortungslose Egoisten, "final abgedriftet" und gescheitert am Sinn des Lebens, "schon fast sowas wie Hitler", wie Bernd Cailloux' Erzähler und Alter Ego ungnädig konstatiert. 1968 war das noch anders; damals fraß die Revolution noch fröhlich ihre Kinder. Nachwuchs störte das revolutionäre Subjekt - vor allem die Väter - bei der politischen Arbeit wie bei der privaten Selbstverwirklichung, und so gab man die lästigen Klein-Bürger frühzeitig im Kinderladen oder bei den Großeltern ab.
Auch Bernd Cailloux, Jahrgang 1945, hatte seine Reproduktion eigentlich nie auf dem Radar: Party und Reisen, Leben und später dann auch Schreiben waren ihm wichtiger. Schon im "Geschäftsjahr 1968/69" (so der Titel seines besten Romans) durch Stroboskop-Anlagen zu unverschämt viel Geld gekommen, genoss er als prädigitaler Start-up-Hippie, libertärer Hedonist und netter Altachtundsechziger die Annehmlichkeiten von Geld, Sex, Drogen und schlauen Welterklärungen. Als Vater musste er sich erst verstehen, als er zufällig von seinem amerikanischen Sohn erfuhr. Ausgerechnet er, der ewige Nachwuchsverweigerer, der jetzt auch schon siebzig verweht ist, "arbeits-, sex- und demnächst haarlos", hat einen Sohn; und dann noch in Amerika, dem hassgeliebten Reich der Finsternis und der Popkultur. Nun hat er einen Roman darüber geschrieben mit dem Titel "Der amerikanische Sohn".
Die Geschichte darin geht so: Als ihm in den siebziger Jahren eine Kneipenbekanntschaft beiläufig ihre Schwangerschaft eröffnete, nahm er das nicht weiter ernst. Schließlich wollte sie das Kind wieder wegmachen und war eh schon auf dem Sprung nach Negril, dem Aussteiger-Hotspot in Jamaika. Dass sie ihre "letzte Gelegenheit, ein intelligentes, weißes Kind zu kriegen", dann doch genutzt hatte, bekam der Leihvater nur noch am Rande mit.
Dann aber wird Cailloux noch einmal mit seiner verdrängten, vergessenen Vaterschaft konfrontiert, und diesmal kann er ihr nicht mehr ausweichen. Als kränkelnder alter Mann will er endlich "seinen Mann stehen", sehen, was von einem übrig bleibt, wenn das Leben in Erinnerungen und "perpetuierende Cluster" der Vergeblichkeit zerfällt. Warum also nicht ein Amerika-Stipendium dazu nutzen, beim amerikanischen Sohn mal unverbindlich vorbeizuschauen? Dieser Eno ist, wie Cailloux googelt, Sportreporter und Bier-Blogger in Menlo Park, Kalifornien. Dass er in einem Interview von seinem tollen "Dad" schwärmt, kühlt die Sehnsucht des Erzeugers nach "Teilhabe" und Versöhnung schon mal empfindlich ab.
Der Erzähler verliert die Suche nach dem verlorenen Sohn dann auch rasch aus den Augen. "Der amerikanische Sohn" - das klingt nach überlebensgroßen, männlich-herben Kinogefühlen, unterlegt mit klagenden Gitarrenakkorden. Aber dies ist kein Roadmovie von Wim Wenders, kein Roman des frühen Peter Handke, sondern eben ein Amerika-Buch von Bernd Cailloux. Das heißt: analytische Schärfe, Erinnerungsseligkeit und schnoddriges Gelaber, trotzige Wurstigkeit und Sündenstolz mit einer Prise Selbstmitleid. Normalerweise hadert Cailloux an einem Berliner Tresen mit dem Niedergang des heroischen Hedonismus und seinem eigenen Verfall. Diesmal ist er in New York, der Kapitale des Kapitalismus, die er schon von Aufenthalten in den Siebzigern kennt, und das gibt ihm Gelegenheit, mit alten Kumpels und Geschäftsfreunden in Erinnerungen zu schwelgen.
"Ein Flaneur aus der Vorzeit, im Mund noch neun eigene Zähne", so streift er durch Chinatown und das gentrifizierte Harlem, spürt in dekadenten Galerien und biodynamischen Frauencafés "Kriechströme der Unsäglichkeit" und wohlige Schauder des Wiedererkennens, wenn er noch eine schummrige Bar mit schweigenden Männern findet. Als alter Hippie-Hipster hat man es im gerontophoben New York nicht leicht. Nicht nur wegen seiner Prostatabeschwerden liebäugelt Cailloux mit dem Gedanken, einen Toilettenführer für New York zu schreiben. Bei der Kulturstiftung, die seinen Aufenthalt alimentiert, stößt er damit auf wenig Gegenliebe, und diese Demütigung nagt weiter an seinem Selbstbewusstsein: "Willst hier als beckettscher Quasselgreis noch ordentlich was loswerden, mit deinem deutsch damischen Underground. Ruhm muss man hier schon von zuhause mitbringen, sonst wird man in New York noch kleiner als in seinem lächerlichen Kiez."
Cailloux gelingen bei seinem "Reality Zapping" schöne Porträts von überdrehten Galeristen und transsexuellen Altlinken mit Heimweh nach Europa, aber er versinkt auch immer tiefer in "hierarchielos mäandernden Verästelungsroutinen" und weitschweifiger Nabelschau. Ja, auch er hat als Kind gern Cowboy und Indianer gespielt und sieht jetzt das freie Schweifen der Phantasie bedroht durch Blackfacing-Verbote, ökologische Vernunft, betreutes Denken, Mansplaining- und Me-Too-Verdacht. So arbeitet sich Cailloux klagend, höhnend und schlau "herumsoziologisierend" immer näher heran an das unumgängliche Treffen mit seinem Sohn. Nach so viel Reisefeuilletons, Erinnerungen und Betrachtungen über Kinderkriegen und Vaterschaft damals und heute geht am Ende alles überraschend kurz und schmerzlos über die Bühne.
Was Vater und Sohn dabei bereden, bleibt offen und spielt letztlich auch keine Rolle mehr. Cailloux kann gut und gern über den Anteil Amerikas an der Menschwerdung und subkulturellen Sozialisation eines deutschen Flüchtlings- und Scheidungskinds plaudern. Aber das Geheimnis der Vaterschaft entzieht sich den Begriffen und Gefühlen eines zahnlosen alten Flaneurs.
MARTIN HALTER
Bernd Cailloux:
"Der amerikanische Sohn". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Martin Halter folgt Bernd Cailloux auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn. Dass die Vater-Sohn-Story eigentlich nebensächlich ist, und der Autor nur gern mal statt am Berliner Tresen in New York Nabelschau betreiben, übers Ende des Hedonismus, das Altern und schwindendes Selbstbewusstsein soziologisieren möchte, geht Halter irgendwann auch auf. Nicht schlimm, findet er. Nur wer ein Roadmovie wie von Wenders erwartet, wird enttäuscht sein, warnt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Der Autor Bernd Cailloux schafft es, in einer Sprache, die frei von Wehmut und Pathos ist, auf der Suche nach seinem Sohn sich selbst auf die Spur zu kommen.« stern 20200702