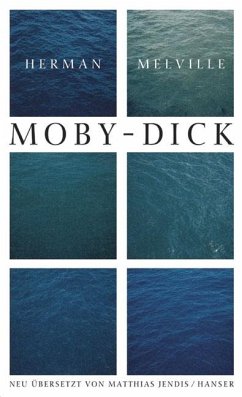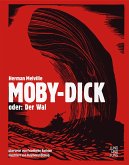"Moby-Dick", einer der größten Romane der Weltliteratur, in einer Neuübersetzung, die Maßstäbe setzt: Die Geschichte des weißen Wals und seines von Haß getriebenen Jägers Kapitän Ahab wird in ihrer unendlichen Vielstimmigkeit, in ihrem Pathos und ihrer Präzision erzählt. Mit einem Anhang, der zu immer neuen Entdeckungen in diesem aus den tiefsten Quellen von Mythos und Philosophie schöpfenden Meisterwerk einlädt.

Der Erzählstrom, in den ganze Weltmeere münden: Herman Melvilles „Moby Dick” als Hörspiel
Nicht nur Ahab jagt Moby Dick, sondern auch Herman Melville. Wenn am Ende der weiße Wal entkommen, Ahab in die Tiefe gerissen, die Pequod zerschmettert, die Mannschaft untergegangen und allein Ismael in Queequegs Sarg dem saugenden Strudel entkommen ist, um als Erzähler zu überleben, hat Melville, anders als Ahab, sein Ziel erreicht. Seine Harpune ist nicht abgeglitten, seine Fangleine hat gehalten. Diese Fangleine ist der Roman, und sie ist während der Jagd zum mächtigsten, vielsträngigsten Tau angeschwollen, das je nach dem Leviathan und seinem Element, dem Meer, ausgeworfen wurde.
Melville hat, um Moby Dick an Bord der Literatur zu holen, die Form des Romans nicht weniger strapaziert als Ahab sein Schiff und seine Mannschaft. Wie der weiße Wal in und auf seinem schrundigen, unförmigen Leib die Eisen, Leinen und am Ende auch die toten Jäger mitführt, die ihn nicht haben zur Strecke bringen können, so führt Melvilles Roman den mythologischen Tang und die literarischen Fangleinen von Jahrhunderten mit. Er habe die Weltmeere durchkreuzt, und er habe die Bibliotheken durchpflügt, sagt der Erzähler im Kapitel „Cetologie”, kurz bevor er daran geht, die Wale in „Foliowale”, „Oktav wale” und „Duodezwale” zu unterteilen.
Nordsee und Pazifik
In den Jugendausgaben von „Moby Dick” fehlt in der Regel diese launige Mimikry mit den Enzyklopädien und den Taxonomien der Naturgeschichte. In den Verfilmungen hat sie gegenüber den Schiffs- und Jagdszenen keine Chance. Was macht man damit in einer Hörfassung? Der Regisseur, Komponist und Autor Klaus Buhlert hat in seine vom Bayrischen Rundfunk und dem Münchner Hörverlag produzierte akustische „Moby Dick”-Version das Cetologie-Kapitel aufgenommen, allerdings in gekürzter Form. Mit fast zehn Stunden Länge ist dies die bisher umfangreichste Hörfassung, und sie hat den Anspruch, allen Seiten der Vorlage gerecht zu werden: dem Rauschen des Meeres wie dem Stimmengewirr der Universalbibliothek, der inneren Mehrsträngigkeit des Melvillschen Taus wie der dramatischen Wucht, mit der es geworfen wird. Gegenüber den Comics oder Jugendversionen sieht diese Fassung aus wie ein großer Fisch, gegenüber dem Roman selbst allenfalls wie ein Quartwal gegenüber einem Foliowal.
Eine Konsequenz der gewissermaßen maßstabsgerechten Verkleinerung der Vorlage ist die Verdoppelung der Erzählerstimme. Rufus Beck als Ismael ist für den Bericht der Ereignisse zuständig, mit einer hellen, gelegentlich etwas zu perlenden Stimme, der man die Melancholie, die diesen Erzähler zu Beginn auf See treibt, und der man die Katastrophe, der er am Ende entronnen ist, ruhig deutlicher anhören dürfte. Felix von Manteuffel, sonorer, gemessener, ist diesem Ismael als Vertreter des Autors Melville beigesellt. Er ist für die philosophischen Einschübe und die mitgeführte enzyklopädische Fracht zuständig.
Das Erzählerduo ist das akustische Rückgrat des Ganzen. Buhlert hat mit gutem Grund darauf verzichtet, den Roman in ein Hörspiel aufzulösen. „Moby Dick” den epischen Gestus nehmen hieße, ihm den Kern zu nehmen: den Erzählstrom, in den ganze Weltmeere münden. Die szenisch-dramatischen Elemente sind in dieser Mischform aus Roman-Vorlesung und Hörspiel stets an das Erzählerduo rückgebunden, aus dessen Prosa sie fugenlos heraustreten und in der sie ebenso selbstverständlich wieder verschwinden.
Die Voraussetzung dafür ist der Verzicht des erfahrenen Rundfunk- Regisseurs Buhlert auf die Entfesselung der Techniken, die in einem modernen Tonstudio möglich wären. Das aus der Prosa hervortretende Hörspiel sucht nicht die Illusion, die so tut, als sei sie das mitgeschnittene Leben selbst. Es sucht die einprägsamen Zeichen, das Tacken von Ahabs Holzbein, das Stürzen eines Masts, das Drehen einer Winde, den Flügelschlag eines Seeadlers. Es gibt keine schwelgende Musik, sondern nur den wunderbar monotonen Refrain ganz und gar nicht gröhlender Seemannsgesänge, in denen der Untergang schon mitschwingt, und ebenso beiläufige wie eindringliche minimalistische Motive zwischen Elektronik und Klavier.
Hermann Lause als Father Mapple steht auf seiner Kanzel in New Bedford im Schatten immerhin von Orson Welles, der in John Hustons Film den Prediger gab. Aber er ist mit seiner durchaus nicht voluminösen, einpeitschenden Stimme eine gute Galionsfigur beim Aufbruch in diese eher sparsame als opulente Hörspiel-Welt, die entschlossen den hanseatisch-norddeutschen Zungenschlag zum Heimatidiom der ausfahrenden Matrosen macht.
In Melvilles „Moby Dick” entspricht dieser Staffelung der Dimensionen der Übergang vom atlantischen in den pazifischen Raum. Der Pazifik gibt der Tragödie Ahabs die Dimension vor: der Atlantik verhält sich zu diesem Katastrophenschauplatz wie die Nordsee zum Atlantik. In der Stimme von Rudolph Taruoura Grün, der aus Tahiti stammt, in Deutschland lebt und den Harpunier Queequeg gibt, klingt der pazifische Raum ohne allen prätentiösen Exotismus an. Diese nach langer Suche gefundene Stimme ist ein Glücksfall für das gesamte Unternehmen.
Der pazifische Ton, der mit Queequeg ins Spiel kommt, macht zugleich auf die Dimension aufmerksam, die der Stimme Ahabs in den Hörspielpassagen fehlt. In dieser Ahab-Stimme ist zu wenig Raum, zu wenig großer Wahn. In ihr überwiegt das Gepresste, Gehetzt-Getriebene, Rumpelstilzchenhafte, die Skala des bösen Bellens bis hin zum Keifen. Das muss nicht an Manfred Zapatka liegen, der, wenn Ahab allein ist, durchaus zeigt, dass er auch anders könnte.
Es liegt an dem hohen, dem allzu hohen Preis, den Buhlert für sein Kürzungsverfahren zahlt. Er bringt zwar alle Facetten des Romans anteilig zur Darstellung, aber es sind nicht alle Seiten dieses Romans vom Hörspiel gleich weit entfernt. So treffen die Kürzungen das Drama, das in „Moby Dick” mit dem Epischen und dem Roman rivalisiert, ungleich härter, als sie die walkundlich- enzyklopädischen Passagen treffen.
Das dramatische Element ist aus Melvilles Kräftemessen mit Shakespeare herausgewachsen, und es gewinnt im Roman in dem Maße an Wucht, in dem er sich der Katastrophe nähert. Es reicht nicht aus, dass diese Hörfassung das Zurücktreten der Einschübe und wissenschaftlichen Abhandlungen mitmacht, wenn das Geschehen dem Ende zustürzt, dass sie in den drei Jagd-Kapiteln die Erzählerstimme über weite Passagen ins dramatische Präsens fallen lässt. Die nicht erst in Melvilles Szenenanweisungen des Schlussdrittels hervortretende Nähe der Ahab-Figur zum Welttheater Shakespeares, die Verwandlung von Meer und Schiff in einen bühnenähnlichen Schauplatz hervorzutreiben – wäre das nicht die genuine Aufgabe gerade einer Hörspiel-Version dieses Buches?
Hexentanz und Wahn
Was Buhlert sich durch den Verzicht auf die „ungerechte”, überproportionale Darstellung der Shakespeare zugewandten Seite entgehen lässt, zeigen die Passagen, in denen der grandiose Thomas Holtzmann als Zimmermann auftritt. Man sehnt sich nach einem ungekürzten Auftritt dieses philosophischen Totengräbers. Aus tiefen, murmelnden Monologen ist diese Figur aufgebaut, wie überhaupt „Moby Dick” seine Nähe zur Bühne und zur Tragödie vor allem in der Konsequenz zeigt, mit der Melville eine Klimax „großer Monologe” in den Fluss der epischen Prosa eingezogen hat.
Die von Buhlert zugrunde gelegte deutsche Übersetzung von Matthias Jendis zeigt ihre Qualität nicht zuletzt daran, dass sie diese Monologe überaus sprechbar gestaltet und für deutsche Ohren mit dem Pathos des Dramas auflädt, indem sie sie in die Nähe des Blankverses rückt. Man kann das etwa bei dem Starbuck von Ulrich Matthes hören, man würde es gern aus Ahabs Mund so hören, dass der Hexentanz aus „Macbeth”, der Wahn Lears, die unbeirrbare Leidenschaft Othellos darin ein Echo findet. Aber allen Protagonisten, von Ahab bis hinab zum Stellvertreter des Shakespeareschen Narren, dem kleinen Pip, ist von ihren Monologen nicht genug geblieben.
Auch so bleiben dieser überaus sorgfältig produzierten Hörspielfassung noch Verdienste genug. Aber hätte sie sich hier anders entschieden und resolut das Interesse am dramatischen Welttheater in „Moby Dick” dem Ideal der proportionalen Kürzung übergeordnet, sie hätte womöglich als Hörspiel mehr gewonnen, als dem Romantext verloren gegangen wäre.
LOTHAR MÜLLER
HERMAN MELVILLE: Moby-Dick oder Der Wal. Bearbeitung, Komposition, Regie: Klaus Buhlert. Sprecher: Rufus Beck, Ulrich Matthes, Bernhard Schütz u.v.a. Der Hörverlag, München 2002. 10 CD, ca. 550 Minuten, 99 Euro.
Rufus Beck (l.), Klaus Buhlert (r.)
Foto: Sessner /
BR
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Von der Sehnsucht, der Natur zu gehorchen: Herman Melvilles "Moby-Dick" in neuer deutscher Übersetzung / Von Joachim Kalka
Es hat lange gedauert, bis die Welt bemerkt hat, was für ein Buch ihr da geschrieben worden ist. 1851 erschien es, lange Jahrzehnte lang blieb es weitgehend unbekannt und unverstanden. Dabei handelt es sich um einen der ganz großen Romane der Welt. Insbesondere natürlich um einen der großen Romane Amerikas. Neben Mark Twains "Huckleberry Finn" war dieses Buch in jener nicht enden wollenden Diskussion, welches denn nun "the great American novel" sei, eigentlich immer der einzige wirklich ernst zu nehmende Kandidat, bis Thomas Pynchon die Parameter verschob. Der große amerikanische Roman, in dem Neuengland in See sticht, um mit dem Walfang viel Geld zu verdienen, und sich auf einer Fahrt auf Leben und Tod wiederfindet, bei der der weiße Wal, das große Andere, der Satan, die Natur selbst gejagt werden soll - und ein großer Traum, eines jener Bücher, die der oft töricht gebrauchten Kategorie "Psychodrama" ein neues Leben geben könnten, ein Buch von Wasser und Wiedergeburt, von monströser phallischer Gewalt und Kastration, von Liebe und Haß und vom Tod. Ein von Särgen gerahmtes Buch: der Held bemerkt auf der ersten Seite, er müsse auf See, um seine Mißlaunigkeit zu kurieren, zu deren Symptomen es unter anderem gehört, daß er automatisch vor jeder Sarghandlung stehen bleibt - und beim Untergang des Schiffes mit Mann und Maus und mit dem großen Seevogel, den Tashtego noch mit seinem letzten Hammerhieb an die versinkende Mastspitze nagelt, rettet ihn der auf den Wellen treibende leere "lebensrettende Sarg", den sein Kamerad Queequeg für sich angefertigt hatte. Ein finsteres, sinistres, großartig befreiendes Buch: "Ich habe", schreibt der Autor in einem berühmten Brief an Nathaniel Hawthorne, "ein sündhaftes Buch geschrieben und fühle mich fleckenlos wie das Lamm."
Der "Moby-Dick" ist mit der seltsamen "Heirat" von Ishmael, dem auf See ausfahrenden Erzähler, und dem Südsee-Harpunier Queequeg und ihrer bis zum Untergang der "Pequod" andauernden innigen Beziehung eine jener großen amerikanischen Liebesgeschichten von unschuldiger Homosexualität, wie sie die Cultural Studies für eine bemerkenswerte Reihe amerikanischer Romane des neunzehnten Jahrhunderts herauspräpariert haben. Doch beginnt Kapitel XXIV zwar damit, daß es heißt, "Sintemal Queequeg und ich nun richtig in dieses Walfanggeschäft eingestiegen sind . . ." - von nun an wird aber diese Liebesgeschichte in den Hintergrund treten und der riesige Schatten Kapitän Ahabs wird über das Deck fallen, auf das Schiff, auf die Weltmeere, und wenn es einen dunkelhäutigen Geliebten gibt, so ist es der geheimnisvolle Fedallah, der mit seinen parsischen Feueranbetern das Walfangboot des Kapitäns bemannt und vor der blutigen Harpunentaufe seinen Fluch oder seinen Segen über das Schmiedefeuer murmelt. Denn dieses große Melodrama, das sich nach seiner langen Ouvertüre an Land, wo spukhafte Vorzeichen drohend aufscheinen, und nach dem langen Warten, bis der geheimnisreiche Kapitän sich endlich einmal auf Deck zeigt, trotz aller komischen und idyllischen retardierenden Passagen und aller nautischen Akribie stetig bei Blitz und Donner und in ungeheuerlichen Stürmen und Wasserwirbeln steigert, ist auch eines der großen Bücher des Satanismus, neben dem "Faust" das wichtigste zwischen Milton und Dostojewski. Ein Buch, dessen vom Maul des Wals verkrüppelter Held bei der Taufe seiner magischen Harpune brüllt: Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli! Als Ahab in dem großen sechsunddreißigsten Kapitel "Das Achterdeck" (wo er die ekuadorianische Dublone als Lohn für den Ausguck, der ihm den weißen Wal zuerst meldet, an den Mast nagelt und alle Männer auf seinen wilden Kampf gegen Moby-Dick einschwört) von seinem Offizier Starbuck mit den Worten zur Rede gestellt wird, ein unvernünftiges Tier aus Rachedurst wie einen menschlichen Todfeind zu jagen, sei nahezu Blasphemie - da folgt einer der großen exaltierten Ausbrüche des Kapitäns. Hinter der Maske dieses Tieres liegt etwas anderes, vielleicht liegt dort auch gar nichts mehr - aber: "Wenn der Mensch schlagen will, so schlage er durch die Maske! Wie kann der Häftling denn ins Freie, wenn er die Mauer nicht durchbricht? Für mich ist der weiße Wal die Mauer, dicht vor mich hingestellt . . . Ich würde selbst die Sonne schlagen, wenn sie mich beleidigt."
Ahab ist ein titanischer, aber verrückter Wille, der mit einem jener erstaunlichen, jenseits der unfreiwilligen Komik bereits wieder unheimlichen Sätze Melvilles das Elmsfeuer anherrscht: "Inmitten des personifizierten Unpersönlichen steht hier eine Persönlichkeit!" Nicht Carlyle, nicht Emerson, nicht Nietzsche haben - wie Newton Arvin bemerkt - die Ekstase des idealen Individualismus je mit größerem Pathos ausgedrückt. Das Buch gehört zu den Grenzformen der Erhabenheitsästhetik, die es gleichzeitig zerbricht. Und es ist von einer großartigen Widersprüchlichkeit - Ahab, der nicht mehr weiß, ob er gegen den grausamen Vatergott des Puritanismus kämpft oder gegen die ungeheure, ungerührte Natur, deren paradoxer Weiße sich alle Wahnvorstellungen einschreiben lassen; der Roman, der am Ende nicht mehr zu wissen scheint, wer das Ungeheuer ist, der wahnsinnige Seemann, der noch im Tode "aus dem Herzen der Hölle" nach dem Wal sticht, oder das titanische Stück Meeresleben, spielerisch, heimtückisch, unbegreiflich.
Das hat Züge einer im neunzehnten Jahrhundert endgültig untergehenden Form: der Allegorie. Melville hat in einem Brief an Sophia Hawthorne mit undurchdringlicher Höflichkeit bemerkt, erst seit dem Brief ihres Gatten sei ihm klargeworden, daß das Ganze seines Romans durch und durch allegorischen Charakter habe. Das ist ironisch. Er hat den so staunenswert sorgfältig geplanten und in seinen einzelnen Partien so raffiniert verknüpften Roman von Anfang an als großes allegorisches Kunstwerk angelegt, doch mit komplexem, uneindeutigem "vielfachem Schriftsinn". Der "Moby-Dick" ist ein Weltbuch, und nicht umsonst ist die ganze Welt an Bord des Yankee-Schiffes "Pequod" gegangen, Seeleute aus China und von den Azoren, aus Dänemark und Tahiti, Sizilien und Belfast, Frankreich und Malta sind an Bord, und die drei Harpuniere sind ein Indianer, ein Neger und ein Polynesier. Alle gehen sie mit dem amerikanischen Schiff unter. Bis auf den Erzähler, der das Buch Hiob zitiert: "Und ich allein bin entronnen, daß ich dir's ansagte."
Das Singuläre des Romans liegt in der Verflechtung dieses grellen und profunden Mysterienspiels mit einer fast wissenschaftlichen Präzision der Meteorologie, Zoologie, Soziologie, so daß es nicht ganz verwunderlich ist, wenn das Buch in manchen amerikanischen Bibliotheken des neunzehnten Jahrhunderts unter "Walfang" stand. In barocker Einkleidung werden all diese Einzelheiten kunstreich verfremdet präsentiert, vor allem das biologische Detail des Romans wird oft humoristisch oder symbolisch aufgefaßt, aber alles ist von einer reich ausgeführten Genauigkeit, einer Welthaltigkeit und Welthaftigkeit, deren Dichte wirkt wie ein spezifischer Lösungsversuch des amerikanischen Idealismus für seine Anschauungsprobleme. Kürzlich hat Niels Werber virtuos die seltsamen Verknüpfungen des "Moby-Dick" mit jener politischen Reflexion vorgeführt, die sich von Hobbes bis Schmitt auf das metaphorische Bild des Leviathans konzentriert hat. Auch das ökonomische Substrat breitet der Roman in hinreißendem Detail von Gewinnanteilen und Schiffszwiebacksrationen aus; deutlich geschildert und für unsere Generation gewiß besonders eindrücklich wahrnehmbar ist ebenfalls der ökologische Kontext einer gierigen, Tiere schlachtenden, die Welt nach Beute durchstreifenden Industrie. Und die Naturbeute wird vom verrückten Helden des Unternehmens als bedrohliches Anderes, als zu vernichtender Feind phantasiert. Die Worte des braven Starbuck bleiben vergeblich, als der Wal davonzuschwimmen scheint: "Ach, Ahab! . . . Noch ist es nicht zu spät, um abzulassen, selbst jetzt am dritten Tage nicht. Sieh nur, Moby-Dick stellt dir nicht nach. Du bist's, der ihm in deinem Wahne nachstellt!"
Wie so viele berühmte und kanonische Bücher wird auch der "Moby-Dick" selten gelesen. Jetzt ist, würdige Feier der hundertfünfzigsten Wiederkehr des Erscheinungsjahres, eine neue deutsche Übersetzung erschienen - und als ihre Kritik, ihr weißer Schatten, gleich eine zweite, die sozusagen einmal die erste war und nun eine leidenschaftliche Gegenrechnung aufmacht. Beide Versuche scheinen mir, so sehr sie immer noch gegensätzlich sind, bedeutend. Wie einige andere große Bücher dürfte der "Moby-Dick" zwar ein Text sein, dem auch durch die unzulänglichen Übersetzungen der Vergangenheit nicht wirklich zu schaden war. Doch war eine möglichst genaue und durchdachte Übersetzung ein großes Desiderat, das nun quasi doppelt und mit agonaler Dramatik eingelöst worden ist. Daß diese zwei Übersetzungen aufeinandertreffen, ist von besonderem Interesse, weil sie beide auf hohem Niveau noch einmal (in sich) die Auseinandersetzung mit dem Schleiermacherschen Postulat führen, das Fremde sei nicht dem Eigenen anzuverwandeln, sondern zu betonen.
Matthias Jendis' gelungene Übersetzung, die sich erstmals auf einen gesicherten Originaltext bezieht, stellt sich auf die Seite der Lesbarkeit - aber nicht in dem trivialen Sinne einer Nivellierung des Fremden. Sie geht sehr weit ins Idiosynkratische. Sie beeindruckt durch eine genaue Herauspräparierung der vielen Einzelformen und Sprachfelder, derer sich Melville bedient, der chronikalischen, theatralischen, juristischen, theologischen und so weiter; zu den Einzelheiten findet man noch einen wertvollen, über hundert Seiten langen Kommentaranhang von Daniel Göske, dem Herausgeber der Werkausgabe. Es ist hier so viel Sorgfalt auf das Detail verwendet worden, daß es nicht kleinlich wirken kann, wenn ich sage, daß vieles trotzdem noch unpräzise geblieben ist, und einige wenige zusätzliche kritische Hinweise hersetze. Der durchgängige Bezug auf den von Melville so sehr verehrten Shakespeare scheint manchmal nicht erfaßt; ich beschränke mich auf ein einziges Beispiel: Die "blasted heath", die sich gleich in Kapitel III auf dem Wirtshausschild abzuzeichnen scheint, ist ein Macbeth-Zitat und sollte wohl nicht als "verbrannte Heide", sondern als die berühmte "dürre Heide" der ersten Hexenbegegnung in Dorothea Tiecks Übersetzung wiedergegeben werden.
Die versteckten Blankverse Melvilles sind ein Problem eigener Art. In Kapitel CII wird (mit den schönsten der heimlichen Verse) ein gigantisches Walskelett beschrieben, das auf einer der Arsakideninseln ruht und ganz von grünen Ranken überwachsen ist. Der tote Wal selbst scheint in seiner müßiggängerischen Ruhe der kunstreiche Weber der eigenen Vegetationshülle zu sein: "The mighty idler seemed the cunning weaver, / himself all woven over with the vines." Im Gegensatz zu anderen Stellen ist hier bei Jendis nichts von der Kadenz des Originals übriggeblieben; er schreibt einfach: "da schien es so, als sei der gewaltige Nichtstuer selbst jener kunstvolle Weber, über und über in Ranken verwoben . . ." Hier könnte etwa stehen: "Der große Schläfer schien der kluge Weber, selbst gänzlich überwoben von dem Grün". Doch all das kann eigentlich nur belegen, daß eine solche Arbeit niemals ganz an ihr Ziel kommen kann.
Belle infedele, brutte fedele - Übersetzungen sind wie Frauen, will eine ungalante italienische Wendung wissen, entweder schön und untreu oder unschön und treu. Im alten Kampf der beiden Richtungen der Übersetzungsästhetik verkörpert die andere Übersetzung von Friedhelm Rathjen die Position der brutte fedele geradezu auftrumpfend. Er will der bruttezza eine neue Bedeutung verleihen, dem Original unter Verzicht auf eine eigen ausgeprägte Sprache unbedingt "replizierend" folgen, er privilegiert das "Distanzbetonende" zuungunsten des "Näheschaffenden". Das hat eine großartige Radikalität, und er schreibt mit einer Offenheit, die der Kritik viel von ihrem Wind aus den Segeln zu nehmen sich anschickt: "Daß dabei ein ausgesprochen schlechter Sprachstil herausgekommen ist, ist mir nicht nur klar, sondern ja gerade die Absicht." Er hat zur Erhärtung seines Anspruchs eine substantielle Partie (Kapitel XXIV bis LII) jener Übersetzung, die ursprünglich für die Hansersche Ausgabe bestimmt war, nun in der weißen Nummer 57 des "Schreibheft" erscheinen lassen.
Die Leser können, wenn sie es wünschen, Melville nun im Vergleich der beiden Versionen lesen. Meistens können sie mit Jendis hochzufrieden sein; viele werden außerdem Rathjens vertrackte Übersetzung als Stimulans empfinden. Doch exemplifiziert sein Vorgehen auch die Gefahren, die für den Übersetzer im Besitz einer Theorie liegen. Rathjen scheint gelegentlich geradezu zum Zwecke der Illustration seiner Theorie zu übersetzen.
Ein Beispiel: "In one of the mighty triumphs given to a Roman general upon his entering the world's capital, the bones of a whale, brought all the way from the Syrian coast, were the most conspicuous object in the cymballed procession." Jendis: "Auf einem der großen Triumphzüge, die einem römischen General bei seinem Einzug in die Hauptstadt der Welt gewährt wurden, waren die Knochen eines Wals, die man den ganzen langen Weg von der syrischen Küste herbeigeschafft hatte, das auffälligste Schaustück des zimbelklingenden Festzugs." Rathjen: "Bei einem der mächtigsten Triumphzüge, wo einem römischen General bei seinem Einzug in die Hauptstadt der Welt dargeboten, waren die Knochen eines Wals, den ganzen langen Weg von der syrischen Küste hergeschafft, das augenfälligste Schaustück in dem bezimbelten Festzug."
Beide Übersetzer wollen die Wiederholung des "bei" vermeiden, das sich in "bei seinem Einzug" aufdrängt, und schreiben deshalb entweder "auf" (statt: "in") oder, besonders unschön, "wo einem römischen General . . .". Den Verzicht auf das "wurde" nach dem "dargeboten" ist nicht ungefährlich, weil diese Form von Archaisierung leicht aufgesetzt wirkt. "Bezimbelt" finde ich töricht, aber es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für Rathjens sich gelegentlich der Verzweiflung nähernden Versuch des unbeirrten "Replizierens", bei dem aus den Kontingenzen der Grammatik und Syntax des Englischen ein Prinzip abgeleitet wird, dessen ästhetische Bedeutung mir zwar klar ist, dessen unterstellte Wirksamkeit ich aber trotz allem sehr oft nicht erkennen kann. Man kann getreulich Replik an Replik setzen, und es wird nicht immer ein Echo des Textes antworten.
In seinem Exemplar der Essays von Matthew Arnold hat Melville einen von Arnold zitierten Spinoza-Satz angestrichen, der auf eine paradoxe Art und Weise mit seiner großen Saga von Meer und Teufelspakt zusammenzuhängen scheint: "Unsere Sehnsucht ist nicht, daß die Natur uns gehorchen möge, sondern im Gegenteil, daß wir der Natur gehorchen mögen." Sein Walfang- und Teufelsbündlersroman ist profund aufklärerisch. Nicht umsonst erzählt er uns, daß aus Walrat die besten Kerzen gemacht werden, aus Waltran das am hellsten brennende Öl verfertigt wird.
Herman Melville: "Moby-Dick oder der Wal". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Matthias Jendis. Carl Hanser Verlag, München 2001. 1043 S., geb., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Die Neuübersetzung von Herman Melvilles "Weltbuch" kann Rezensent Joachim Kalka natürlich nicht besprechen, ohne noch einmal die herausragende Bedeutung des Originals hervorzuheben. Das "Singuläre" dieses Romans sieht er in der Verflechtung des "grellen und profunden Mysterienspiels" mit einer "fast wissenschaftlichen Präzision der Meteorologie, Zoologie, Soziologie". Auch sei "Moby Dick" eines der großen Bücher des Satanismus "neben dem Faust, das wichtigste zwischen Milton und Dostojewski". Matthias Jendis Neuübersetzung findet Kalka gelungen. Sie beziehe sich erstmals "auf einen gesicherten Originaltext". Übersetzer Jendis beeindruckt den Rezensenten durch "eine genaue Herauspräparierung der vielen Einzelformen und Sprachfelder", derer sich Melville bedient habe. Zu Einzelheiten findet man Kalka zufolge auch "einen wertvollen, über hundert Seiten langen Kommentaranhang von Daniel Köske", dem Herausgeber der Werkausgabe. Trotzdem ist in den Augen des Rezensenten vieles "unpräzise geblieben". Melvilles Shakespeare-Anspielungen blieben wohl manchmal ebenso unerkannt, wie dessen "versteckte Blankverse". Recht ausführlich widmet sich Kalka auch Friedhelm Ratjens Übersetzung, ("die zweite (Neuübersetzung, die ursprünglich mal die erste war") Viele Leser, glaubt Kalka, werden diese "vertrackte" Übersetzung als "Stimulans" empfinden. Kalka selbst bevorzugt die Jendis-Version; weil sie sich auf die Seite der Lesbarkeit stellt, wohingegen Ratjen "gelegentlich geradezu zum Zweck der Illustration" seiner Theorie übersetze, manchmal am Rand des Törichten.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
"Es hat lange gedauert, bis die Welt bemerkt hat, was für ein Buch ihr da geschrieben worden ist." Joachim Kalka, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.11.01
Dieses Werk mit all seinem Geheimnis, es rollt dahin; es steigt an und fällt ab wie das Gebirge, wie der Sturzbach und das Meer. Er reißt uns fort und schlägt über uns zusammen." Jean Giono
"Melville hat vier Jahre seiner Jugend auf Walfangbooten und Kriegsschiffen verbracht und hatte mit Taifunen und Windstillen höllische und arkadische Abenteuer zu bestehen. Hier sammelte er den Stoff, den er später in seine Werke einschmolz." Cesare Pavese
"Was für ein Buch hat Melville da geschrieben! Ich finde darin eine viel größere Kraft als in allen seinen Büchern davor." Nathaniel Hawthorne
Dieses Werk mit all seinem Geheimnis, es rollt dahin; es steigt an und fällt ab wie das Gebirge, wie der Sturzbach und das Meer. Er reißt uns fort und schlägt über uns zusammen." Jean Giono
"Melville hat vier Jahre seiner Jugend auf Walfangbooten und Kriegsschiffen verbracht und hatte mit Taifunen und Windstillen höllische und arkadische Abenteuer zu bestehen. Hier sammelte er den Stoff, den er später in seine Werke einschmolz." Cesare Pavese
"Was für ein Buch hat Melville da geschrieben! Ich finde darin eine viel größere Kraft als in allen seinen Büchern davor." Nathaniel Hawthorne