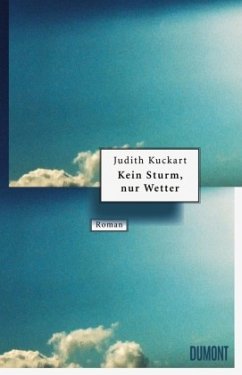Sonntagabend, Flughafen Tegel: Im Café in der Abflughalle kommt sie mit einem Mann ins Gespräch. Robert Sturm ist sechsunddreißig, achtzehn Jahre jünger als sie. Er ist auf dem Weg nach Sibirien. Am Ende ihrer und seiner Arbeitswoche wird er zurückkommen. Am Samstag. Darauf wartet sie ...Als sie 1981 mit achtzehn nach Westberlin kam und Medizin studierte, lernte sie Viktor kennen, der doppelt so alt war wie sie. Er war die andere, die politische Generation und eröffnete ihr die Welt. Er selbst jedoch blieb ihr verschlossen. Das Leben mit Viktor war ein Abenteuer, aber eines, dessen Gefahren sie nicht teilten. Mit sechsunddreißig - inzwischen in Neurobiologie promoviert - trifft sie zur Jahrtausendwende Johann. Er ist so alt wie sie. Gemeinsam hangeln sie sich durch ihre Liebe; prekär sind nicht nur ihre Arbeitsbiografien. Samstagvormittag, wieder Flughafen Tegel: Sechs Tage lang haben ihr Alltag und ihre Erinnerungen sich verwoben und einander zu erklären versucht. Warum sind dieMänner in ihrem Leben immer sechsunddreißig? Ist sie noch die, an die sie sich erinnert? Oder ist sie, die sich in Sachen Gehirn auskennt, eigentlich das, was sie vergessen hat?

Wo sind die Erinnerungen, wenn man sie nicht hat?
Judith Kuckarts beeindruckender Neuro-Roman „Kein Sturm, nur Wetter“
VON HUBERT WINKELS
Dass Künstler, besonders Schriftsteller, im Innersten Melancholiker seien, ist ein alter romantischer Topos. Im Endlichen suchen sie die feinsten Spitzen des Unendlichen zu fassen, und ihr Suchen bringt das Schöne als Vorschein des Allumfassenden hervor. Die Literatur ist hier einschlägig unterqualifiziert, ist ihr sprödes sprachliches Ausgangsmaterial doch endlos weit von der glücklichen Fülle der Welt entfernt. Nun arbeiten die klugen und dramaturgisch geschickten unter den romantischen Köpfen an dem Problem, das Unfassbare der Sehnsucht ohne Sentimentalität und Pathos in bündiger Gestalt zu bannen. Also Tschechow werden statt Nikolaus Lenau.
Judith Kuckart hat, blickt man zurück auf ein gutes Dutzend ihrer Romane, Erzählungen und Theaterstücke, ein halbes Leben lang Anlauf genommen, probiert und destilliert, um aus dem emotionalen Stoff des überwältigenden Liebeswunsches und der profanen Zeitgenossenschaft Geschichten zu entwickeln und zu einer zugleich mitreißenden wie strengen Form zu kommen. Sie hat die Wünsche und die Vergeblichkeitsgefühle ihrer Liebenden und Leidenden gekoppelt an die deutsche politische und Gesellschaftsgeschichte, an die NS-Zeit, an die RAF-Zeit, an die Zeit der Wiedervereinigung. Noch in ihrem neuen Roman „Kein Sturm, nur Wetter“ zitiert sie Rainer Werner Fassbinder: „Was man tut, soll eine Aussage sein über die Zeit, in der es entstanden ist.“ Nur kommt dieses Zitat in diesem Roman einer Irreführung des Lesers gleich. Denn Judith Kuckart nutzt die Zeitgeschichte und den heutigen Alltag vor allem dazu, die Listen und Tücken des fast abstrakt aufgefassten Begehrens sichtbar zu machen. Sie hat ihre Kunst des Destillierens von grobem Gesellschaftsstoff weitergetrieben zur poetisch-rhetorischen Komposition von Feinaromen. Die motivischen und metaphorischen Bezüge des ganz und gar szenisch konkret aufgebauten Romans „Kein Sturm, nur Wetter“ ergeben zugleich einen narrativ durchgestalteten Essay über die Liebe, das Altern und den Tod. Der Roman provoziert ein spontanes Mitfiebern und -leiden und will gedacht sein wie eine Abhandlung – ein Doppelglück für aufmerksame Leser also.
Es beginnt mit dem Aufenthalt einer vierundfünfzigjährigen einsamen Frau am Flughafen Tegel, der wir durch eine Berliner Woche und zugleich durch ihr ganzes Liebesleben folgen werden. Beim Bier lernt sie einen attraktiven sechsunddreissigjährigen Mann kennen, der in den nächsten Minuten in ein Flugzeug nach Sibirien steigt. In einer Woche kehrt er zurück. So lange ist dieser Mann namens Sturm so weit weg, dass sie ihr Begehren ganz ungefährdet durch seine Präsenz auf ihn richten kann, um in diesem Kraftfeld die Leidenschaften und Abbrüche ihres ganzen Lebens wieder spüren zu können. Sie wird bis zu seinem Haus in Kreuzberg vordringen und sie wird seine schwangere Frau kennenlernen, eine leibhaftige Versicherung gegen ungewollte Übergriffe ihrer Träume in die Realität, und sie wird Sturm nicht einmal dann wiedersehen, wenn er eine Woche später an derselben Stelle in ihrer Anwesenheit landen wird. In diese Rahmenkonstruktion sind nun zwei langjährige Beziehungen zu Männern und eine zur einstmals besten Freundin eingehängt, und an ihnen befestigt wiederum eine Fülle weiterer Binnengeschichten, die bis zur Schulzeit am Rande des Ruhrgebiets zurückreichen. Jede dieser Geschichten ist aus der vorhergehenden abgeleitet, meist über die Ähnlichkeit der Gefühle, manchmal über scheinbar zufällige Äußerlichkeiten, manchmal über Metaphern oder das Gedächtnis prägende starke Dinge, allesamt gleiten sie auseinander hervor und ineinander hinein, bruchlos, in einer Bewegung. Die Zäsuren der sieben Tage zwischen Sturm und Nicht-Sturm bleiben äußerlich. Warum ist das so? Weil die Erinnerung so funktioniert, spürt die Sehnende und weiß die Neurologin. Weil außerhalb der Erinnerung nichts ist, weil außer der Erinnerung alles nichts ist. Selbst die Gegenwart, so die mehrfach durchgespielte Versuchsanordnung, ist immer schon vergangene Zukunft. Beim ersten Mann namens Viktor haben wir den temporallogischen Fall, dass er in der gegenwärtigen Geliebten immer schon die vorhergehende sieht. Im Fall von Johann, dem zweiten Lebensgefährten, ist es umgekehrt: Sie erkennt in den intensiven Szenen immer schon den Abschied, sie blickt auf ihn und sich aus der Zukunft zurück. Die Souveränität dieser Konstruktion ist beeindruckend. In sieben Tagen lässt die melancholische Heldin die Liebe prägende und Liebe durchkreuzende Zeitstruktur der Vergangenheit an sich vorbei- und in sich hineingleiten.
Natürlich kann man den Roman auch vornehmlich unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten lesen oder existenziell-identifikatorisch. Im ersten Fall haben wir es mit einer älter werdenden Frau zu tun, die sich zahlenmagisch an vergangene Lieben ihres Lebens erinnert. Alle achtzehn Jahre verliebt sie sich heftig. Jetzt ist sie vierundfünfzig, ihre Liebhaber sind immer sechsunddreißig. Sie hat Angst vor dem Alter, sie meditiert über den Tod, besucht den Friedhof neben dem Haus von Sturm, erinnert sich an ihre Nahtoderfahrung als Kind, als sie nach einem ärztlichen Fehler dem weißen Rauschen schon einmal anheimgegeben war. Selbst dieser unheimliche Arzt bekommt eine erotische Aura. Zudem hat die Doktorin der Medizin nie ihrer Ausbildung gemäß gearbeitet. Aus Angst vor den Patienten, wie es einmal heißt. Sie hat bessere Bürojobs in diversen Laboren und lebt in prekären Verhältnissen in Berlin und mit Johann in Düsseldorf, auch er beruflich absteigend, schließlich als Putzmann tätig.
Im zweiten, dem identifikatorischen Fall, haben wir es mit der Bildlichkeit des meist männlich gedachten einsamen Flaneurs,hier also der Flaneurin und der traurigen Liebhaberin zu tun; der ewige Regenmantel wandelt durch den Roman, das Zippo-Feuerzeug klackt, und die Anzeigen ferner Städte an der Abflugtafel des Flughafens klacken ebenfalls mechanisch und melancholisch. Dies alles, so gefühlsmäßig ansteckend es erzählt ist („Ansteckende Gefühle“ heißt die Doktorarbeit der Heldin), wird überwölbt und geprägt von den intrikaten zeitlichen Verhältnissen zwischen Gegenwartsglück und Nachträglichkeit, und wie sie die Erzählweise selbst bestimmen. Gehen wir an einer willkürlich ausgewählten Stelle einer der Binnengeschichten, eine gute Seite lang, etwas genauer nach: Die Heldin besucht in der Erzählgegenwart (Sturm in Sibirien) den Friseur; dieser geht in ein Kabuff, um Kaffee zu machen, und zwar so, wie sie es aus der Zeit kennt, da sie als ausgebildete Ärztin auf der Neurochirurgie gearbeitet hatte; damals erfuhr sie bei der Morgenbesprechung von den Einlieferungen der Nacht; der Friseur fragt nach Milch und Zucker; sie sieht auf die Uhr; es ist kurz vor vier; sie ist vierundfünfzig (drei mal achtzehn); mit achtzehn hatte sie Viktor kennengelernt; der war sechsunddreißig (zwei mal achtzehn); mit sechsunddreißig hatte sie den gleichalten Johann kennengelernt; dass sie im Alter noch schöner werde, hatte Johann damals gesagt; ein noch so eben junges Paar; sie saßen auf der Kühlerhaube eines weißen Mercedes, ein immer wiederkehrendes Bild des Glücks im Roman; das hatte sie mit Worten beschreiben wollen, als es sich einstellte, obwohl sie keine Schriftstellerin war; und dann saß ihre Oma, die sie großgezogen hatte, in ihrer Vorstellung auf einmal mit auf dem Mercedes und erzählte ihr von einem Apfelbaum von früher, unter dem sie im Kinderwagen gelegen und „die Unterseite seiner Blätter angestrampelt“ hatte; ob das der Augenblick des wirklichen Glücks war, fragt sie sich; was ihr die Neuropsychologie darüber sagen kann; ob das Studium des Gehirns hilft, die Frage zu beantworten, die sich durch das ganze Buch zieht: Wo sind die Erinnerungen, wenn man sie nicht hat.
Das ist eine verdichtete Kette der Erinnerungsfolgen, aus denen „Kein Sturm, nur Wetter“ besteht. Jeder Moment verschiebt sich rasch zu einem anderen hin, alle sind an einer Vorstellung vom Glück orientiert, das sich immer wieder und unaufhaltsam entzieht, und alle spiegeln sich ständig und in häufig wiederkehrenden Bildern ineinander. Die Struktur der Erzählung ist auf Wiederholung angelegt, ähnlich wie die Erfahrung des Lebens selbst. Wiederholung mit Variation – und einem gewissen verhaltenen Furor. Das erinnert sicher nicht zufällig bei der aus Wuppertal stammenden früheren Tänzerin und Choreografin Judith Kuckart auch an ihr Vorbild Pina Bausch, die in ihrem Tanztheater einzelne Gefühle tanzen ließ, bis sie eine strenge Form dafür fixieren konnte. Und dies häufig zur Musik des Tangos. Auch eine Bühne mit Tango tanzenden Paaren könnte man im Roman sehen; kein Fado, dazu will die Erzählung zu viel; ein Tango; ein Paar lässt sich vorne an den Bühnenrand reißen und verschwindet sogleich wieder im Hintergrund; aufstrahlend und weg!
Judith Kuckart: „Kein Sturm, nur Wetter“. Roman. DuMont Buchverlag, Köln 2019. 221 Seiten, 22 Euro.
Die motivischen Bezüge ergeben
einen Essay über
die Liebe, das Altern, den Tod
Man könnte in dem Roman
eine Bühne mit
Tango tanzenden Paaren sehen
Der Flughafen wirkt in Kuckarts Roman wie ein Schutzschild gegen kommende Enttäuschungen.
Foto: Bloomberg/Getty images
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Im Abstand von jeweils achtzehn Jahren: Judith Kuckart erzählt in "Kein Sturm, nur Wetter" von der emanzipatorischen Kraft des Erinnerns
"Wünsche" heißt ein Roman Judith Kuckarts aus dem Jahr 2013, in dem eine Frau am Silvestermorgen den Ausbruch aus ihrer Ehe und einer nordrhein-westfälischen Kleinstadt versucht - Wünsche, so lautete zugleich der Nachname zweier Figuren dieses Buchs. Auch in Kuckarts jüngstem Roman trifft man auf diese Vorliebe für sprechende Namen, in denen sich die innere Verfasstheit der Protagonistin spiegelt: "Kein Sturm, nur Wetter" lautet der Titel. Bei jenem Sturm, Robert mit Vornamen, handelt es sich um eine flüchtige Bekanntschaft, die die Erzählerin am Berliner Flughafen Tegel macht.
Einen Namen hat die Erzählerin selbst bezeichnenderweise nicht, vierundfünfzig Jahre ist sie alt - eine wichtige Angabe, denn sie wiederum hat ein Faible ("Spleen" träfe es auch) für Zahlen, insbesondere für die Achtzehner-Reihe. Als sie achtzehn Jahre alt war, verliebte sie sich in einen Sechsunddreißigjährigen, Viktor. Mit 36 hatte sie einen gleichaltrigen Freund, Johann. Nun, alleinstehend mittlerweile, soll ihre Sehnsucht wiederum einem Mann gelten, der 36 Jahre zählt. Ganz zufällig ist die Begegnung mit Robert Sturm nicht: Gezielt fährt die namenlose Frau abends zum Flughafen, um zwischen den Ankommenden und Abfliegenden jemanden zu finden, der ihr gefallen könnte und der im passenden Alter ist.
Ein gemeinsames Getränk, dann fliegt Robert Sturm für eine Woche nach Sibirien, um Ölraffinerien mit Kompressoren auszustatten. Die Erzählerin aber hat, was sie braucht: eine Visitenkarte, heimlich aus seinem Portemonnaie gezogen, um in der Manier einer Verliebten in den folgenden Tagen durch Sturms Kiez zu schlendern, gar nachts von einer benachbarten Telefonzelle aus in dessen Wohnung anzurufen und den Umriss einer unbekannten Frau zu beobachten, der sich hinter dem Fenster abzeichnet, während diese zu ergründen versucht, wer am anderen Ende der Leitung ist.
Vor allem aber braucht die Erzählerin diesen Robert Sturm für etwas anderes: als Adressaten der Erzählung über ihr Leben, als denjenigen, der ihre Erinnerung nicht nur in Gang setzt, sondern dem sie ein Bild von sich entwerfen kann. Dass Sturm die Erzählerin nicht hört, dass er ihr Gesicht schon vergessen haben mag, bald nachdem er ins Flugzeug gestiegen ist, spielt keine Rolle. "Dass Sturm nicht da ist und sie nicht dort", denkt sie am Mittwoch der Woche, die den zeitlichen Rahmen des Romans bildet, "ergibt einen dritten Ort, so wie minus mal minus ein Plus wird. Sie hat ihn soeben neben sich gespürt. Und was man gefühlt hat, ist, was man erlebt hat. Auch das weiß sie. Aus dem Leben und aus der Wissenschaft. Deswegen ist sie Neurobiologin geworden."
In jenem vermeintlichen Paradox offenbart sich nur einer der Horizonte, die Judith Kuckart in ihrem Roman aufreißt und auf unangestrengte Weise mit neurobiologischem Wissen unterfüttert: Kann Vorstellung das Erleben, kann eine erdachte Erinnerung das Nichterfahrene ersetzen? Und umgekehrt: Wie formt uns das, was wir vergessen zu haben scheinen? Wie viel sehen wir von einem Menschen, den wir zu lieben und zu kennen meinen - vielleicht nur ein paar Details, und das Übrige erfindet und ergänzt unser Gehirn und blendet anderes aus? Aber wie? Automatisch? Willkürlich? Nach unseren Vorlieben oder doch zumindest so, dass es uns erträglich scheint?
Wenn Kuckarts Erzählerin sich etwa an den achtzehn Jahre älteren Viktor erinnert - auch ihn hat sie einst an einem anonymen Durchgangsort getroffen, am Bahnhof Zoo -, dann hat es den Anschein, als ob in der Beziehung zu diesem Mann nicht das Ergänzen, sondern das Vermögen zum Ausblenden eine wenn nicht Überlebens-, so doch Liebesstrategie sein musste. Nur ganz zu Anfang ihrer Zweisamkeit versucht die Erzählerin Viktor zu ergründen. Mit einem Kleiderbügel öffnet sie einen Rollschrank, in dem sich die Zeugnisse seines heimlichen Begehrens finden. Viktor ertappt sie, unbemerkt ist er in die Wohnung zurückkehrt. Das Lachen, das er ausstößt, klingt wie der Schrei eines Pfaus, ängstlich, verletzt und angriffslustig gleichermaßen. Der Schrank wird bleiben während der gemeinsamen fünfzehn Jahre, öffnen wird die Erzählerin ihn nicht mehr.
Ebenso leichtfüßig und musikalisch wie Judith Kuckart in "Kein Sturm, nur Wetter" zwischen der Gegenwart und dem Erinnern abzuwechseln versteht, so selbstverständlich und unsentimental vermag sie existentielle Fragen zu stellen, ohne Antworten mitzuliefern, darauf etwa, ob die Erzählerin bis dato ein glückliches Leben geführt oder sich selbst darum betrogen hat. Oder darauf, ob sie die Männer braucht, um sich selbst entwerfen zu können - oder ob ihre Stärke gerade in der scheinbaren Zurückgenommenheit liegt. Denn eine weitere Erzählebene, im Schriftbild des Romans abgesetzt durch Schreibmaschinenlettern, eröffnet eine Art Einblick in die Werkstatt: zeigt den Plan derjenigen, die da erzählt, ihre Verfügungsgewalt über das Material, ihre Möglichkeit, den Stoff zu variieren und zu arrangieren.
Die Ungewissheit, die Schwebe - hier vielmehr: das Schwebende - aber muss bei alledem ausgehalten werden, genauso wie die Einsicht in eine universelle Einsamkeit, die vielleicht noch schwerer wiegt in dieser merkwürdigen Konstellation, die sich Paar nennt. Kuckart verleiht ihr eine herbe Grazie.
Weniger offen - und hier wird "Kein Sturm, nur Wetter" auf subtile, kluge Weise auch zu einem politischen Roman - bleibt es hingegen, wo Kuckart auf die Bedingungen der Herkunft schaut. Vor diesen, das wird verschiedentlich deutlich, gibt es kaum ein Entkommen. Auch die Erzählerin bewegt sich im Korsett ihrer sozial prekären Kindheit und wird, anders als ihre aus privilegierten Verhältnissen stammende Freundin, trotz ihrem Studium keine Karriere machen, sondern sich als Sekretärin und Lektorin verdingen. Es gibt, so kann man Kuckart lesen, ohne dass sie es explizit aussprechen müsste, diejenigen, die mit aller Selbstverständlichkeit in die Chefetagen aufsteigen, und jene, die dazu befähigt wären, die es sich aber nicht zugestehen und so zeitlebens Dienende bleiben. Vielleicht handelt es sich nur um das Unvermögen, sich selbst anders zu denken?
Eine Woche nachdem er abgeflogen ist, wird Robert Sturm von seiner Reise nach Sibirien zurückkehren. Die Erzählerin fährt nach Tegel. Treffen wird sie Sturm nicht. Aber während der sieben Tage, an denen sie ihm ihr Leben erzählt hat - und das so, wie sie es erzählen will -, hat sie sich zweifelsohne einmal durchwehen lassen und zumindest ein wenig neu und anders wieder zusammengesetzt.
WIEBKE POROMBKA
Judith Kuckart: "Kein Sturm, nur Wetter". Roman.
DuMont Buchverlag, Köln 2019. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main