S.291 ff
2. Was vom Kapitalismus übrig bleibt
Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Karl Marx, Das Kapital
Der biopolitische Zyklus des Gemeinsamen
Der Schlüsselbegriff für das Verständnis heutiger Wirtschaftsproduktion ist das Gemeinsame, als Produktivkraft ebenso wie als Form, in der Reichtum produziert wird. Aber das Privateigentum hat uns, wie Marx sagt, dumm gemacht, so dumm, dass wir blind sind für das Gemeinsame! Es hat den Anschein, als könnten Ökonomen und Politiker die Welt nur als in öffentlich und privat aufgeteilt betrachten, entweder im Besitz von Kapitalisten oder unter der Kontrolle des Staates, als gäbe es das Gemeinsame nicht. Tatsächlich erkennen die Ökonomen das Gemeinsame, aber sie siedeln es im Allgemeinen außerhalb der spezifisch ökonomischen Verhältnisse an und sprechen von "externen Ökonomien" oder einfach "Externalitäten". Um die biopolitische Produktion zu verstehen, müssen wir diese Sichtweise jedoch umkehren und die produktiven Externalitäten internalisieren, also das Gemeinsame ins Zentrum des Wirtschaftslebens rücken. Vom Standpunkt des Gemeinsamen aus wird dann deutlich, inwiefern der Prozess der ökonomischen Verwertung die Strukturen des sozialen Lebens im Zuge des gegenwärtigen Übergangs immer weiter durchdringt.(16)
Der Begriff der Externalität hat eine lange Geschichte im ökonomischen Denken. Anfang des 20. Jahrhunderts verwendete Alfred Marshall den Terminus "externe Ökonomie", um die wirtschaftliche Aktivität und Entwicklung zu beschreiben, die außerhalb der einzelnen Firma oder Industriebranche stattfindet; dazu zählt er unter anderem Wissen und Expertise, die sich gesellschaftlich in Industrieregionen entwickeln.(17) In der nachfolgenden Wirtschaftsliteratur des 20. Jahrhunderts wird der Begriff immer öfter verwendet, aber seine Bedeutung variiert und ist oft unklar. Das ist natürlich wenig überraschend, denn "externe Ökonomie" ist im Grunde ein negativer Begriff, der all das bezeichnet, was sich außerhalb der eigentlichen Ökonomie, jenseits der Austauschsphäre des Privateigentums abspielt. Für die meisten Ökonomen fungiert "externe Ökonomie" somit als Beschreibung für all das, was da draußen im Dunkeln bleibt. J. E. Meade versucht sich in den 1950er Jahren an einer etwas genaueren Definition und unterscheidet zu diesem Zweck zwischen zwei Typen externer Ökonomie oder "Disökonomie": "unbezahlte Faktoren ", zu denen er unter anderem das Befruchten der Obstbäume durch die Bienen zählt; und die "Atmosphäre", zu der auch der Regen zählt, der auf den Obstgarten fällt.(18) Es ist jedoch unschwer zu erkennen, dass jeder dieser Faktoren auch menschliche, soziale Komponenten aufweist: unbezahlte menschliche Tätigkeiten wie etwa die Arbeit im Haushalt; und soziale Atmosphären, darunter all jene, die die natürliche Umgebung beeinflussen - so wie etwa exzessives Abholzen von Wäldern den Niederschlag beeinflusst. Selbst bei der Produktion von Äpfeln lässt sich unschwer erkennen, dass diese "externen" Faktoren, die auf das Gemeinsame verweisen, von zentraler Bedeutung sind. Noch interessanter wird die ganze Sache, wenn Ökonomen feststellen, dass sie all diese dem Markt äußerlichen Faktoren nicht mehr ignorieren können, und deshalb offensiv dagegen vorzugehen beginnen. "Externe Ökonomien" sind laut einigen Ökonomen "fehlende Märkte" oder gar Indikatoren für "Marktversagen ". Außerhalb des Marktes sollte es nichts geben, keine Produktivgüter sollten "ohne Besitzer" sein, so behaupten diese Ökonomen, denn solche Externalitäten würden sich den Effizienzmechanismen entziehen, die der Markt erzeugt.(19)
Dass das Gemeinsame in den letzten Jahren deutlicher in den Blick gerückt ist, verdanken wir großteils nicht der Arbeit von Ökonomen, sondern von Juristen und Rechtstheoretikern. Die Diskussionen um die Frage geistigen Eigentums machen es denn auch unmöglich, nicht auf das Gemeinsame und seine Interaktion mit der Öffentlichkeit zu blicken. "Die wichtigste Ressource, die wir als ?open commons?, als frei zugängliches öffentliches Gut verwalten ", schreibt Yochai Benkler, "und ohne die man sich die Menschheit nicht vorstellen kann, sind all das Wissen und die gesamte Kultur aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert, die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ein Großteil der heutigen Wissenschaft und akademischen Gelehrsamkeit."(20) Dieses gemeinsame Wissen und die gemeinsame Kultur, die wir geerbt haben, divergieren sowohl vom Privaten als auch vom Öffentlichen, ja, stehen oft sogar in direktem Konflikt zu beiden. Die größte Beachtung findet dabei meistens der Konflikt zwischen Gemeinsamem und Privateigentum: Patente und Copyrights sind die beiden Mechanismen, die in den letzten Jahren die wichtigste Rolle gespielt haben, wenn es darum ging, Wissen in privates Eigentum zu überführen. Das Verhältnis zwischen Gemeinsamem und Öffentlichem ist gleichermaßen wichtig, bleibt aber oft verborgen. Es ist wichtig, das Gemeinsame - wie gemeinsames Wissen und gemeinsame Kultur - und öffentliche, institutionelle Arrangements, die den Zugang zu diesen "commons" zu regeln versuchen, begrifflich zu unterscheiden. Es ist deshalb verführerisch, sich ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Privaten, dem Öffentlichen und dem Gemeinsamen vorzustellen, aber das erweckt allzu leicht den Eindruck, die drei könnten ein geschlossenWissen und gemeinsame Kultur - und öffentliche, institutionelle Arrangements, die den Zugang zu diesen "commons" zu regeln versuchen, begrifflich zu unterscheiden. Es ist deshalb verführerisch, sich ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Privaten, dem Öffentlichen und dem Gemeinsamen vorzustellen, aber das erweckt allzu leicht den Eindruck, die drei könnten ein geschlossenes System bilden, in dem das Gemeinsame zwischen den beiden anderen steht. Stattdessen existiert das Gemeinsame auf einer anderen Ebene als das Private und das Öffentliche und ist völlig autonom gegenüber beiden.
Im Bereich der Informationsökonomie und der Wissensproduktion leuchtet unmittelbar ein, dass die Freiheit des Gemeinsamen wesentlich für die Produktion ist. Wie Praktiker und Wissenschaftler in Sachen Internet und Software gerne betonen, ist der Zugang zum Gemeinsamen in der Netzwerkumgebung - gemeinsames Wissen, gemeinsame Codes, gemeinsame Kommunikationskreisläufe - unabdingbar für Kreativität und Wachstum. Privatisiert man Wissen und Codes mit Hilfe von geistigen Eigentumsrechten, so behaupten sie, behindert das Produktion und Innovation, weil es die Freiheit des Gemeinsamen zerstört.(21) Wichtig ist, dass sich das geläufige Narrativ wirtschaftlicher Freiheit vom Standpunkt des Gemeinsamen aus völlig umkehrt. Glaubt man diesem Narrativ, so ist Privateigentum der Ort der Freiheit (wie auch der Effizienz, Disziplin und Innovation), der sich öffentlicher Kontrolle widersetzt. Jetzt hingegen ist das Gemeinsame der Ort der Freiheit und Innovation - freier Zugang, kostenlose Nutzung, Meinungsfreiheit, freie Interaktion -, der sich privater Kontrolle widersetzt, also der Kontrolle, die durch das Privateigentum, seine Rechtsstrukturen und die zugehörigen Marktkräfte ausgeübt wird. Freiheit kann in diesem Zusammenhang nur die Freiheit des Gemeinsamen sein.
Im Zeitalter biopolitischer Produktion wird das Gemeinsame, das zuvor als Externalität galt, vollständig "internalisiert". Oder anders ausgedrückt: Das Gemeinsame wird in seiner natürlichen wie in seiner künstlichen Form zum zentralen und wesentlichen Element in allen Bereichen wirtschaftlicher Produktion. Statt das Gemeinsame in Form von Externalitäten als "fehlende Märkte" oder "Marktversagen" zu betrachten, sollten wir das Privateigentum im Hinblick auf das "fehlende Gemeinsame" und sein "Gemeinsamkeitsversagen " interpretieren.
Nimmt man die Perspektive des Gemeinsamen ein, müssen zahlreiche Kernbegriffe der politischen Ökonomie überdacht werden. So nehmen beispielsweise die Verwertung und die Akkumulation in diesem Kontext zwangsläufig sozialen statt individuellen Charakter an. Das Gemeinsame existiert in breiten, offenen sozialen Netzwerken und wird von ihnen genutzt. Die Wertschöpfung und die Akkumulation des Gemeinsamen beziehen sich somit beide auf eine Ausweitung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. In diesem Zusammenhang von "gesellschaftlichem Wachstum" zu sprechen ist aber wohl zu vage und abstrakt. Wir können diese Vorstellung von Akkumulation philosophisch präzisieren - auch wenn wir uns natürlich bewusst sind, dass das die Ökonomen nicht wirklich zufrieden stellen wird -, indem wir sie im Hinblick auf das soziale Sensorium betrachten. Akkumulation des Gemeinsamen bedeutet nicht so sehr, dass wir über ein Mehr an Ideen, Bildern, Affekten und so weiter verfügen, sondern dass unsere Fähigkeiten und unsere Sinne zunehmen: unsere Fähigkeit, zu denken, zu fühlen, zu sehen, in Beziehung zueinander zu treten, zu lieben. Stärker ökonomisch gewendet heißt das: Dieses Wachstum beinhaltet sowohl einen größeren Bestand an Gemeinsamem, das in der Gesellschaft verfügbar ist, als auch eine gesteigerte produktive Kapazität, die auf dem Gemeinsamen basiert.
Einer der Gründe, warum wir bestimmte Zentralbegriffe der politischen Ökonomie gleichsam sozial überdenken müssen, ist der, dass die biopolitische Produktion nicht durch die Logik der Knappheit eingeschränkt ist. Sie verfügt über die einzigartige Eigenschaft, dass sie die Rohmaterialien, aus denen sie Reichtum produziert, nicht zerstört oder verringert. Die biopolitische Produktion lässt den bios arbeiten, ohne ihn aufzubrauchen. Zudem ist ihr Produkt nicht exklusiv. Wenn ich mit jemandem eine Idee oder eine Vorstellung teile, verringert sich meine Denkfähigkeit nicht; im Gegenteil, unser Austausch von Ideen und Vorstellungen steigert meine Fähigkeiten. Und die produzierten Affekte, Kommunikationskreisläufe und Kooperationsformen sind unmittelbar sozial und werden geteilt.
Die Merkmale biopolitischer Produktion zwingen uns zudem, den Begriff des Wirtschaftskreislaufs zu überdenken. Konjunkturzyklen zu verstehen gehört zum Kernbestand jeder Lehrveranstaltung in Makroökonomie. Die kapitalistischen Ökonomien unter der Hegemonie industrieller Produktion durchlaufen dabei immer wieder eine feste Sequenz: Expansion, Höhepunkt, Abschwung, Rezession, Expansion und so weiter. Ökonomen konzentrieren sich im Allgemeinen auf die "objektiven" Ursachen des Zyklus wie etwa Inflation, Arbeitslosenraten und Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage und empfehlen deshalb, um Boom- und Krisenphasen im Zaum zu halten, fiskalische und geldpolitische Lösungen, mit denen Wachstums- und Beschäftigungsraten aufrechterhalten werden sollen und die Inflation gebremst werden soll. Als wir in unseren früheren Arbeiten die industriellen Konjunkturzyklen untersucht haben, ging es uns dagegen eher um die "subjektiven " Ursachen, insbesondere die organisierte Verweigerung und den Widerstand der Arbeiter gegen das kapitalistische Kommando. Natürlich steckt "hinter" vielen objektiven Wirtschaftsindikatoren wie der Inflation, Ungleichgewichten von Angebot und Nachfrage oder Produktions- und Vertriebsstörungen oft ein Aufstand der Arbeiter. So gesehen lässt sich die Fiskal- und Wirtschaftskrise der 1970er Jahre im Lichte der Ausbreitung und Intensivierung der Arbeiterkämpfe in den 1960er Jahren betrachten.(22) Mindestens seit den 1930er Jahren haben denn auch Regierungen versucht, die Konjunkturschwankungen durch sozialpolitische Maßnahmen in den Griff zu bekommen und mit Hilfe von Lohn-, Beschäftigungs- und Sozialprogrammen die "subjektiven" Ursachen zu bekämpfen. Doch ob nun subjektiv oder objektiv betrachtet: Das periodische Schwanken des industriellen Konjunkturzyklus zwischen Boom und Rezession bleibt bestehen und wird durch fiskalische, monetäre oder sozialpolitische Maßnahmen mitunter allenfalls gedämpft, aber nicht aus der Welt geschafft.
Der biopolitische Zyklus hingegen ist völlig anders. Die Ökonomie ist noch immer Wachstum und Rezession unterworfen, aber diese müssen nunmehr in Relation zu den Eigenschaften des Gemeinsamen gesehen werden. Es gibt schädliche wie auch nützliche Formen des Gemeinsamen, wie wir wiederholt betont haben, und manche gesellschaftlichen Institutionen fördern das Gemeinsame, während andere es zerstören. Betrachtet man das biopolitische Wirtschaftswachstum als einen Prozess sozialer Komposition, der unsere allgemeinen gesellschaftlichen Fähigkeiten steigert, dann muss man die Rezession als soziale Dekomposition in dem Sinne begreifen, wie bestimmte Gifte einen Körper zersetzen. Schädliche Formen des Gemeinsamen und Institutionen, die es korrumpieren, zerstören den gesellschaftlichen Reichtum und behindern die soziale Produktivität. Da eine der wichtigsten Voraussetzungen biopolitischer Produktivität die Autonomie der produktiven Netzwerke gegenüber kapitalistischem Kommando und den korrupten gesellschaftlichen Institutionen ist, nimmt der Klassenkampf häufig die Form des Exodus an, der sich der Kontrolle entzieht und für Autonomie sorgt. Die quantitativen Indikatoren der Ökonomen geben wenig Einblick in dieses biopolitische Terrain, vor allem weil die Produktion des Gemeinsamen fortwährend nicht nur die Kontrollbeziehungen überschreitet, sondern auch die Messgrößen. Brauchbare ökonomische Indikatoren müssten deshalb qualitativer Art sein. Welche Eigenschaften des Gemeinsamen konstituieren die Gesellschaft? Wie sehr steht das Gemeinsame den gesellschaftlichen Produktivkräften zur Verfügung? Wie autonom sind die produktiven Netzwerke gegenüber den verschiedenen Formen von Kontrolle? In welchem Maße fördern oder behindern soziale Institutionen den Zugang zu nützlichen Formen des Gemeinsamen sowie deren Produktivität? Gäbe es solche Indikatoren, ergäbe sich ein biopolitischer Zyklus, der grundsätzlich arhythmisch und durch die Grenzbereiche sozialer Komposition und Dekomposition bestimmt ist. Doch eine angemessene Ökonomik der biopolitischen Produktion muss erst noch erfunden werden.
Das Tableau economique des Gemeinsamen
Im Jahr 1758 veröffentlichte François Quesnay die erste Fassung seines Tableau economique, das das Gleichgewicht von Investition und Konsum in der Agrarökonomie darstellt. Sein Schema präsentiert die monetären Austauschprozesse der gesamten Gesellschaft in Form eines Zickzack-Diagramms: Handwerker kaufen Getreide, Bauern kaufen Handwerkswaren, Landbesitzer betreiben Austausch mit ausländischen Kaufleuten und so weiter. Diese Zickzack- Bewegungen des Geldes zeugen von der Kohärenz des Wirtschaftssystems, da jede Gesellschaftsklasse beim Kaufen und Verkaufen von anderen abhängig ist. Quesnays Tableau soll zwei Kernthesen der physiokratischen Lehre veranschaulichen: Der Reichtum einer Nation bemisst sich nicht an dem Gold und Silber, das in ihren Tresoren lagert, sondern an ihrer Wertschöpfung (produit net); und die Landwirtschaft ist der einzige Produktionssektor der Ökonomie, denn Handwerk und Manufakturgewerbe generieren nicht mehr Wert, als in sie investiert wird. Für Quesnay wird der Mehrwert somit in erster Linie von den grundbesitzenden Feudalherren in Form der Pacht extrahiert.
Karl Marx war fasziniert von Quesnays Tableau economique, seine Analysen der einfachen und erweiterten Reproduktion des Kapitals wollen für die Industrieökonomie formulieren, was Quesnay für die Agrarwirtschaft beschrieben hat, und spüren zu diesem Zweck den Pfaden des Wertes durch die Zyklen von kapitalistischer Produktion, Zirkulation, Austausch und Konsum nach. Zwei wichtige Unterschiede freilich weist Marx? Werk im Vergleich zu Quesnay auf: Für ihn ist die Arbeit, nicht das Land die Quelle des Reichtums in der kapitalistischen Ökonomie; und das kapitalistische System befindet sich nicht in einem dauerhaften Gleichgewichtszustand, sondern muss ständig expandieren und ist deshalb fortwährend auf der Suche nach neuen Märkten, Materialien, Produktivkräften und so weiter. In diesem System wird der Mehrwert primär von Kapitalisten in Form des Profits extrahiert.
Wir brauchen heute ein neues Tableau economique, das die Produktion, Zirkulation und Expropriation von Wert in der biopolitischen Ökonomie sichtbar macht. Das heißt selbstverständlich nicht, dass die Industrieproduktion kein wichtiger Wirtschaftssektor mehr ist, so wie ja auch Marx? Fokussierung auf das Industriekapital nicht implizierte, dass die Landwirtschaft ihre Bedeutung verloren hätte. Wir behaupten vielmehr, dass die biopolitische Produktion in der heutigen Ökonomie allmählich eine Hegemonialstellung einnimmt und die Rolle übernimmt, die die Industrie mehr als hundert Jahre lang gespielt hat. So wie sich in einer früheren Phase die Landwirtschaft industrialisieren musste und dabei von der Industrie die mechanischen Verfahren, die Lohnverhältnisse, die Eigentumsregime und den Arbeitstag übernahm, muss heute die Industrie biopolitisch werden und zunehmend Kommunikationsnetzwerke, geistige und kulturelle Kreisläufe, die Produktion von Bildern und Affekten und so weiter in den Mittelpunkt rücken. Mit anderen Worten: Die Industrie und alle anderen Produktionsbereiche werden allmählich dazu gezwungen sein, sich dem Tableau economique des Gemeinsamen zu fügen.
Will man solch ein neues Tableau erstellen, sieht man sich jedoch sogleich vor zwei Schwierigkeiten gestellt. Zum Ersten bedroht die Autonomie der biopolitischen Arbeit die Kohärenz des Tableaus und nimmt eine Seite von Quesnays Zickzackbewegungen weg. Das Kapital hängt noch immer von biopolitischer Arbeit ab, aber die Abhängigkeit der biopolitischen Arbeit vom Kapital schwindet immer weiter. Im Gegensatz zur Industriearbeit, die vom kapitalistischen Kommando oder irgendeiner anderen Form von Management abhängt, damit die für die Produktion benötigten Materialien beschafft und die erforderlichen kooperativen Beziehungen hergestellt werden, hat die biopolitische Arbeit tendenziell unmittelbaren Zugang zum Gemeinsamen und kann intern Kooperation generieren. Zum Zweiten sind ökonomische Tableaus üblicherweise voller quantitativer Größen, doch soziales Leben, das Gemeinsame und alle Erzeugnisse biopolitischer Produktion verweigern sich jedem Maß und übersteigen es. Wie aber erhält man ein Tableau voller Qualitäten? Wie kann man den Input und Output qualitativer Elemente ausbalancieren, um das Gleichgewicht des Systems zu bestimmen? Man denke beispielsweise an die Tatsache, dass die Produktion von Subjektivität immer wichtiger für die biopolitische Wertgenerierung wird. Subjektivität ist ein Nutzwert, aber er ist in der Lage, autonom zu produzieren; und Subjektivität ist ein Tauschwert, der sich jedoch unmöglich quantifizieren lässt. Wir brauchen also ganz offensichtlich eine andere Art von Tableau.(23)
Die Begriffe, die Karl Marx für die Industrieproduktion entwickelt, sind auch im Kontext der biopolitischen Produktion noch brauchbar, müssen aber umformuliert werden. So unterteilt er beispielsweise den Arbeitstag in die notwendige Arbeitszeit, in der der Wert geschaffen wird, der nötig ist, um die Gesellschaft der Arbeiter zu reproduzieren, und in die Zeit der Surplusarbeit bzw. Mehrarbeit, die den Mehrwert schafft, den der Kapitalist sich aneignet. Im biopolitischen Kontext ist es die notwendige Arbeit, die das Gemeinsame schafft, denn das Gemeinsame ist in dem Wert enthalten, der für die Reproduktion der Gesellschaft nötig ist. Im Kontext des Industriekapitals war das Lohnverhältnis eines der Hauptfelder des Klassenkonflikts um notwendige Arbeit, auf dem die Arbeiter darum kämpften, das, was als sozial notwendig galt, zu erhöhen, während die Kapitalisten genau das zu verringern versuchten. In der biopolitischen Ökonomie währt dieser Konflikt fort, aber es geht nicht mehr nur um das Lohnverhältnis. Er wird immer mehr zu einem Kampf um das Gemeinsame. Wenn wir von einer gesellschaftlichen Reproduktion sprechen, die auf dem Gemeinsamen beruht, so klingt das möglicherweise nach Positionen, wie sie von Theoretikern des "sozialen Kapitals" vertreten werden; sie verweisen, wie wir weiter oben gesehen haben, auf die Bedürfnisse und Mechanismen gesellschaftlicher Reproduktion, die nicht allein mit Löhnen befriedigt werden könnten. Diese Verfechter eines "sozialen Kapitals" fallen jedoch auf sozialdemokratische Vorschläge zurück, wonach die Regierung die soziale Reproduktion garantieren müsse. Im Gegensatz dazu steht die auf dem Gemeinsamen beruhende gesellschaftliche Reproduktion unserer Ansicht nach außerhalb privater oder öffentlicher Lenkung oder Kommandogewalt.
Betrachtet man die notwendige Arbeit und den dort generierten Wert im Hinblick auf die Netzwerke gesellschaftlicher Reproduktion im Gemeinsamen, müssen wir die Mehrarbeit und den Mehrwert als Formen sozialer Kooperation und Elemente des Gemeinsamen begreifen, die das Kapital sich aneignet. Das Kapital expropriiert also nicht individuellen Reichtum, sondern das Ergebnis einer sozialen Fähigkeit. Die Mehrwertrate ist somit, um Marx? Definition umzuformulieren, Ausdruck des Exploitationsgrads durch das Kapital, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Arbeitskraft des Arbeiters, sondern auch hinsichtlich der gemeinsamen produktiven Fähigkeiten, die die gesellschaftliche Arbeitskraft konstituieren.(24) Infolgedessen verschärft sich der Widerspruch, den Marx des Öfteren beschwört, im biopolitischen Zeitalter noch weiter, nämlich zwischen dem sozialen Charakter kapitalistischer Produktion und dem privaten Charakter kapitalistischer Akkumulation. Man darf nicht vergessen: Wenn das Kapital das Gemeinsame akkumuliert und privatisiert, wird dessen Produktivität blockiert oder verringert. Wir haben es also mit einer extrem gewaltsamen und explosiven Situation zu tun, in der die gesellschaftlichen Produktivkräfte - die antagonistisch und autonom sind - innerhalb wie außerhalb des Marktes für die kapitalistische Akkumulation notwendig sind, aber dessen Kommandogewalt bedrohen. Das Kapital hält sozusagen den Wolf an den Ohren: Wenn es ihn weiter festhält, wird es gebissen werden; wenn es ihn loslässt, wird es nicht überleben.(25)
Der Kapitalismus ist definiert durch die Krise. Zu diesem Schluss kam vor beinahe einhundert Jahren Rosa Luxemburg, als sie erkannte, dass die expandierenden Zyklen kapitalistischer Reproduktion unweigerlich zu Kriegen zwischen den imperialistischen Mächten führten. Heute erleben wir die Krise auch innerhalb des Kapitalverhältnisses selbst, da das Kapital sich zunehmend mit autonomen, antagonistischen und nicht zu kontrollierenden Formen gesellschaftlicher Arbeitskraft konfrontiert sieht. Um die kapitalistische Kontrolle aufrechtzuerhalten, gibt es scheinbar zwei Optionen: Krieg oder Finanzsystem. Die Kriegsoption hat man versucht, sie hat sich aber mit den unilateralen Militärabenteuern der letzten Jahre weitgehend erschöpft. Sicherheitsmaßnahmen, Inhaftierung, soziale Überwachung, eine Aushöhlung der grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte und all das andere, was eine Gesellschaft im Krieg mit sich bringt, können kurzfristig die Kontrolle erhöhen, untergraben jedoch auch die Produktivität, am drastischsten in der biopolitischen Ökonomie, wo Freiheit, Kommunikation und soziale Interaktion unabdingbar sind. Die globale Aristokratie half dabei, dem Unilateralismus und seinem Militärregime ein Ende zu machen, weil beide nicht zuletzt schlecht fürs Geschäft waren. Deutlich wirkungsvoller ist hingegen die Finanzoption. In vielerlei Hinsicht war die Finanzialisierung die kapitalistische Reaktion auf die Krise der gesellschaftlichen Verhältnisse im Fordismus und der anderen sozialen Pfeiler, auf denen das Industriekapital beruhte. Nur das Finanzsystem ist in der Lage, den sich rasant verändernden und immer globaler werdenden gesellschaftlichen Produktionszyklen der biopolitischen Ökonomie zu folgen und Reichtum daraus zu extrahieren sowie das Kommando zu übernehmen. Nur das Finanzsystem kann die Flexibilität, Mobilität und Prekarität der biopolitischen Arbeitskraft überwachen und erzwingen und damit gleichzeitig die Ausgaben für den Sozialstaat reduzieren. Entscheidend dabei ist, dass das Finanzsystem außerhalb des Produktionsprozesses bleibt. Es versucht nicht, die gesellschaftliche Arbeitskraft zu organisieren oder ihr vorzuschreiben, wie sie zu kooperieren hat. Es lässt der biopolitischen Produktion ihre Autonomie und schafft es gleichzeitig doch, ihr aus der Distanz den Reichtum zu entziehen. (26)
Ein Tableau economique des Gemeinsamen lässt sich nicht in der Form erstellen, wie sie Quesnay und Marx für die Agrarwirtschaft bzw. die Industrieökonomie verwendeten. Diese Tableaus zeichnen nicht nur die Austauschprozesse nach, sondern auch die Interdependenzbeziehungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftsakteuren und letztlich den gesellschaftlichen Klassen. Mit der zunehmenden Autonomie der biopolitischen Arbeit, die in das Gemeinsame eingefügt ist, wird die Wechselseitigkeit dieser Beziehungen zerstört. Natürlich braucht das Kapital noch immer die Arbeiter, damit der Reichtum produziert wird, den es sich aneignen kann, aber es stößt bei den biopolitischen Produzenten zunehmend auf Widerspruch und Widerstand. Statt eines ökonomischen Tableaus der Austauschprozesse stoßen wir deshalb hier auf ein Tableau der Kämpfe, das wir in drei Rubriken aufteilen könnten. Die erste Rubrik ist definiert durch die Verteidigung der Freiheit für die biopolitische Arbeit. Die Zusammensetzung der postindustriellen Arbeitskraft zeichnet sich durch eine erzwungene Mobilität und Flexibilität aus, feste Verträge und sichere Arbeitsplätze werden ihr vorenthalten, sie muss im Verlauf eines Berufslebens und mitunter sogar eines einzigen Arbeitstags von einem Job zum nächsten wandern, und in vielen Fällen muss sie große Entfernungen innerhalb der Stadt oder auch über ganze Kontinente hinweg zurücklegen, um zur Arbeit zu kommen. Biopolitische Arbeit verweigert sich nicht per se Mobilität und Flexibilität (und träumt keineswegs von einer Rückkehr zur Starrheit der fordistischen Fabrik), sondern allein der externen Kontrolle darüber. Die Produktivität biopolitischer Arbeit verlangt die Autonomie, die eigenen Bewegungen und Transformationen selbst zu bestimmen; sie verlangt die Freiheit, für produktive Begegnungen zu sorgen, Kooperationsnetzwerke zu bilden, sich aus schädlichen Beziehungen zurückzuziehen und so weiter. Die Kämpfe in dieser ersten Rubrik sind somit Kämpfe des Gemeinsamen gegen die Arbeit - es verweigert sich dem Kommando über die Arbeit und verteidigt damit die freien Kräfte der Kreativität. Die zweite Rubrik ist definiert durch die Verteidigung des sozialen Lebens. Im fordistischen System sollte der Lohn, ergänzt durch staatliche Sozialleistungen, die Reproduktion des Proletariats garantieren, auch wenn er diese Aufgabe oftmals nicht erfüllte. Die heutige Klasse der prekär Beschäftigten, das Prekariat, hat ein völlig anderes Verhältnis zum Lohn. Es ist zu seiner Reproduktion nach wie vor von Löhnen abhängig, steht jedoch zunehmend außerhalb dieser Beziehung zum Kapital und setzt immer stärker auf Einkommen und Reproduktionsmittel, die es aus anderen Quellen sozialen Reichtums beziehen kann. Die Kämpfe in dieser zweiten Rubrik ließen sich deshalb als Kämpfe des Gemeinsamen gegen den Lohn bezeichnen - also zur Verteidigung eines Einkommens, mit dem sich soziales Leben reproduzieren lässt, aber gegen die immer gewaltsamere und immer weniger verlässliche Abhängigkeit, wie sie durch die Lohnverhältnisse vorgegeben wird. Eine dritte Rubrik in unserem Tableau wäre durch die Verteidigung der Demokratie definiert. Diese Kämpfe stecken noch in den Kinderschuhen, aber sie werden gesellschaftliche Institutionen erfinden müssen, um die gesellschaftlichen Produktivkräfte demokratisch organisieren zu können und damit eine stabile Grundlage für die Autonomie biopolitischer Produktion zu schaffen. Wir haben es hier also mit Kämpfen des Gemeinsamen gegen das Kapital zu tun. Diese Rubriken des Tableaus auszufüllen steht zunehmend auf der Tagesordnung.
Mit freundlicher Genehmigung des Campus Verlages
Information zum Buch und den Autoren hier
2. Was vom Kapitalismus übrig bleibt
Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Karl Marx, Das Kapital
Der biopolitische Zyklus des Gemeinsamen
Der Schlüsselbegriff für das Verständnis heutiger Wirtschaftsproduktion ist das Gemeinsame, als Produktivkraft ebenso wie als Form, in der Reichtum produziert wird. Aber das Privateigentum hat uns, wie Marx sagt, dumm gemacht, so dumm, dass wir blind sind für das Gemeinsame! Es hat den Anschein, als könnten Ökonomen und Politiker die Welt nur als in öffentlich und privat aufgeteilt betrachten, entweder im Besitz von Kapitalisten oder unter der Kontrolle des Staates, als gäbe es das Gemeinsame nicht. Tatsächlich erkennen die Ökonomen das Gemeinsame, aber sie siedeln es im Allgemeinen außerhalb der spezifisch ökonomischen Verhältnisse an und sprechen von "externen Ökonomien" oder einfach "Externalitäten". Um die biopolitische Produktion zu verstehen, müssen wir diese Sichtweise jedoch umkehren und die produktiven Externalitäten internalisieren, also das Gemeinsame ins Zentrum des Wirtschaftslebens rücken. Vom Standpunkt des Gemeinsamen aus wird dann deutlich, inwiefern der Prozess der ökonomischen Verwertung die Strukturen des sozialen Lebens im Zuge des gegenwärtigen Übergangs immer weiter durchdringt.(16)
Der Begriff der Externalität hat eine lange Geschichte im ökonomischen Denken. Anfang des 20. Jahrhunderts verwendete Alfred Marshall den Terminus "externe Ökonomie", um die wirtschaftliche Aktivität und Entwicklung zu beschreiben, die außerhalb der einzelnen Firma oder Industriebranche stattfindet; dazu zählt er unter anderem Wissen und Expertise, die sich gesellschaftlich in Industrieregionen entwickeln.(17) In der nachfolgenden Wirtschaftsliteratur des 20. Jahrhunderts wird der Begriff immer öfter verwendet, aber seine Bedeutung variiert und ist oft unklar. Das ist natürlich wenig überraschend, denn "externe Ökonomie" ist im Grunde ein negativer Begriff, der all das bezeichnet, was sich außerhalb der eigentlichen Ökonomie, jenseits der Austauschsphäre des Privateigentums abspielt. Für die meisten Ökonomen fungiert "externe Ökonomie" somit als Beschreibung für all das, was da draußen im Dunkeln bleibt. J. E. Meade versucht sich in den 1950er Jahren an einer etwas genaueren Definition und unterscheidet zu diesem Zweck zwischen zwei Typen externer Ökonomie oder "Disökonomie": "unbezahlte Faktoren ", zu denen er unter anderem das Befruchten der Obstbäume durch die Bienen zählt; und die "Atmosphäre", zu der auch der Regen zählt, der auf den Obstgarten fällt.(18) Es ist jedoch unschwer zu erkennen, dass jeder dieser Faktoren auch menschliche, soziale Komponenten aufweist: unbezahlte menschliche Tätigkeiten wie etwa die Arbeit im Haushalt; und soziale Atmosphären, darunter all jene, die die natürliche Umgebung beeinflussen - so wie etwa exzessives Abholzen von Wäldern den Niederschlag beeinflusst. Selbst bei der Produktion von Äpfeln lässt sich unschwer erkennen, dass diese "externen" Faktoren, die auf das Gemeinsame verweisen, von zentraler Bedeutung sind. Noch interessanter wird die ganze Sache, wenn Ökonomen feststellen, dass sie all diese dem Markt äußerlichen Faktoren nicht mehr ignorieren können, und deshalb offensiv dagegen vorzugehen beginnen. "Externe Ökonomien" sind laut einigen Ökonomen "fehlende Märkte" oder gar Indikatoren für "Marktversagen ". Außerhalb des Marktes sollte es nichts geben, keine Produktivgüter sollten "ohne Besitzer" sein, so behaupten diese Ökonomen, denn solche Externalitäten würden sich den Effizienzmechanismen entziehen, die der Markt erzeugt.(19)
Dass das Gemeinsame in den letzten Jahren deutlicher in den Blick gerückt ist, verdanken wir großteils nicht der Arbeit von Ökonomen, sondern von Juristen und Rechtstheoretikern. Die Diskussionen um die Frage geistigen Eigentums machen es denn auch unmöglich, nicht auf das Gemeinsame und seine Interaktion mit der Öffentlichkeit zu blicken. "Die wichtigste Ressource, die wir als ?open commons?, als frei zugängliches öffentliches Gut verwalten ", schreibt Yochai Benkler, "und ohne die man sich die Menschheit nicht vorstellen kann, sind all das Wissen und die gesamte Kultur aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert, die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ein Großteil der heutigen Wissenschaft und akademischen Gelehrsamkeit."(20) Dieses gemeinsame Wissen und die gemeinsame Kultur, die wir geerbt haben, divergieren sowohl vom Privaten als auch vom Öffentlichen, ja, stehen oft sogar in direktem Konflikt zu beiden. Die größte Beachtung findet dabei meistens der Konflikt zwischen Gemeinsamem und Privateigentum: Patente und Copyrights sind die beiden Mechanismen, die in den letzten Jahren die wichtigste Rolle gespielt haben, wenn es darum ging, Wissen in privates Eigentum zu überführen. Das Verhältnis zwischen Gemeinsamem und Öffentlichem ist gleichermaßen wichtig, bleibt aber oft verborgen. Es ist wichtig, das Gemeinsame - wie gemeinsames Wissen und gemeinsame Kultur - und öffentliche, institutionelle Arrangements, die den Zugang zu diesen "commons" zu regeln versuchen, begrifflich zu unterscheiden. Es ist deshalb verführerisch, sich ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Privaten, dem Öffentlichen und dem Gemeinsamen vorzustellen, aber das erweckt allzu leicht den Eindruck, die drei könnten ein geschlossenWissen und gemeinsame Kultur - und öffentliche, institutionelle Arrangements, die den Zugang zu diesen "commons" zu regeln versuchen, begrifflich zu unterscheiden. Es ist deshalb verführerisch, sich ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Privaten, dem Öffentlichen und dem Gemeinsamen vorzustellen, aber das erweckt allzu leicht den Eindruck, die drei könnten ein geschlossenes System bilden, in dem das Gemeinsame zwischen den beiden anderen steht. Stattdessen existiert das Gemeinsame auf einer anderen Ebene als das Private und das Öffentliche und ist völlig autonom gegenüber beiden.
Im Bereich der Informationsökonomie und der Wissensproduktion leuchtet unmittelbar ein, dass die Freiheit des Gemeinsamen wesentlich für die Produktion ist. Wie Praktiker und Wissenschaftler in Sachen Internet und Software gerne betonen, ist der Zugang zum Gemeinsamen in der Netzwerkumgebung - gemeinsames Wissen, gemeinsame Codes, gemeinsame Kommunikationskreisläufe - unabdingbar für Kreativität und Wachstum. Privatisiert man Wissen und Codes mit Hilfe von geistigen Eigentumsrechten, so behaupten sie, behindert das Produktion und Innovation, weil es die Freiheit des Gemeinsamen zerstört.(21) Wichtig ist, dass sich das geläufige Narrativ wirtschaftlicher Freiheit vom Standpunkt des Gemeinsamen aus völlig umkehrt. Glaubt man diesem Narrativ, so ist Privateigentum der Ort der Freiheit (wie auch der Effizienz, Disziplin und Innovation), der sich öffentlicher Kontrolle widersetzt. Jetzt hingegen ist das Gemeinsame der Ort der Freiheit und Innovation - freier Zugang, kostenlose Nutzung, Meinungsfreiheit, freie Interaktion -, der sich privater Kontrolle widersetzt, also der Kontrolle, die durch das Privateigentum, seine Rechtsstrukturen und die zugehörigen Marktkräfte ausgeübt wird. Freiheit kann in diesem Zusammenhang nur die Freiheit des Gemeinsamen sein.
Im Zeitalter biopolitischer Produktion wird das Gemeinsame, das zuvor als Externalität galt, vollständig "internalisiert". Oder anders ausgedrückt: Das Gemeinsame wird in seiner natürlichen wie in seiner künstlichen Form zum zentralen und wesentlichen Element in allen Bereichen wirtschaftlicher Produktion. Statt das Gemeinsame in Form von Externalitäten als "fehlende Märkte" oder "Marktversagen" zu betrachten, sollten wir das Privateigentum im Hinblick auf das "fehlende Gemeinsame" und sein "Gemeinsamkeitsversagen " interpretieren.
Nimmt man die Perspektive des Gemeinsamen ein, müssen zahlreiche Kernbegriffe der politischen Ökonomie überdacht werden. So nehmen beispielsweise die Verwertung und die Akkumulation in diesem Kontext zwangsläufig sozialen statt individuellen Charakter an. Das Gemeinsame existiert in breiten, offenen sozialen Netzwerken und wird von ihnen genutzt. Die Wertschöpfung und die Akkumulation des Gemeinsamen beziehen sich somit beide auf eine Ausweitung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. In diesem Zusammenhang von "gesellschaftlichem Wachstum" zu sprechen ist aber wohl zu vage und abstrakt. Wir können diese Vorstellung von Akkumulation philosophisch präzisieren - auch wenn wir uns natürlich bewusst sind, dass das die Ökonomen nicht wirklich zufrieden stellen wird -, indem wir sie im Hinblick auf das soziale Sensorium betrachten. Akkumulation des Gemeinsamen bedeutet nicht so sehr, dass wir über ein Mehr an Ideen, Bildern, Affekten und so weiter verfügen, sondern dass unsere Fähigkeiten und unsere Sinne zunehmen: unsere Fähigkeit, zu denken, zu fühlen, zu sehen, in Beziehung zueinander zu treten, zu lieben. Stärker ökonomisch gewendet heißt das: Dieses Wachstum beinhaltet sowohl einen größeren Bestand an Gemeinsamem, das in der Gesellschaft verfügbar ist, als auch eine gesteigerte produktive Kapazität, die auf dem Gemeinsamen basiert.
Einer der Gründe, warum wir bestimmte Zentralbegriffe der politischen Ökonomie gleichsam sozial überdenken müssen, ist der, dass die biopolitische Produktion nicht durch die Logik der Knappheit eingeschränkt ist. Sie verfügt über die einzigartige Eigenschaft, dass sie die Rohmaterialien, aus denen sie Reichtum produziert, nicht zerstört oder verringert. Die biopolitische Produktion lässt den bios arbeiten, ohne ihn aufzubrauchen. Zudem ist ihr Produkt nicht exklusiv. Wenn ich mit jemandem eine Idee oder eine Vorstellung teile, verringert sich meine Denkfähigkeit nicht; im Gegenteil, unser Austausch von Ideen und Vorstellungen steigert meine Fähigkeiten. Und die produzierten Affekte, Kommunikationskreisläufe und Kooperationsformen sind unmittelbar sozial und werden geteilt.
Die Merkmale biopolitischer Produktion zwingen uns zudem, den Begriff des Wirtschaftskreislaufs zu überdenken. Konjunkturzyklen zu verstehen gehört zum Kernbestand jeder Lehrveranstaltung in Makroökonomie. Die kapitalistischen Ökonomien unter der Hegemonie industrieller Produktion durchlaufen dabei immer wieder eine feste Sequenz: Expansion, Höhepunkt, Abschwung, Rezession, Expansion und so weiter. Ökonomen konzentrieren sich im Allgemeinen auf die "objektiven" Ursachen des Zyklus wie etwa Inflation, Arbeitslosenraten und Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage und empfehlen deshalb, um Boom- und Krisenphasen im Zaum zu halten, fiskalische und geldpolitische Lösungen, mit denen Wachstums- und Beschäftigungsraten aufrechterhalten werden sollen und die Inflation gebremst werden soll. Als wir in unseren früheren Arbeiten die industriellen Konjunkturzyklen untersucht haben, ging es uns dagegen eher um die "subjektiven " Ursachen, insbesondere die organisierte Verweigerung und den Widerstand der Arbeiter gegen das kapitalistische Kommando. Natürlich steckt "hinter" vielen objektiven Wirtschaftsindikatoren wie der Inflation, Ungleichgewichten von Angebot und Nachfrage oder Produktions- und Vertriebsstörungen oft ein Aufstand der Arbeiter. So gesehen lässt sich die Fiskal- und Wirtschaftskrise der 1970er Jahre im Lichte der Ausbreitung und Intensivierung der Arbeiterkämpfe in den 1960er Jahren betrachten.(22) Mindestens seit den 1930er Jahren haben denn auch Regierungen versucht, die Konjunkturschwankungen durch sozialpolitische Maßnahmen in den Griff zu bekommen und mit Hilfe von Lohn-, Beschäftigungs- und Sozialprogrammen die "subjektiven" Ursachen zu bekämpfen. Doch ob nun subjektiv oder objektiv betrachtet: Das periodische Schwanken des industriellen Konjunkturzyklus zwischen Boom und Rezession bleibt bestehen und wird durch fiskalische, monetäre oder sozialpolitische Maßnahmen mitunter allenfalls gedämpft, aber nicht aus der Welt geschafft.
Der biopolitische Zyklus hingegen ist völlig anders. Die Ökonomie ist noch immer Wachstum und Rezession unterworfen, aber diese müssen nunmehr in Relation zu den Eigenschaften des Gemeinsamen gesehen werden. Es gibt schädliche wie auch nützliche Formen des Gemeinsamen, wie wir wiederholt betont haben, und manche gesellschaftlichen Institutionen fördern das Gemeinsame, während andere es zerstören. Betrachtet man das biopolitische Wirtschaftswachstum als einen Prozess sozialer Komposition, der unsere allgemeinen gesellschaftlichen Fähigkeiten steigert, dann muss man die Rezession als soziale Dekomposition in dem Sinne begreifen, wie bestimmte Gifte einen Körper zersetzen. Schädliche Formen des Gemeinsamen und Institutionen, die es korrumpieren, zerstören den gesellschaftlichen Reichtum und behindern die soziale Produktivität. Da eine der wichtigsten Voraussetzungen biopolitischer Produktivität die Autonomie der produktiven Netzwerke gegenüber kapitalistischem Kommando und den korrupten gesellschaftlichen Institutionen ist, nimmt der Klassenkampf häufig die Form des Exodus an, der sich der Kontrolle entzieht und für Autonomie sorgt. Die quantitativen Indikatoren der Ökonomen geben wenig Einblick in dieses biopolitische Terrain, vor allem weil die Produktion des Gemeinsamen fortwährend nicht nur die Kontrollbeziehungen überschreitet, sondern auch die Messgrößen. Brauchbare ökonomische Indikatoren müssten deshalb qualitativer Art sein. Welche Eigenschaften des Gemeinsamen konstituieren die Gesellschaft? Wie sehr steht das Gemeinsame den gesellschaftlichen Produktivkräften zur Verfügung? Wie autonom sind die produktiven Netzwerke gegenüber den verschiedenen Formen von Kontrolle? In welchem Maße fördern oder behindern soziale Institutionen den Zugang zu nützlichen Formen des Gemeinsamen sowie deren Produktivität? Gäbe es solche Indikatoren, ergäbe sich ein biopolitischer Zyklus, der grundsätzlich arhythmisch und durch die Grenzbereiche sozialer Komposition und Dekomposition bestimmt ist. Doch eine angemessene Ökonomik der biopolitischen Produktion muss erst noch erfunden werden.
Das Tableau economique des Gemeinsamen
Im Jahr 1758 veröffentlichte François Quesnay die erste Fassung seines Tableau economique, das das Gleichgewicht von Investition und Konsum in der Agrarökonomie darstellt. Sein Schema präsentiert die monetären Austauschprozesse der gesamten Gesellschaft in Form eines Zickzack-Diagramms: Handwerker kaufen Getreide, Bauern kaufen Handwerkswaren, Landbesitzer betreiben Austausch mit ausländischen Kaufleuten und so weiter. Diese Zickzack- Bewegungen des Geldes zeugen von der Kohärenz des Wirtschaftssystems, da jede Gesellschaftsklasse beim Kaufen und Verkaufen von anderen abhängig ist. Quesnays Tableau soll zwei Kernthesen der physiokratischen Lehre veranschaulichen: Der Reichtum einer Nation bemisst sich nicht an dem Gold und Silber, das in ihren Tresoren lagert, sondern an ihrer Wertschöpfung (produit net); und die Landwirtschaft ist der einzige Produktionssektor der Ökonomie, denn Handwerk und Manufakturgewerbe generieren nicht mehr Wert, als in sie investiert wird. Für Quesnay wird der Mehrwert somit in erster Linie von den grundbesitzenden Feudalherren in Form der Pacht extrahiert.
Karl Marx war fasziniert von Quesnays Tableau economique, seine Analysen der einfachen und erweiterten Reproduktion des Kapitals wollen für die Industrieökonomie formulieren, was Quesnay für die Agrarwirtschaft beschrieben hat, und spüren zu diesem Zweck den Pfaden des Wertes durch die Zyklen von kapitalistischer Produktion, Zirkulation, Austausch und Konsum nach. Zwei wichtige Unterschiede freilich weist Marx? Werk im Vergleich zu Quesnay auf: Für ihn ist die Arbeit, nicht das Land die Quelle des Reichtums in der kapitalistischen Ökonomie; und das kapitalistische System befindet sich nicht in einem dauerhaften Gleichgewichtszustand, sondern muss ständig expandieren und ist deshalb fortwährend auf der Suche nach neuen Märkten, Materialien, Produktivkräften und so weiter. In diesem System wird der Mehrwert primär von Kapitalisten in Form des Profits extrahiert.
Wir brauchen heute ein neues Tableau economique, das die Produktion, Zirkulation und Expropriation von Wert in der biopolitischen Ökonomie sichtbar macht. Das heißt selbstverständlich nicht, dass die Industrieproduktion kein wichtiger Wirtschaftssektor mehr ist, so wie ja auch Marx? Fokussierung auf das Industriekapital nicht implizierte, dass die Landwirtschaft ihre Bedeutung verloren hätte. Wir behaupten vielmehr, dass die biopolitische Produktion in der heutigen Ökonomie allmählich eine Hegemonialstellung einnimmt und die Rolle übernimmt, die die Industrie mehr als hundert Jahre lang gespielt hat. So wie sich in einer früheren Phase die Landwirtschaft industrialisieren musste und dabei von der Industrie die mechanischen Verfahren, die Lohnverhältnisse, die Eigentumsregime und den Arbeitstag übernahm, muss heute die Industrie biopolitisch werden und zunehmend Kommunikationsnetzwerke, geistige und kulturelle Kreisläufe, die Produktion von Bildern und Affekten und so weiter in den Mittelpunkt rücken. Mit anderen Worten: Die Industrie und alle anderen Produktionsbereiche werden allmählich dazu gezwungen sein, sich dem Tableau economique des Gemeinsamen zu fügen.
Will man solch ein neues Tableau erstellen, sieht man sich jedoch sogleich vor zwei Schwierigkeiten gestellt. Zum Ersten bedroht die Autonomie der biopolitischen Arbeit die Kohärenz des Tableaus und nimmt eine Seite von Quesnays Zickzackbewegungen weg. Das Kapital hängt noch immer von biopolitischer Arbeit ab, aber die Abhängigkeit der biopolitischen Arbeit vom Kapital schwindet immer weiter. Im Gegensatz zur Industriearbeit, die vom kapitalistischen Kommando oder irgendeiner anderen Form von Management abhängt, damit die für die Produktion benötigten Materialien beschafft und die erforderlichen kooperativen Beziehungen hergestellt werden, hat die biopolitische Arbeit tendenziell unmittelbaren Zugang zum Gemeinsamen und kann intern Kooperation generieren. Zum Zweiten sind ökonomische Tableaus üblicherweise voller quantitativer Größen, doch soziales Leben, das Gemeinsame und alle Erzeugnisse biopolitischer Produktion verweigern sich jedem Maß und übersteigen es. Wie aber erhält man ein Tableau voller Qualitäten? Wie kann man den Input und Output qualitativer Elemente ausbalancieren, um das Gleichgewicht des Systems zu bestimmen? Man denke beispielsweise an die Tatsache, dass die Produktion von Subjektivität immer wichtiger für die biopolitische Wertgenerierung wird. Subjektivität ist ein Nutzwert, aber er ist in der Lage, autonom zu produzieren; und Subjektivität ist ein Tauschwert, der sich jedoch unmöglich quantifizieren lässt. Wir brauchen also ganz offensichtlich eine andere Art von Tableau.(23)
Die Begriffe, die Karl Marx für die Industrieproduktion entwickelt, sind auch im Kontext der biopolitischen Produktion noch brauchbar, müssen aber umformuliert werden. So unterteilt er beispielsweise den Arbeitstag in die notwendige Arbeitszeit, in der der Wert geschaffen wird, der nötig ist, um die Gesellschaft der Arbeiter zu reproduzieren, und in die Zeit der Surplusarbeit bzw. Mehrarbeit, die den Mehrwert schafft, den der Kapitalist sich aneignet. Im biopolitischen Kontext ist es die notwendige Arbeit, die das Gemeinsame schafft, denn das Gemeinsame ist in dem Wert enthalten, der für die Reproduktion der Gesellschaft nötig ist. Im Kontext des Industriekapitals war das Lohnverhältnis eines der Hauptfelder des Klassenkonflikts um notwendige Arbeit, auf dem die Arbeiter darum kämpften, das, was als sozial notwendig galt, zu erhöhen, während die Kapitalisten genau das zu verringern versuchten. In der biopolitischen Ökonomie währt dieser Konflikt fort, aber es geht nicht mehr nur um das Lohnverhältnis. Er wird immer mehr zu einem Kampf um das Gemeinsame. Wenn wir von einer gesellschaftlichen Reproduktion sprechen, die auf dem Gemeinsamen beruht, so klingt das möglicherweise nach Positionen, wie sie von Theoretikern des "sozialen Kapitals" vertreten werden; sie verweisen, wie wir weiter oben gesehen haben, auf die Bedürfnisse und Mechanismen gesellschaftlicher Reproduktion, die nicht allein mit Löhnen befriedigt werden könnten. Diese Verfechter eines "sozialen Kapitals" fallen jedoch auf sozialdemokratische Vorschläge zurück, wonach die Regierung die soziale Reproduktion garantieren müsse. Im Gegensatz dazu steht die auf dem Gemeinsamen beruhende gesellschaftliche Reproduktion unserer Ansicht nach außerhalb privater oder öffentlicher Lenkung oder Kommandogewalt.
Betrachtet man die notwendige Arbeit und den dort generierten Wert im Hinblick auf die Netzwerke gesellschaftlicher Reproduktion im Gemeinsamen, müssen wir die Mehrarbeit und den Mehrwert als Formen sozialer Kooperation und Elemente des Gemeinsamen begreifen, die das Kapital sich aneignet. Das Kapital expropriiert also nicht individuellen Reichtum, sondern das Ergebnis einer sozialen Fähigkeit. Die Mehrwertrate ist somit, um Marx? Definition umzuformulieren, Ausdruck des Exploitationsgrads durch das Kapital, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Arbeitskraft des Arbeiters, sondern auch hinsichtlich der gemeinsamen produktiven Fähigkeiten, die die gesellschaftliche Arbeitskraft konstituieren.(24) Infolgedessen verschärft sich der Widerspruch, den Marx des Öfteren beschwört, im biopolitischen Zeitalter noch weiter, nämlich zwischen dem sozialen Charakter kapitalistischer Produktion und dem privaten Charakter kapitalistischer Akkumulation. Man darf nicht vergessen: Wenn das Kapital das Gemeinsame akkumuliert und privatisiert, wird dessen Produktivität blockiert oder verringert. Wir haben es also mit einer extrem gewaltsamen und explosiven Situation zu tun, in der die gesellschaftlichen Produktivkräfte - die antagonistisch und autonom sind - innerhalb wie außerhalb des Marktes für die kapitalistische Akkumulation notwendig sind, aber dessen Kommandogewalt bedrohen. Das Kapital hält sozusagen den Wolf an den Ohren: Wenn es ihn weiter festhält, wird es gebissen werden; wenn es ihn loslässt, wird es nicht überleben.(25)
Der Kapitalismus ist definiert durch die Krise. Zu diesem Schluss kam vor beinahe einhundert Jahren Rosa Luxemburg, als sie erkannte, dass die expandierenden Zyklen kapitalistischer Reproduktion unweigerlich zu Kriegen zwischen den imperialistischen Mächten führten. Heute erleben wir die Krise auch innerhalb des Kapitalverhältnisses selbst, da das Kapital sich zunehmend mit autonomen, antagonistischen und nicht zu kontrollierenden Formen gesellschaftlicher Arbeitskraft konfrontiert sieht. Um die kapitalistische Kontrolle aufrechtzuerhalten, gibt es scheinbar zwei Optionen: Krieg oder Finanzsystem. Die Kriegsoption hat man versucht, sie hat sich aber mit den unilateralen Militärabenteuern der letzten Jahre weitgehend erschöpft. Sicherheitsmaßnahmen, Inhaftierung, soziale Überwachung, eine Aushöhlung der grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte und all das andere, was eine Gesellschaft im Krieg mit sich bringt, können kurzfristig die Kontrolle erhöhen, untergraben jedoch auch die Produktivität, am drastischsten in der biopolitischen Ökonomie, wo Freiheit, Kommunikation und soziale Interaktion unabdingbar sind. Die globale Aristokratie half dabei, dem Unilateralismus und seinem Militärregime ein Ende zu machen, weil beide nicht zuletzt schlecht fürs Geschäft waren. Deutlich wirkungsvoller ist hingegen die Finanzoption. In vielerlei Hinsicht war die Finanzialisierung die kapitalistische Reaktion auf die Krise der gesellschaftlichen Verhältnisse im Fordismus und der anderen sozialen Pfeiler, auf denen das Industriekapital beruhte. Nur das Finanzsystem ist in der Lage, den sich rasant verändernden und immer globaler werdenden gesellschaftlichen Produktionszyklen der biopolitischen Ökonomie zu folgen und Reichtum daraus zu extrahieren sowie das Kommando zu übernehmen. Nur das Finanzsystem kann die Flexibilität, Mobilität und Prekarität der biopolitischen Arbeitskraft überwachen und erzwingen und damit gleichzeitig die Ausgaben für den Sozialstaat reduzieren. Entscheidend dabei ist, dass das Finanzsystem außerhalb des Produktionsprozesses bleibt. Es versucht nicht, die gesellschaftliche Arbeitskraft zu organisieren oder ihr vorzuschreiben, wie sie zu kooperieren hat. Es lässt der biopolitischen Produktion ihre Autonomie und schafft es gleichzeitig doch, ihr aus der Distanz den Reichtum zu entziehen. (26)
Ein Tableau economique des Gemeinsamen lässt sich nicht in der Form erstellen, wie sie Quesnay und Marx für die Agrarwirtschaft bzw. die Industrieökonomie verwendeten. Diese Tableaus zeichnen nicht nur die Austauschprozesse nach, sondern auch die Interdependenzbeziehungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftsakteuren und letztlich den gesellschaftlichen Klassen. Mit der zunehmenden Autonomie der biopolitischen Arbeit, die in das Gemeinsame eingefügt ist, wird die Wechselseitigkeit dieser Beziehungen zerstört. Natürlich braucht das Kapital noch immer die Arbeiter, damit der Reichtum produziert wird, den es sich aneignen kann, aber es stößt bei den biopolitischen Produzenten zunehmend auf Widerspruch und Widerstand. Statt eines ökonomischen Tableaus der Austauschprozesse stoßen wir deshalb hier auf ein Tableau der Kämpfe, das wir in drei Rubriken aufteilen könnten. Die erste Rubrik ist definiert durch die Verteidigung der Freiheit für die biopolitische Arbeit. Die Zusammensetzung der postindustriellen Arbeitskraft zeichnet sich durch eine erzwungene Mobilität und Flexibilität aus, feste Verträge und sichere Arbeitsplätze werden ihr vorenthalten, sie muss im Verlauf eines Berufslebens und mitunter sogar eines einzigen Arbeitstags von einem Job zum nächsten wandern, und in vielen Fällen muss sie große Entfernungen innerhalb der Stadt oder auch über ganze Kontinente hinweg zurücklegen, um zur Arbeit zu kommen. Biopolitische Arbeit verweigert sich nicht per se Mobilität und Flexibilität (und träumt keineswegs von einer Rückkehr zur Starrheit der fordistischen Fabrik), sondern allein der externen Kontrolle darüber. Die Produktivität biopolitischer Arbeit verlangt die Autonomie, die eigenen Bewegungen und Transformationen selbst zu bestimmen; sie verlangt die Freiheit, für produktive Begegnungen zu sorgen, Kooperationsnetzwerke zu bilden, sich aus schädlichen Beziehungen zurückzuziehen und so weiter. Die Kämpfe in dieser ersten Rubrik sind somit Kämpfe des Gemeinsamen gegen die Arbeit - es verweigert sich dem Kommando über die Arbeit und verteidigt damit die freien Kräfte der Kreativität. Die zweite Rubrik ist definiert durch die Verteidigung des sozialen Lebens. Im fordistischen System sollte der Lohn, ergänzt durch staatliche Sozialleistungen, die Reproduktion des Proletariats garantieren, auch wenn er diese Aufgabe oftmals nicht erfüllte. Die heutige Klasse der prekär Beschäftigten, das Prekariat, hat ein völlig anderes Verhältnis zum Lohn. Es ist zu seiner Reproduktion nach wie vor von Löhnen abhängig, steht jedoch zunehmend außerhalb dieser Beziehung zum Kapital und setzt immer stärker auf Einkommen und Reproduktionsmittel, die es aus anderen Quellen sozialen Reichtums beziehen kann. Die Kämpfe in dieser zweiten Rubrik ließen sich deshalb als Kämpfe des Gemeinsamen gegen den Lohn bezeichnen - also zur Verteidigung eines Einkommens, mit dem sich soziales Leben reproduzieren lässt, aber gegen die immer gewaltsamere und immer weniger verlässliche Abhängigkeit, wie sie durch die Lohnverhältnisse vorgegeben wird. Eine dritte Rubrik in unserem Tableau wäre durch die Verteidigung der Demokratie definiert. Diese Kämpfe stecken noch in den Kinderschuhen, aber sie werden gesellschaftliche Institutionen erfinden müssen, um die gesellschaftlichen Produktivkräfte demokratisch organisieren zu können und damit eine stabile Grundlage für die Autonomie biopolitischer Produktion zu schaffen. Wir haben es hier also mit Kämpfen des Gemeinsamen gegen das Kapital zu tun. Diese Rubriken des Tableaus auszufüllen steht zunehmend auf der Tagesordnung.
Mit freundlicher Genehmigung des Campus Verlages
Information zum Buch und den Autoren hier
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens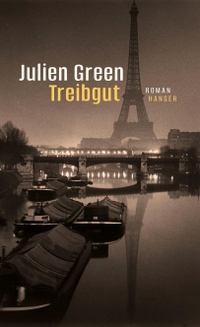 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut