Solche Texte sind Prosa eines Hausarztes, der das Lexikon zum Selbsthilfebuch macht, wie etwa Heinrich Winckler, Leipziger Stadtarzt, der die meisten medizinischen Texte im Universal-Lexicon verfasst haben soll.(426) Und einen stadtärztlich-praktischen Verstand verraten die Texte durchaus: Sie sind mit Blick auf die Praxis geschrieben und aus der Erfahrung vieler alltäglicher Operationen heraus reflektiert. Es werden Salben beschrieben und dafür die Zutaten angegeben, es wird empfohlen, was bei entzündeten und was bei erfrorenen Nasen zu tun sei, und dann wird auch berichtet, was der italienische Arzt Gasparo Tagliacozzi (1546-1599) für Pionierleistungen in der Nasenchirurgie vollbracht habe. Tagliacozzi ist berühmt geworden mit Techniken, aus anderen Teilen des Gesichts (Wange, Stirn) oder des eigenen Körpers (Arm, Gesäß) fehlende oder verlorene Nasen zu ersetzen.
Die plastische Chirurgie war damals voll entwickelt und traf besonders bei Nasenverstümmelungen wohl auf ein großes Interesse: Geschwüre und Entzündungen, Pocken, Kriegseinwirkungen und eine gelegentlich noch praktizierte körperliche Kriminalstrafe des Abhackens von Nasen und Ohren führten dazu, dass ein Arzt "anstatt der natürlichen eine andere Nase, wo es nur immer seyn kan, ansetzen und anmachen muss". Mit Befremden zitierte man Berichte, dass in früheren Gesellschaften fehlende herrschaftliche Nasen durch Sklavennasen ersetzt wurden. Die Rhinoplastik des 18. Jahrhunderts experimentierte lieber mit Transplantationen, etwa wie folgt: Man drückt den Arm des Patienten auf sein Gesicht, ritzt das Gesicht an der Stelle, wo die Nase hin soll,
"und öffnet die Haut gleichfalls an dem Orte, der auf die Nase passet, soviel es das verlohrne Stück erfordert, mit einem Messerlein, drücket und bindet hernach das Haupt und den Arm wohl zusammen, und lässet solches vier Wochen unbeweglich stille liegen: denn binnen der Zeit pfleget das Fleisch des Armes und der Nase sich miteinander zu vereinigen und anzuheilen; Hierauf schneidet man so viel nöthig das Fleisch heraus und formiret es über eine gemachte und eingeschobene subtile Forme, soviel die Kunst zulassen will, zu einer andern Nase." (UL 23: 728)
Diese wochenlange Prozedur wurde allerdings von Patienten wie Ärzten als sehr umständlich empfunden, auch wenn wohl gute Ergebnisse zu erzielen waren. Andere chirurgisch-plastische Verfahren, eine Nase aus Hautfalten zu bilden, schränkten die Nasenlosen in ihrer Bewegung weniger ein und wurden schnell beliebt. Enzyklopädien berichteten über solche Themen, und gelegentlich versank die Beschreibung der ärztlichen Operation ganz im Detail. Ob man daraus schließen muss, dass die Leser des Lexikons selber zum Messer greifen sollten? Wahrscheinlicher ist, dass viele Leser ihre Nase deswegen so tief ins Lexikon steckten, weil sie angenehm schaudernd sich darüber freuen konnten, welche Qualen ihnen erspart blieben.
Die wohl oft geübte, aber eben auch oft beschriebene chirurgische Kunst der anaplastischen Nasennachbildung belehrt darüber, welch große Anstrengungen im 18. Jahrhundert dem Unternehmen galten, eine Nase neu zu bilden. Die Wiederherstellung von Funktionen wie Atmen oder Weinen waren dabei nicht die ausschlaggebenden Motive. Vielmehr war die Nase ein sozialer Magnet, mit dem man andere an sich ziehen konnte. Oder andersherum: Keine Nase zu haben, schreckte ab. Tycho Brahe übrigens soll diesen Effekt des nasenlosen Erschreckens gelegentlich genutzt haben, wenn er alleine forschen wollte: Er nahm einfach seine Prothese ab und konnte damit rechnen, seine Besucher damit zu vertreiben.(427)
Das konnte sich nicht jeder leisten. Und es gab andere, die selbst mit Nase den Kürzeren zogen und ohne Anerkennung blieben. Nase ist nicht gleich Nase, und die Physiologie dieses Organs erweitert sich leicht in eine größere Wissenswelt der Nasenvielfalt. Nase haben war nicht alles; Unterschiede zählten auch: "Der Wachsoldat sah dem Fremden ins Gesicht - nie in seinem Leben hatte er eine solche Nase gesehen! - Ich habe mit ihr schon sehr viel Glück gehabt, sagte der Fremde [...]".(428)
Dass die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts im Wissen und Denken durchaus international war, schlug sich in den Lexika der Zeit nieder: Historische Lexika von Louis Moréri oder von Daniel Hofmann werteten europäische Quellen aus und öffneten den Blick über Ländergrenzen hinweg; andere, wie der französische Orientalist Herbelot, bezogen sich exklusiv auf arabische und persische Literatur und machten den Orient erfahrbar. Kaufmannslexika schließlich, von Savary bis Zincke, übten den globalen Blick und ließen keinen Ort unerwähnt, an dem Handel getrieben wurde und sich Menschen unterschiedlichster Herkunft begegneten.(429) So war es niemals ein Geheimnis, dass es auf den verschiedenen Kontinenten auch verschiedene Nasen gab.
Auch medizinische Artikel vermerkten die Variationen der Nasenform: spitz oder platt, gerade oder krumm, groß oder klein. Nicht selten wurden dabei schon Hinweise auf rassische Besonderheiten gegeben, etwa dass die Afrikaner meist große und angedrückte Nasen haben, oder dass ferne Kulturen die in Europa unbekannten und ungewollten Nasenformen durch Bandagen und andere mechanische Vorkehrungen bei kleinen Kindern förderten.
Quer durch alle Artikelformen kamen die physiognomischen Interpretationen der Nasenform zur Sprache. Dass man an der Nase den Charakter erkennen könne, war wohl kaum angezweifelt, ebenso wenig ihre sozial-integrative Funktion. Laurence Sterne hat seinen Roman Tristram Shandy (1760-1767) um eine Figur herum aufgebaut, der die Geburtszange eine platte Nase gemacht hatte und für die diese Geschichte das eigentliche Geburtsereignis darstellt - eine verfehlte Identität. Und wahrscheinlich ist es beim Clown nicht zufällig die (künstliche rote) Nase, die ihn als Narren auszeichnet und seine Rolle als gesellschaftlichen Außenseiter unterstreicht. Nasen artikulierten Ordnungsmuster.
Ein interessanter Fall ist Omai - eigentlich Mai - als ein von Europa sozusagen adoptierter Polynesier. Von James Cook auf seiner zweiten Reise in Tahiti an Bord genommen, war der junge Mann zunächst als Mittler zwischen den Seeleuten und den Bewohnern der Südsee nützlich. Von Cooks Schiffen hieß eines "Abenteuer" (Adventure), und dessen Kapitän nahm Omai bis nach London mit, wo er zwischen 1774 und 1776 als exotische Kuriosität gehandelt und angestaunt wurde. Mehrere Bilder wurden gemalt und in Kupferstichen weiterverbreitet, wobei die Darstellungen sowohl das Exotische betonten - die dunkle Haut, das krause Haar, die tuchartigen, locker übergeworfenen Gewänder - als auch das Gesittete, Eingebürgerte, Zivilisierte, was in den Berichten der Zeit durchgängige Erwähnung findet, etwa wenn man herausstreicht, wie vollkommen Omais Verbeugungen waren.(430)
Auf Gemälden und Stichen zeigt die Nase des jungen Mannes, welchen Grad an Assimilation man ihm zubilligte. Wenn die Porträts ihn als Fremden wiedergeben, ist sie breit und groß, wenn der edle Wilde exemplifiziert wird, eher wohlgeformt und gemäßigt. Wo Omai in ruhiger Pose und mit direktem Blick idealisiert erscheint - wie auf einem Stich von Caldwell nach einer Zeichnung von William Hodges -, ist sie weniger polynesisch breit, sondern schmaler und insgesamt unauffälliger.
Die Porträtkunst des 18. Jahrhunderts hatte oft mit geschwollenen oder pokkenvernarbten Nasen zu tun - es waren schwierige Aufgaben für die Maler und Stecher, einen Mittelweg zwischen Wahrheits treue und Bildkomposition zu finden. Meist entschied man sich für die weniger realistische Darstellung und schönte. So finden wir in den Galerien der Kunstmuseen die vielfältigen Entstellungen nicht, die uns aus anderen Zeugnissen verbürgt sind: Man nahm ganz einfach die Warzen und Geschwüre nicht wahr und auch keinerlei Narben, so wenig wie ausgefallene Zähne. Würden wir nicht in den Zeichnungen von William Hogarth gelegentlich die Knollennase eines Säufers gezeichnet finden, die Gefahr wäre groß, in den Bildern des 18. Jahrhunderts die physischen Nöte des Zeitalters zu verkennen.
Will man tiefer in die Phänomenologie der Nase im 18. Jahrhundert eindringen, muss man allerdings eine breite Kenntnis der Kunst besitzen. Jemand, der hinter die fast überall durchgesetzte Idealisierung der Gesichtszüge schauen wollte, war Johann Georg Lavater, dessen "Physiognomik" im Grunde einen Kommentar zu überlieferten Gesichtsdarstellungen gibt. Ausgehend von gesammelten Abbildungen des menschlichen Antlitzes - in Stein, Metall, Holz, auf Leinwand und auf Papier - hat der Schriftsteller und Prediger Thesen entwickelt, die zunächst eher flüchtig notiert wurden. Erst spätere Auflagen und Übersetzungen des Werks haben die Thesen Lavaters zu so etwas wie einer festen Theorie gefügt. In der ersten Auflage ist der Blick ins Gesicht noch sehr empirisch und seine Auswertung spekulativ, was auch die Passagen über die Nase verraten.
Zwar behauptete Lavater, die Nase sei "die Wiederlage des Gehirns" und führte aus: "Auf ihr scheint eigentlich alle Kraft des Stirngewölbes zu ruhen, das sonst in Mund und Wangen elend zusammen stürzen würde"(431), er zeigte sich aber kaum an "schönen Nasen" interessiert. Gerade weil er sagen konnte, sein "ganzes Werk" sei "voll Beweise von der feinen und mannichfaltigen Bedeutsamkeit der menschlichen Nasen", konnte er sich gleich anschließend für Nasen begeistern, "die man nicht schön, die man eher hässlich nennet", und fordert dann: "Der Physiognomist wird sicherlich auf den ersten Blick bei Gesichtern mit solchen [d. h. hässlichen] Nasen verweilen, sich ihnen, wenn ihm Weisheit, Talente, Geistesgaben nicht gleichgültig sind, nähern, sich an sie schmiegen, und - ihr Hörer und Schüler werden[d] - wenigstens allemal ihr Bewunderer seyn."(432)
Man mag zweifeln, ob große Männer - angefangen mit Sokrates - immer hässliche Nasen hatten und grundsätzlich haben müssen. Ein anderer Topos der Zeit setzt auf Analogie und fordert Symmetrie zwischen dem Überragenden und dem Herausragenden, wie etwa das Conversationslexicon 1809 im Artikel über >Karl den Großen<: "Alles war groß an ihm. Er hatte einen hohen Wuchs, große lebhafte Augen, ein heiteres offnes Gesicht und eine Adler-Nase."(433) Unübersehbar ist jedenfalls, dass die "Nasologie" im 18. Jahrhundert eine entwickelte Wissensform darstellte. Die Nase hatte ganz entschieden soziale und symbolische, ja ideologische Funktionen, neben den rein physiologischen.
Ebenso offensichtlich ist, dass das Wissen über die Nase schwer zu sortieren war, denn Natur und Kultur der Nase zeig ten sich den Zeitgenossen der Aufklärung vielfach verschränkt. War die Nase der Afrikaner wirklich anders gewachsen und also genetisch anders angelegt als die europäische? War Natur oder Kultur die Ursache der Vielfalt im Leben? Manche haben damals die Lesart von der menschengemachten Verformung angenommen (der zufolge durch das Tragen der Kleinkinder auf den Rücken der Mutter deren Nase geplättet werde), auch weil ihnen die Annahme rassischer Verschiedenheit problematisch erschien. Noch die Aufklärer der Encyclopédie hatten mit solchen Vorurteilen zu tun und fanden Anlass, Nasenehrlichkeit zu fordern: "Dieser Teil des Gesichts variiert bei den verschiedenen Menschen in Größe und Gestalt schon im Augenblick der Geburt sehr stark."(434) Nase also war Natur, was auch bedeutete, dass sie das Schicksal des Menschen, seine Individualität wie gesellschaftliche Stellung bestimmte.
Erkennbar sind die Informationen zur Nase, die man in Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts lesen kann, aus heterogenen Quellen geschöpft: Medizinische Abhandlungen und Bibelkommentare(435), physiognomische Essays und Reisebeschreibungen, Mythologien und chirurgische Praxis. Was wir in Lexika und Enzyklopädien heute lesen können, spiegelt dieses zusammengesetzte Wissen. Wie zum Trotz gegen diese Komplexität hatte schon Laurence Sterne vergeblich versucht, Eindeutigkeit festzustellen: "Unter dem Wort Nase in diesem langen Nasenkapitel und in jedem anderen Teil meines Werkes, wo das Wort Nase vorkommt - verstehe ich, so stelle ich fest, eine Nase und nichts mehr oder weniger."(436)
*
Auszug mit freundlicher Genehmigung des Akademie Verlages
(Copyright Akademie Verlag)
Informationen zum Buch und Autor hier
Die plastische Chirurgie war damals voll entwickelt und traf besonders bei Nasenverstümmelungen wohl auf ein großes Interesse: Geschwüre und Entzündungen, Pocken, Kriegseinwirkungen und eine gelegentlich noch praktizierte körperliche Kriminalstrafe des Abhackens von Nasen und Ohren führten dazu, dass ein Arzt "anstatt der natürlichen eine andere Nase, wo es nur immer seyn kan, ansetzen und anmachen muss". Mit Befremden zitierte man Berichte, dass in früheren Gesellschaften fehlende herrschaftliche Nasen durch Sklavennasen ersetzt wurden. Die Rhinoplastik des 18. Jahrhunderts experimentierte lieber mit Transplantationen, etwa wie folgt: Man drückt den Arm des Patienten auf sein Gesicht, ritzt das Gesicht an der Stelle, wo die Nase hin soll,
"und öffnet die Haut gleichfalls an dem Orte, der auf die Nase passet, soviel es das verlohrne Stück erfordert, mit einem Messerlein, drücket und bindet hernach das Haupt und den Arm wohl zusammen, und lässet solches vier Wochen unbeweglich stille liegen: denn binnen der Zeit pfleget das Fleisch des Armes und der Nase sich miteinander zu vereinigen und anzuheilen; Hierauf schneidet man so viel nöthig das Fleisch heraus und formiret es über eine gemachte und eingeschobene subtile Forme, soviel die Kunst zulassen will, zu einer andern Nase." (UL 23: 728)
Diese wochenlange Prozedur wurde allerdings von Patienten wie Ärzten als sehr umständlich empfunden, auch wenn wohl gute Ergebnisse zu erzielen waren. Andere chirurgisch-plastische Verfahren, eine Nase aus Hautfalten zu bilden, schränkten die Nasenlosen in ihrer Bewegung weniger ein und wurden schnell beliebt. Enzyklopädien berichteten über solche Themen, und gelegentlich versank die Beschreibung der ärztlichen Operation ganz im Detail. Ob man daraus schließen muss, dass die Leser des Lexikons selber zum Messer greifen sollten? Wahrscheinlicher ist, dass viele Leser ihre Nase deswegen so tief ins Lexikon steckten, weil sie angenehm schaudernd sich darüber freuen konnten, welche Qualen ihnen erspart blieben.
Die wohl oft geübte, aber eben auch oft beschriebene chirurgische Kunst der anaplastischen Nasennachbildung belehrt darüber, welch große Anstrengungen im 18. Jahrhundert dem Unternehmen galten, eine Nase neu zu bilden. Die Wiederherstellung von Funktionen wie Atmen oder Weinen waren dabei nicht die ausschlaggebenden Motive. Vielmehr war die Nase ein sozialer Magnet, mit dem man andere an sich ziehen konnte. Oder andersherum: Keine Nase zu haben, schreckte ab. Tycho Brahe übrigens soll diesen Effekt des nasenlosen Erschreckens gelegentlich genutzt haben, wenn er alleine forschen wollte: Er nahm einfach seine Prothese ab und konnte damit rechnen, seine Besucher damit zu vertreiben.(427)
Das konnte sich nicht jeder leisten. Und es gab andere, die selbst mit Nase den Kürzeren zogen und ohne Anerkennung blieben. Nase ist nicht gleich Nase, und die Physiologie dieses Organs erweitert sich leicht in eine größere Wissenswelt der Nasenvielfalt. Nase haben war nicht alles; Unterschiede zählten auch: "Der Wachsoldat sah dem Fremden ins Gesicht - nie in seinem Leben hatte er eine solche Nase gesehen! - Ich habe mit ihr schon sehr viel Glück gehabt, sagte der Fremde [...]".(428)
Dass die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts im Wissen und Denken durchaus international war, schlug sich in den Lexika der Zeit nieder: Historische Lexika von Louis Moréri oder von Daniel Hofmann werteten europäische Quellen aus und öffneten den Blick über Ländergrenzen hinweg; andere, wie der französische Orientalist Herbelot, bezogen sich exklusiv auf arabische und persische Literatur und machten den Orient erfahrbar. Kaufmannslexika schließlich, von Savary bis Zincke, übten den globalen Blick und ließen keinen Ort unerwähnt, an dem Handel getrieben wurde und sich Menschen unterschiedlichster Herkunft begegneten.(429) So war es niemals ein Geheimnis, dass es auf den verschiedenen Kontinenten auch verschiedene Nasen gab.
Auch medizinische Artikel vermerkten die Variationen der Nasenform: spitz oder platt, gerade oder krumm, groß oder klein. Nicht selten wurden dabei schon Hinweise auf rassische Besonderheiten gegeben, etwa dass die Afrikaner meist große und angedrückte Nasen haben, oder dass ferne Kulturen die in Europa unbekannten und ungewollten Nasenformen durch Bandagen und andere mechanische Vorkehrungen bei kleinen Kindern förderten.
Quer durch alle Artikelformen kamen die physiognomischen Interpretationen der Nasenform zur Sprache. Dass man an der Nase den Charakter erkennen könne, war wohl kaum angezweifelt, ebenso wenig ihre sozial-integrative Funktion. Laurence Sterne hat seinen Roman Tristram Shandy (1760-1767) um eine Figur herum aufgebaut, der die Geburtszange eine platte Nase gemacht hatte und für die diese Geschichte das eigentliche Geburtsereignis darstellt - eine verfehlte Identität. Und wahrscheinlich ist es beim Clown nicht zufällig die (künstliche rote) Nase, die ihn als Narren auszeichnet und seine Rolle als gesellschaftlichen Außenseiter unterstreicht. Nasen artikulierten Ordnungsmuster.
Ein interessanter Fall ist Omai - eigentlich Mai - als ein von Europa sozusagen adoptierter Polynesier. Von James Cook auf seiner zweiten Reise in Tahiti an Bord genommen, war der junge Mann zunächst als Mittler zwischen den Seeleuten und den Bewohnern der Südsee nützlich. Von Cooks Schiffen hieß eines "Abenteuer" (Adventure), und dessen Kapitän nahm Omai bis nach London mit, wo er zwischen 1774 und 1776 als exotische Kuriosität gehandelt und angestaunt wurde. Mehrere Bilder wurden gemalt und in Kupferstichen weiterverbreitet, wobei die Darstellungen sowohl das Exotische betonten - die dunkle Haut, das krause Haar, die tuchartigen, locker übergeworfenen Gewänder - als auch das Gesittete, Eingebürgerte, Zivilisierte, was in den Berichten der Zeit durchgängige Erwähnung findet, etwa wenn man herausstreicht, wie vollkommen Omais Verbeugungen waren.(430)
Auf Gemälden und Stichen zeigt die Nase des jungen Mannes, welchen Grad an Assimilation man ihm zubilligte. Wenn die Porträts ihn als Fremden wiedergeben, ist sie breit und groß, wenn der edle Wilde exemplifiziert wird, eher wohlgeformt und gemäßigt. Wo Omai in ruhiger Pose und mit direktem Blick idealisiert erscheint - wie auf einem Stich von Caldwell nach einer Zeichnung von William Hodges -, ist sie weniger polynesisch breit, sondern schmaler und insgesamt unauffälliger.
Die Porträtkunst des 18. Jahrhunderts hatte oft mit geschwollenen oder pokkenvernarbten Nasen zu tun - es waren schwierige Aufgaben für die Maler und Stecher, einen Mittelweg zwischen Wahrheits treue und Bildkomposition zu finden. Meist entschied man sich für die weniger realistische Darstellung und schönte. So finden wir in den Galerien der Kunstmuseen die vielfältigen Entstellungen nicht, die uns aus anderen Zeugnissen verbürgt sind: Man nahm ganz einfach die Warzen und Geschwüre nicht wahr und auch keinerlei Narben, so wenig wie ausgefallene Zähne. Würden wir nicht in den Zeichnungen von William Hogarth gelegentlich die Knollennase eines Säufers gezeichnet finden, die Gefahr wäre groß, in den Bildern des 18. Jahrhunderts die physischen Nöte des Zeitalters zu verkennen.
Will man tiefer in die Phänomenologie der Nase im 18. Jahrhundert eindringen, muss man allerdings eine breite Kenntnis der Kunst besitzen. Jemand, der hinter die fast überall durchgesetzte Idealisierung der Gesichtszüge schauen wollte, war Johann Georg Lavater, dessen "Physiognomik" im Grunde einen Kommentar zu überlieferten Gesichtsdarstellungen gibt. Ausgehend von gesammelten Abbildungen des menschlichen Antlitzes - in Stein, Metall, Holz, auf Leinwand und auf Papier - hat der Schriftsteller und Prediger Thesen entwickelt, die zunächst eher flüchtig notiert wurden. Erst spätere Auflagen und Übersetzungen des Werks haben die Thesen Lavaters zu so etwas wie einer festen Theorie gefügt. In der ersten Auflage ist der Blick ins Gesicht noch sehr empirisch und seine Auswertung spekulativ, was auch die Passagen über die Nase verraten.
Zwar behauptete Lavater, die Nase sei "die Wiederlage des Gehirns" und führte aus: "Auf ihr scheint eigentlich alle Kraft des Stirngewölbes zu ruhen, das sonst in Mund und Wangen elend zusammen stürzen würde"(431), er zeigte sich aber kaum an "schönen Nasen" interessiert. Gerade weil er sagen konnte, sein "ganzes Werk" sei "voll Beweise von der feinen und mannichfaltigen Bedeutsamkeit der menschlichen Nasen", konnte er sich gleich anschließend für Nasen begeistern, "die man nicht schön, die man eher hässlich nennet", und fordert dann: "Der Physiognomist wird sicherlich auf den ersten Blick bei Gesichtern mit solchen [d. h. hässlichen] Nasen verweilen, sich ihnen, wenn ihm Weisheit, Talente, Geistesgaben nicht gleichgültig sind, nähern, sich an sie schmiegen, und - ihr Hörer und Schüler werden[d] - wenigstens allemal ihr Bewunderer seyn."(432)
Man mag zweifeln, ob große Männer - angefangen mit Sokrates - immer hässliche Nasen hatten und grundsätzlich haben müssen. Ein anderer Topos der Zeit setzt auf Analogie und fordert Symmetrie zwischen dem Überragenden und dem Herausragenden, wie etwa das Conversationslexicon 1809 im Artikel über >Karl den Großen<: "Alles war groß an ihm. Er hatte einen hohen Wuchs, große lebhafte Augen, ein heiteres offnes Gesicht und eine Adler-Nase."(433) Unübersehbar ist jedenfalls, dass die "Nasologie" im 18. Jahrhundert eine entwickelte Wissensform darstellte. Die Nase hatte ganz entschieden soziale und symbolische, ja ideologische Funktionen, neben den rein physiologischen.
Ebenso offensichtlich ist, dass das Wissen über die Nase schwer zu sortieren war, denn Natur und Kultur der Nase zeig ten sich den Zeitgenossen der Aufklärung vielfach verschränkt. War die Nase der Afrikaner wirklich anders gewachsen und also genetisch anders angelegt als die europäische? War Natur oder Kultur die Ursache der Vielfalt im Leben? Manche haben damals die Lesart von der menschengemachten Verformung angenommen (der zufolge durch das Tragen der Kleinkinder auf den Rücken der Mutter deren Nase geplättet werde), auch weil ihnen die Annahme rassischer Verschiedenheit problematisch erschien. Noch die Aufklärer der Encyclopédie hatten mit solchen Vorurteilen zu tun und fanden Anlass, Nasenehrlichkeit zu fordern: "Dieser Teil des Gesichts variiert bei den verschiedenen Menschen in Größe und Gestalt schon im Augenblick der Geburt sehr stark."(434) Nase also war Natur, was auch bedeutete, dass sie das Schicksal des Menschen, seine Individualität wie gesellschaftliche Stellung bestimmte.
Erkennbar sind die Informationen zur Nase, die man in Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts lesen kann, aus heterogenen Quellen geschöpft: Medizinische Abhandlungen und Bibelkommentare(435), physiognomische Essays und Reisebeschreibungen, Mythologien und chirurgische Praxis. Was wir in Lexika und Enzyklopädien heute lesen können, spiegelt dieses zusammengesetzte Wissen. Wie zum Trotz gegen diese Komplexität hatte schon Laurence Sterne vergeblich versucht, Eindeutigkeit festzustellen: "Unter dem Wort Nase in diesem langen Nasenkapitel und in jedem anderen Teil meines Werkes, wo das Wort Nase vorkommt - verstehe ich, so stelle ich fest, eine Nase und nichts mehr oder weniger."(436)
*
Auszug mit freundlicher Genehmigung des Akademie Verlages
(Copyright Akademie Verlag)
Informationen zum Buch und Autor hier
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens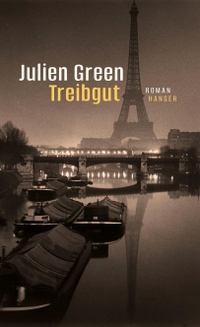 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut