Im Kino
Signora, das ist die Wirklichkeit
Die Filmkolumne. Von Lutz Meier
19.05.2015. Asif Kapadias Amy-Winheouse-Biopic aus Handyfilmchen, Nanni Morettis Angriff auf den Sozialfilm und muntere Amerikaner - das Filmfest in Cannes wagt sich hin und wieder aus der erzählerischen Deckung.Darauf hat selbst die berühmte Filmregisseurin keine Antwort mehr. Sie dreht gerade einen dieser Sozialfilme, wie sie im Augenblick in Frankreich, Italien, Spanien so gern produziert werden: Arbeiter haben ihre eigene Fabrik besetzt, der neue Eigentümer ist ein arroganter Amerikaner und trotz halbwegs moderner Kulissen sieht alles mal wieder aus, als sollten hier die Mythen des 19. Jahrhunderts, der 1930er Jahre und die von 1968 wiedererweckt werden.
Die Filmregisseurin, Margherita heißt sie, ist selbst eine Filmfigur in der neuesten Produktion von Nanni Moretti, der seit "Liebes Tagebuch" seine Filme regelmäßig zum Festival nach Cannes bringen darf. Man dreht also eine Szene in der besetzten Fabrik, die Produktionsleute haben einen Trupp Statisten organisiert, um die Arbeiter zu spielen. Aber Margherita (Margherita Buy) beschwert sich: Die hätten hier ja alle lackierte Fingernägel, aufgespritzte Lippen, Tattoos und so. Sie hätte doch wirkliche Arbeiter bestellt! Da antwortet ihr der Produktionsleiter: "Signora, das ist die Wirklichkeit".

John Turturro in Nanni Morettis "Mia Madre"
So wie in jener Szene geht es öfter in diesem Jahr in Cannes: Sozialfilmer, die die Wirklichkeit verloren haben und Geschichtenerzähler, die sie wiederfinden. Morettis zart satirische Selbstanklage in dem Film "Mia Madre" bringt es auf den Punkt. Der Film beleuchtet genau und intelligent die Idee, dass man die soziale Wirklichkeit nicht erfassen kann, wenn man nicht einmal die private, persönliche Wirklichkeit meistert (die Margherita völlig entglitten ist). Gut, das ist jetzt auch keine brandneue Einsicht und Moretti gebraucht auch keine bahnbrechende Ästhetik, sondern das geschmeidig eingesetzte Handwerkszeug des Erzählkinos, um uns jene Weisheit nahezubringen. Aber immerhin reflektiert er damit ganz direkt das, wovon die anderen Filme in Cannes nur indirekt künden: Davon, dass das alte Kino in die Krise geraten ist, und dass es sich in dem, was in Cannes zu sehen ist, daraus nur manchmal und viel zu selten herauswagt.
Aber was ist eigentlich geschehen? Die Folgen der Finanzkrise. Die digitale Revolution. Die Globalisierung der Märkte und Geschmäcker: All das dauert nun schon ein paar Jahre an und jedes einzelne dieser Phänomene kann der Filmkunst neuen Schwung verleihen, wirtschaftlich, inhaltlich, ästhetisch. Vereinzelt ist dieser Schwung durchaus auch zu sehen. Doch die alte europäische und amerikanische Filmkunstbranche, die Cannes immer noch dominiert, begreift die neue Zeit nach wie vor hauptsächlich als Bedrohung. Da kommt der Kreativchef des Streaming-Dienstes Netflix, Ted Sarandos, nach Cannes und erzählt, wie seine Firma nach den neuen Serien auch neue Filme finanzieren und direkt zum Zuschauer bringen will - und wird von einem französischen Filmjournalisten angeherrscht, dass er das Ende des Autorenfilms plane. Da muss sich EU-Kommissar Günther Oettinger im Salon des Ambassadeurs des Festivalpalasts dem versammelten Zorn der europäischen Filmer stellen, weil die EU-Kommission in Europa die nationalen Grenzen beim Verkauf von Filmrechten aufheben will. Was in der Tat das bisherige Geschäftsmodell der Produzenten und Verleiher erschüttern würde - aber in Cannes fragt eben kaum jemand, wie denn ein Neues aussehen könnte. Man pocht stattdessen auf die Erhaltung des Alten.

Amy Winehouse according to Asif Kapadia
Wie etwas Neues aussehen könnte: Da zeigte das Festival in einer Spezialvorstellung von "Amy", der biographischen Dokumentation des britischen Filmemachers Asif Kapadia über Leben und Sterben der Sängerin Amy Winehouse. Einer der verblüffenden Aspekte an dem Film ist, dass er zum großen Teil aus Handy-Filmschnipseln besteht und es mit diesen vermeintlich oberflächlichen Ausschnitten schafft, in die Tiefe zu gehen. Die Geschichte von Amy, die der Film erzählt, ist die ganze Tragödie von Sucht, Verrat, Hoffnung, zerstörerischem Ruhm und mörderischem Voyeurismus, die jetzt auch nicht zum ersten Mal im Kino zu sehen ist und in ihrer Dramaturgie etwa Ähnlichkeiten zu dem (natürlich fiktionalen) Biopic "La Môme" (in Deutschland: "La Vie en Rose") aufweist, das 2007 das Leben von Edith Piaf dramatisierte, welches ein paar Jahrzehnte früher ein wenig langsamer, aber genauso unvermeidlich auf sein Ende hin zu verlaufen schien, wie das von Winehouse. Dieser Aspekt wird auch "Amy" viele Zuschauer zutreiben, aber das ist nicht der Punkt: Der Film dokumentiert, dass man inzwischen ein ganzes Leben (und von Winhouse"s Generation an wahrscheinlich die meisten Leben) über Alltags-Filmschnipsel dokumentieren kann. Und dass man damit, wenn es gut gemacht ist, das Genre befreien kann von den Zusammenschnitten von Talking Heads, subjektiven Erinnerungen und der Überbetonung der öffentlichen Archivszenen, also von all dem, woraus biografische Dokus bis heute bestehen. Vorausgesetzt, man kommt an die kleinen intimen und banalen Szenen, die auf verschiedensten Handys gespeichert sind. Kapadia ist das bei Amy Winehouse, wie auch immer gelungen.
Der Film muss mit dem Paradox leben, dass er eine bittere Anklage eben jenes Voyeurismus versucht, den er selbst bedient. Denn natürlich würde man niemanden für eine Winehouse-Dokumentation vor die Bildschirme locken können, wenn nicht mit der Verheißung, die (Selbst-)Zerstörung der süchtigen Sängerin noch einmal zum Miterleben zu liefern, die die Boulevardmedien (und nicht nur sie) bis zum Tod von Winehouse im Jahre 2011 in Echtzeit besorgt hatten. Doch Kapadia geht mit diesem Paradox halbwegs anständig um. In seinen Szenen zeigt er die überstrahlenden Attacken der Fotoblitze, die Journalistenrudel, die vorgeblich nachrichtliche Ausweidung der Person in vermeintlich seriösen Sendern wie CNN sowie die trüben Witze über Winehouse"s Suchtprobleme, die ihr öffentliches Leben begleiteten. So nachdrücklich beleuchtet der Film die Medienphänomene, dass es einen schaudert, wenn man in Cannes aus dem Kino kommt und beobachtet, wie auf dem roten Teppich, bei den Photocalls und Strandpartys dann sehr junge Darsteller in die gleichen Blitzlichtgewitter staksen, den Rudeln vorweg laufen, wie sie in eine Wirklichkeit geschickt werden, die keine ist.
leben, dass er eine bittere Anklage eben jenes Voyeurismus versucht, den er selbst bedient. Denn natürlich würde man niemanden für eine Winehouse-Dokumentation vor die Bildschirme locken können, wenn nicht mit der Verheißung, die (Selbst-)Zerstörung der süchtigen Sängerin noch einmal zum Miterleben zu liefern, die die Boulevardmedien (und nicht nur sie) bis zum Tod von Winehouse im Jahre 2011 in Echtzeit besorgt hatten. Doch Kapadia geht mit diesem Paradox halbwegs anständig um. In seinen Szenen zeigt er die überstrahlenden Attacken der Fotoblitze, die Journalistenrudel, die vorgeblich nachrichtliche Ausweidung der Person in vermeintlich seriösen Sendern wie CNN sowie die trüben Witze über Winehouse"s Suchtprobleme, die ihr öffentliches Leben begleiteten. So nachdrücklich beleuchtet der Film die Medienphänomene, dass es einen schaudert, wenn man in Cannes aus dem Kino kommt und beobachtet, wie auf dem roten Teppich, bei den Photocalls und Strandpartys dann sehr junge Darsteller in die gleichen Blitzlichtgewitter staksen, den Rudeln vorweg laufen, wie sie in eine Wirklichkeit geschickt werden, die keine ist.
Doch Kapadia macht etwas, dass man auch in Cannes viel häufiger tun sollte, er setzt, ganz unpathetisch gesagt, die Kunst dagegen: Er setzt sich mit dem Wert der Musik und der Texte von Amy Winehouse auseinander und gibt ihr so etwas wieder, was über dem biografischen Tand beinahe vergessen worden wäre.
 Das Wettbewerbsprogramm in diesem Jahr ist einerseits sehr französisch dominiert (fünf von 19 Beiträgen kommen aus Frankreich). Andererseits zeigt es bislang eine recht starke Vorstellung des amerikanischen Kinos, das sich in den vergangenen Jahren schon weitgehend abgemeldet hatte. Zwar fiel der neue Film von Gus van Sant, "The Sea of Trees", bei Kritikern und Publikum in Cannes vollständig durch. Dafür konnten sich viele für Todd Haynes" Drama "Carol" erwärmen: Eine mit Cate Blanchett und Rooney Mara prominent besetzte und gut ausgestattete Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, einer jene Filme, die in besseren Zeiten in großer Zahl aus den Hollywood-Studios (und von den Independents) nach Cannes kamen und jetzt gar nicht mehr.
Das Wettbewerbsprogramm in diesem Jahr ist einerseits sehr französisch dominiert (fünf von 19 Beiträgen kommen aus Frankreich). Andererseits zeigt es bislang eine recht starke Vorstellung des amerikanischen Kinos, das sich in den vergangenen Jahren schon weitgehend abgemeldet hatte. Zwar fiel der neue Film von Gus van Sant, "The Sea of Trees", bei Kritikern und Publikum in Cannes vollständig durch. Dafür konnten sich viele für Todd Haynes" Drama "Carol" erwärmen: Eine mit Cate Blanchett und Rooney Mara prominent besetzte und gut ausgestattete Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, einer jene Filme, die in besseren Zeiten in großer Zahl aus den Hollywood-Studios (und von den Independents) nach Cannes kamen und jetzt gar nicht mehr.
"Carol" ist eine sauber und routiniert erzählte Literaturverfilmung nach einer Vorlage von Patricia Highsmith, ein hochkarätiges Drama für einen schönen Filmabend der gesetzteren Stände. Das ist nicht so verächtlich gemeint, wie es klingt, denn tatsächlich hat der Film in der Zeit, die er sich lässt, seine Geschichte zu entfalten, Qualitäten, die selten geworden sind: Die sehr reiche Vorstadt-Hausfrau Carol (Blanchett) lernt im New York des Jahres 1953 die Aushilfsverkäuferin und Träumerin Therese (Mara) erst kennen, dann lieben und dann bewegen sie sich durch ein Amerika, das noch ganz Amerika sein darf, nach Westen - und jede für sich wieder zurück.

Cate Blanchett in Todd Haynes" "Carol"
Allerdings ist der Film ausgesprochen konventionell erzählt, hat er außer vom alten Märchen über das Wunder und das Scheitern der Liebe so gar nichts zu sagen, als dass er unter normalen Umständen ein Wettbewerbsfavorit wäre. Er bewegt nur eben etwas, was Cannes mehr bremst, als bewegt, die Sehnsucht nach dem alten Kino.
Von anderer Qualität ist da "Sicario" der Thriller des Kanadiers Denis Villeneuve. Er geht mitten hinein in die, jawohl, Wirklichkeit des Bandenkriegs von amerikanischen Geheimdienstsöldnern an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Auf völlig verlorenen Posten stehend, realisiert die FBI-Agentin Kate (Emily Blunt), dass das Recht und der höhere Zweck völlig irrelevant geworden sind, wo Afghanistan-Heimkehrer und CIA-Offizieren vom Schlage von Alejandro (Benicio del Toro) kämpfen, der ihr entgegenhält: "Sie kommen aus einer Welt der Grenzen, aber die Grenzen haben sich hier längst verschoben". Der einzige Ausweg, den er ihr weist, ist in irgendeine verschlafene Kleinstadt zu ziehen, wo Amerika noch Amerika ist und das Gesetz noch die Regel.

Denis Villeneuves "Sicario"
Was mögen sich jetzt die Coen-Brüder denken, fragt man sich da als Cannes-Zuschauer, wenn er die Flüge über die unerbittlichen Wüsten von Texas und Nordmexiko verfolgt und die gnadenlose Gewalt der regierungsbestellten Drogenkrieger. Denn die Regie-Brüder, die dieses Jahr die Jury in Cannes leitet, hat zumindest die Grenzen des Festival-Reglements schon verschoben - sie sind nicht nur zu zweit Jury-Chef, sie haben jeder eine Stimme.
Die Filmregisseurin, Margherita heißt sie, ist selbst eine Filmfigur in der neuesten Produktion von Nanni Moretti, der seit "Liebes Tagebuch" seine Filme regelmäßig zum Festival nach Cannes bringen darf. Man dreht also eine Szene in der besetzten Fabrik, die Produktionsleute haben einen Trupp Statisten organisiert, um die Arbeiter zu spielen. Aber Margherita (Margherita Buy) beschwert sich: Die hätten hier ja alle lackierte Fingernägel, aufgespritzte Lippen, Tattoos und so. Sie hätte doch wirkliche Arbeiter bestellt! Da antwortet ihr der Produktionsleiter: "Signora, das ist die Wirklichkeit".

John Turturro in Nanni Morettis "Mia Madre"
So wie in jener Szene geht es öfter in diesem Jahr in Cannes: Sozialfilmer, die die Wirklichkeit verloren haben und Geschichtenerzähler, die sie wiederfinden. Morettis zart satirische Selbstanklage in dem Film "Mia Madre" bringt es auf den Punkt. Der Film beleuchtet genau und intelligent die Idee, dass man die soziale Wirklichkeit nicht erfassen kann, wenn man nicht einmal die private, persönliche Wirklichkeit meistert (die Margherita völlig entglitten ist). Gut, das ist jetzt auch keine brandneue Einsicht und Moretti gebraucht auch keine bahnbrechende Ästhetik, sondern das geschmeidig eingesetzte Handwerkszeug des Erzählkinos, um uns jene Weisheit nahezubringen. Aber immerhin reflektiert er damit ganz direkt das, wovon die anderen Filme in Cannes nur indirekt künden: Davon, dass das alte Kino in die Krise geraten ist, und dass es sich in dem, was in Cannes zu sehen ist, daraus nur manchmal und viel zu selten herauswagt.
Aber was ist eigentlich geschehen? Die Folgen der Finanzkrise. Die digitale Revolution. Die Globalisierung der Märkte und Geschmäcker: All das dauert nun schon ein paar Jahre an und jedes einzelne dieser Phänomene kann der Filmkunst neuen Schwung verleihen, wirtschaftlich, inhaltlich, ästhetisch. Vereinzelt ist dieser Schwung durchaus auch zu sehen. Doch die alte europäische und amerikanische Filmkunstbranche, die Cannes immer noch dominiert, begreift die neue Zeit nach wie vor hauptsächlich als Bedrohung. Da kommt der Kreativchef des Streaming-Dienstes Netflix, Ted Sarandos, nach Cannes und erzählt, wie seine Firma nach den neuen Serien auch neue Filme finanzieren und direkt zum Zuschauer bringen will - und wird von einem französischen Filmjournalisten angeherrscht, dass er das Ende des Autorenfilms plane. Da muss sich EU-Kommissar Günther Oettinger im Salon des Ambassadeurs des Festivalpalasts dem versammelten Zorn der europäischen Filmer stellen, weil die EU-Kommission in Europa die nationalen Grenzen beim Verkauf von Filmrechten aufheben will. Was in der Tat das bisherige Geschäftsmodell der Produzenten und Verleiher erschüttern würde - aber in Cannes fragt eben kaum jemand, wie denn ein Neues aussehen könnte. Man pocht stattdessen auf die Erhaltung des Alten.

Amy Winehouse according to Asif Kapadia
Wie etwas Neues aussehen könnte: Da zeigte das Festival in einer Spezialvorstellung von "Amy", der biographischen Dokumentation des britischen Filmemachers Asif Kapadia über Leben und Sterben der Sängerin Amy Winehouse. Einer der verblüffenden Aspekte an dem Film ist, dass er zum großen Teil aus Handy-Filmschnipseln besteht und es mit diesen vermeintlich oberflächlichen Ausschnitten schafft, in die Tiefe zu gehen. Die Geschichte von Amy, die der Film erzählt, ist die ganze Tragödie von Sucht, Verrat, Hoffnung, zerstörerischem Ruhm und mörderischem Voyeurismus, die jetzt auch nicht zum ersten Mal im Kino zu sehen ist und in ihrer Dramaturgie etwa Ähnlichkeiten zu dem (natürlich fiktionalen) Biopic "La Môme" (in Deutschland: "La Vie en Rose") aufweist, das 2007 das Leben von Edith Piaf dramatisierte, welches ein paar Jahrzehnte früher ein wenig langsamer, aber genauso unvermeidlich auf sein Ende hin zu verlaufen schien, wie das von Winehouse. Dieser Aspekt wird auch "Amy" viele Zuschauer zutreiben, aber das ist nicht der Punkt: Der Film dokumentiert, dass man inzwischen ein ganzes Leben (und von Winhouse"s Generation an wahrscheinlich die meisten Leben) über Alltags-Filmschnipsel dokumentieren kann. Und dass man damit, wenn es gut gemacht ist, das Genre befreien kann von den Zusammenschnitten von Talking Heads, subjektiven Erinnerungen und der Überbetonung der öffentlichen Archivszenen, also von all dem, woraus biografische Dokus bis heute bestehen. Vorausgesetzt, man kommt an die kleinen intimen und banalen Szenen, die auf verschiedensten Handys gespeichert sind. Kapadia ist das bei Amy Winehouse, wie auch immer gelungen.
Der Film muss mit dem Paradox
 leben, dass er eine bittere Anklage eben jenes Voyeurismus versucht, den er selbst bedient. Denn natürlich würde man niemanden für eine Winehouse-Dokumentation vor die Bildschirme locken können, wenn nicht mit der Verheißung, die (Selbst-)Zerstörung der süchtigen Sängerin noch einmal zum Miterleben zu liefern, die die Boulevardmedien (und nicht nur sie) bis zum Tod von Winehouse im Jahre 2011 in Echtzeit besorgt hatten. Doch Kapadia geht mit diesem Paradox halbwegs anständig um. In seinen Szenen zeigt er die überstrahlenden Attacken der Fotoblitze, die Journalistenrudel, die vorgeblich nachrichtliche Ausweidung der Person in vermeintlich seriösen Sendern wie CNN sowie die trüben Witze über Winehouse"s Suchtprobleme, die ihr öffentliches Leben begleiteten. So nachdrücklich beleuchtet der Film die Medienphänomene, dass es einen schaudert, wenn man in Cannes aus dem Kino kommt und beobachtet, wie auf dem roten Teppich, bei den Photocalls und Strandpartys dann sehr junge Darsteller in die gleichen Blitzlichtgewitter staksen, den Rudeln vorweg laufen, wie sie in eine Wirklichkeit geschickt werden, die keine ist.
leben, dass er eine bittere Anklage eben jenes Voyeurismus versucht, den er selbst bedient. Denn natürlich würde man niemanden für eine Winehouse-Dokumentation vor die Bildschirme locken können, wenn nicht mit der Verheißung, die (Selbst-)Zerstörung der süchtigen Sängerin noch einmal zum Miterleben zu liefern, die die Boulevardmedien (und nicht nur sie) bis zum Tod von Winehouse im Jahre 2011 in Echtzeit besorgt hatten. Doch Kapadia geht mit diesem Paradox halbwegs anständig um. In seinen Szenen zeigt er die überstrahlenden Attacken der Fotoblitze, die Journalistenrudel, die vorgeblich nachrichtliche Ausweidung der Person in vermeintlich seriösen Sendern wie CNN sowie die trüben Witze über Winehouse"s Suchtprobleme, die ihr öffentliches Leben begleiteten. So nachdrücklich beleuchtet der Film die Medienphänomene, dass es einen schaudert, wenn man in Cannes aus dem Kino kommt und beobachtet, wie auf dem roten Teppich, bei den Photocalls und Strandpartys dann sehr junge Darsteller in die gleichen Blitzlichtgewitter staksen, den Rudeln vorweg laufen, wie sie in eine Wirklichkeit geschickt werden, die keine ist.Doch Kapadia macht etwas, dass man auch in Cannes viel häufiger tun sollte, er setzt, ganz unpathetisch gesagt, die Kunst dagegen: Er setzt sich mit dem Wert der Musik und der Texte von Amy Winehouse auseinander und gibt ihr so etwas wieder, was über dem biografischen Tand beinahe vergessen worden wäre.
 Das Wettbewerbsprogramm in diesem Jahr ist einerseits sehr französisch dominiert (fünf von 19 Beiträgen kommen aus Frankreich). Andererseits zeigt es bislang eine recht starke Vorstellung des amerikanischen Kinos, das sich in den vergangenen Jahren schon weitgehend abgemeldet hatte. Zwar fiel der neue Film von Gus van Sant, "The Sea of Trees", bei Kritikern und Publikum in Cannes vollständig durch. Dafür konnten sich viele für Todd Haynes" Drama "Carol" erwärmen: Eine mit Cate Blanchett und Rooney Mara prominent besetzte und gut ausgestattete Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, einer jene Filme, die in besseren Zeiten in großer Zahl aus den Hollywood-Studios (und von den Independents) nach Cannes kamen und jetzt gar nicht mehr.
Das Wettbewerbsprogramm in diesem Jahr ist einerseits sehr französisch dominiert (fünf von 19 Beiträgen kommen aus Frankreich). Andererseits zeigt es bislang eine recht starke Vorstellung des amerikanischen Kinos, das sich in den vergangenen Jahren schon weitgehend abgemeldet hatte. Zwar fiel der neue Film von Gus van Sant, "The Sea of Trees", bei Kritikern und Publikum in Cannes vollständig durch. Dafür konnten sich viele für Todd Haynes" Drama "Carol" erwärmen: Eine mit Cate Blanchett und Rooney Mara prominent besetzte und gut ausgestattete Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, einer jene Filme, die in besseren Zeiten in großer Zahl aus den Hollywood-Studios (und von den Independents) nach Cannes kamen und jetzt gar nicht mehr."Carol" ist eine sauber und routiniert erzählte Literaturverfilmung nach einer Vorlage von Patricia Highsmith, ein hochkarätiges Drama für einen schönen Filmabend der gesetzteren Stände. Das ist nicht so verächtlich gemeint, wie es klingt, denn tatsächlich hat der Film in der Zeit, die er sich lässt, seine Geschichte zu entfalten, Qualitäten, die selten geworden sind: Die sehr reiche Vorstadt-Hausfrau Carol (Blanchett) lernt im New York des Jahres 1953 die Aushilfsverkäuferin und Träumerin Therese (Mara) erst kennen, dann lieben und dann bewegen sie sich durch ein Amerika, das noch ganz Amerika sein darf, nach Westen - und jede für sich wieder zurück.

Cate Blanchett in Todd Haynes" "Carol"
Allerdings ist der Film ausgesprochen konventionell erzählt, hat er außer vom alten Märchen über das Wunder und das Scheitern der Liebe so gar nichts zu sagen, als dass er unter normalen Umständen ein Wettbewerbsfavorit wäre. Er bewegt nur eben etwas, was Cannes mehr bremst, als bewegt, die Sehnsucht nach dem alten Kino.
Von anderer Qualität ist da "Sicario" der Thriller des Kanadiers Denis Villeneuve. Er geht mitten hinein in die, jawohl, Wirklichkeit des Bandenkriegs von amerikanischen Geheimdienstsöldnern an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Auf völlig verlorenen Posten stehend, realisiert die FBI-Agentin Kate (Emily Blunt), dass das Recht und der höhere Zweck völlig irrelevant geworden sind, wo Afghanistan-Heimkehrer und CIA-Offizieren vom Schlage von Alejandro (Benicio del Toro) kämpfen, der ihr entgegenhält: "Sie kommen aus einer Welt der Grenzen, aber die Grenzen haben sich hier längst verschoben". Der einzige Ausweg, den er ihr weist, ist in irgendeine verschlafene Kleinstadt zu ziehen, wo Amerika noch Amerika ist und das Gesetz noch die Regel.

Denis Villeneuves "Sicario"
Was mögen sich jetzt die Coen-Brüder denken, fragt man sich da als Cannes-Zuschauer, wenn er die Flüge über die unerbittlichen Wüsten von Texas und Nordmexiko verfolgt und die gnadenlose Gewalt der regierungsbestellten Drogenkrieger. Denn die Regie-Brüder, die dieses Jahr die Jury in Cannes leitet, hat zumindest die Grenzen des Festival-Reglements schon verschoben - sie sind nicht nur zu zweit Jury-Chef, sie haben jeder eine Stimme.
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen
Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens
Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens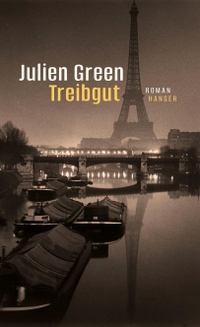 Julien Green: Treibgut
Julien Green: Treibgut