Die Deutschen waren genauso in den traditionellen Vorstellungen von militärischer Ehre gefangen wie ihre Gegner, daher endet der folgende deutsche Bericht über das Blutbad des ersten Tages, wie so viele britische Schilderungen, nicht mit einem Kommentar zum selbstmörderischen Charakter des Angriffs, sondern zur Tapferkeit der Soldaten. »Es ist ein mörderisches Hin und Her, ein Schauspiel unerhörter Tapferkeit, Kühnheit und Entschlossenheit auf allen Seiten.«
Der Plan, nebeneinander in geordneter Linie vorzurücken, wurde rasch aufgegeben: Die Männer teilten sich in kleine Gruppen auf, die hinter kleinen Hügeln und in Granattrichtern Schutz suchten. Doch ein Rückzug kam für die stark dezimierten britischen Truppen nicht in Frage, denn jedes Bataillon hatte einige Männer als sogenannte »Schlachtpolizisten« eingeteilt, die Nachzügler vorwärts trieben. »Als wir zu den deutschen Drahtverhauen gelangten, sahen wir - nach allem, was man uns vorher erzählt hatte - zu unserer grenzenlosen Verblüffung, dass sie unbeschädigt waren«, erinnerte sich ein britischer Gefreiter. »Der Oberst und ich gingen hinter einer kleinen Böschung in Deckung, doch nach einer Weile erhob sich der Oberst auf Hände und Knie, um besser sehen zu können. Sofort wurde er von einer einzigen Kugel in die Stirn getroffen.« Da die Artillerie nur wenig Stacheldraht zerstört hatte, mussten die britischen Soldaten zusammenrücken, um durch die wenigen Lücken zu gelangen, die zu finden waren - wodurch das Schlachtfeld noch mehr zum Schießstand wurde. Viele Soldaten starben, als sie mit der Kleidung, vor allem die Schotten mit ihren wehenden Kilts, im Draht hängen blieben und dem gegnerischen Feuer preisgegeben waren. »Aus unserer ganzen Kompanie kamen dort nur drei durch«, berichtete ein Gefreiter des 4. Tyneside Scottish Battalion. »Da waren noch mein Leutnant, ein Feldwebel und ich. Die übrigen schien es im Niemandsland erwischt zu haben … Der Offizier sagte: 'Allmächtiger, wo ist der Rest der Jungs?'«
Die vielgepriesene »Feuerwalze«, die die deutschen MG- und Scharfschützen veranlassen sollte, in Deckung zu bleiben, richtete wenig aus. Sie kroch zwar entsprechend dem festgelegten Zeitplan vorwärts - setzte dann aber ihren Weg nutzlos in unbestimmte Ferne fort, während die britischen Soldaten, die ihr eigentlich folgen sollten, schon längst durch die intakten Stacheldrahtverhaue aufgehalten waren. Die Truppen hatten keine Möglichkeit, ihre Artillerie im rückwärtigen Bereich über die Planänderung zu informieren. Vergebens wartete die Kavallerie hinter den britischen Linien. Wer im Niemandsland überlebte, wartete manchmal bis zum Einbruch der Dunkelheit, bevor er in den eigenen Graben zurückkroch, doch selbst dann noch ließ das ständige Streufeuer der deutschen Maschinengewehre Funken aufstieben, wenn die Kugeln den britischen Stacheldraht trafen.
Von den 120 000 britischen Soldaten, die am 1. Juli 1916 in die Schlacht gingen, waren 57 000 tot oder verwundet, bevor der Tag vorüber war - fast zwei Mann Verlust pro Meter Front. 19 000 fielen, die meisten in der katastrophalen ersten Stunde des Angriffs, und weitere 2000 starben schwerverwundet in den Lazaretten. Bei den Deutschen betrugen die geschätzten Verluste 8000 Mann. Wie üblich waren die höchsten Opfer unter den Offizieren - drei Viertel wurden getötet oder verwundet. Viele hatten noch wenige Wochen zuvor das Festbankett für Eton-Absolventen besucht: Mehr als 30 ehemalige Eton-Schüler kamen am 1. Juli ums Leben. Captain Nevill von den East Surreys, der die Fußbälle verteilt hatte, erhielt in den ersten Minuten des Kampfes einen tödlichen Kopfschuss.
Das 1. Newfoundland Regiment, das sich auf seinen Viktoriakreuz-Träger und die junge Frau freute, die sich als Belohnung ausgelobt hatte, wurde praktisch ausgelöscht. Die 752 Männer kletterten aus ihren Gräben, um auf die skelettartigen Überreste eines Obstgartens vorzurücken, und wurden von einem deutschen Maschinengewehr unter Beschuss genommen; am Ende des Tages waren 684 tot, verwundet oder vermisst, darunter alle Offiziere. Die deutschen Truppen, die von den Neufundländern angegriffen wurden, verloren nicht einen einzigen Mann. Nur im äußersten Süden der Angriffszone, auf einem Frontabschnitt von rund 5 Kilometern, konnten die Briten einen nennenswerten Gebietsgewinn verzeichnen - rund anderthalb Kilometer. Es waren die blutigsten 24 Stunden, die irgendeine Armee in diesem Krieg erlitt.
Die angreifenden Soldaten hatten den Befehl bekommen, sich nicht um verwundete Kameraden zu kümmern, sondern sie den Bahrenträgern zu überlassen, die folgen würden. Zu den Toten und Verwundeten gehörten jedoch auch viele hundert Bahrenträger, nirgendwo gab es genügend Männer, um die Schwerverwundeten rechtzeitig zu Verbandsplätzen zu schaffen. Die Bahren gingen aus; einige Verwundete wurden zu zweit auf einer Bahre oder auf Wellblechen getragen, deren Ränder den Trägern die Finger aufrissen. Viele Verwundete, die den ersten Tag überlebten, blieben auf dem Schlachtfeld. Wochen später fanden ihre Kameraden sie in Granattrichtern, in denen sie kriechend Schutz gesucht, ihre Bibel herausgenommen und sich in ihre wasserdichte Zeltplane gewickelt hatten, um allein und in Schmerzen zu sterben.
Auch auf andere Weise forderte der schreckliche Tag noch im Nachhinein Opfer. Der Bataillonskommandeur Oberstleutnant E. T. F. Sandys, der an diesem Tag erleben musste, wie mehr als 500 seiner Männer fielen oder verwundet wurden, erschoss sich zwei Monate später in einem Londoner Hotelzimmer, nachdem er an einen Offizierskameraden geschrieben hatte: »Seit dem 1. Juli habe ich nicht mehr einen Augenblick lang meinen Frieden gefunden.«
Am zweiten Tag der Schlacht erhielt Haig die Mitteilung, dass die Verluste bislang mehr als 40 000 betrügen - eine starke Untertreibung, obwohl immer noch eine entsetzliche Zahl. »Das ist nicht als schwerer Verlust anzusehen«, schrieb er in sein Tagebuch, »bedenkt man die Zahl der Beteiligten und die Länge der angegriffenen Front.«
Im Fortgang der Kämpfe blieben die Gewinne minimal: eine halber Kilometer hier, ein paar hundert Meter dort, und an einigen Stellen kein Zentimeter. Aber das tat Haigs Optimismus keinen Abbruch. Als das Blutbad schon eine Woche andauerte, schrieb er an seine Frau: »Noch vierzehn Tage, und hoffe mit Gottes Hilfe, einige entscheidende Ergebnisse zu erzielen.« Einige Tage später teilte er ihr mit: »Wenn wir dieses Mal keinen Erfolg haben, wird er uns das nächste Mal zuteil werden !«
Sogar heute noch vertreten Haigs Fürsprecher die Ansicht, die Schlacht an der Somme habe ihre eigentliche Aufgabe erfüllt, indem sie bei Verdun den Druck auf die Franzosen milderte, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmte. Aber die Deutschen hatten bereits eine Woche vor Beginn der Somme-Offensive bei einem Entscheidungsangriff, der kläglich gescheitert war, jede Hoffnung auf Eroberung der Festung begraben müssen - wobei sie weitgehend die gleichen bitteren Erfahrungen machten wie die Briten: In diesem Krieg waren die Verteidiger gegenüber den Angreifern stets im Vorteil. Obwohl sich also die Gefahr bei Verdun verringert hatte, gab Haig stur und unnachgiebig immer neue Befehle zum Angriff an der Somme aus - unglaubliche viereinhalb Monate lang.
Die beste Waffe der Deutschen blieb der Stacheldraht. Jede Woche beförderten sie 7000 Tonnen davon an die Front, in langen Rollen, in zwei Lagen auf Güterwagen gestapelt. Beide Seiten verwendeten sehr wirksame neue Drahtsorten, die teilweise alle zwei bis fünf Zentimeter geschärfte Stacheln besaßen. Angesichts solcher Hindernisse waren die britischen Soldaten nicht mehr in der Stimmung, Fußbälle zu treten. Unter den Soldaten, die neu in die Schlacht geworfen wurden, »waren wenige, in deren Verhalten sich große Bereitschaft zum Kampf ausdrückte«, schrieb Graham Seton Hutchison, ein Kompaniechef. »Sie gingen sehr diszipliniert in Stellung, wirkten aber teilnahmslos, als schickten sie sich ins Unvermeidliche … Ich blickte über das Tal - lange Linien von Männern, Offiziere bewegten sich mit eingezogenem Kopf vorwärts, wie es die moderne Taktik verlangt, sodass sie eher Bittstellern glichen als der Vorhut einer großen Offensive … Weiß explodierende Schrapnelle tauchten über den Bäumen und spärlich über dem Kamm auf … Ein Inferno von Gewehr- und MG-Feuer setzte ein … Die Linie geriet ins Stocken. Schlaff und still fielen Männer nach vorn. Das Zischen und Krachen der Kugeln erfüllte die Luft und strich über die langen Gräser.«
Hutchison, der mit seinen Männern im Niemandsland festsaß, erblickte verblüfft »eine Schwadron indischer Kavallerie, dunkle Gesichter unter glänzenden Helmen, die durch das Tal auf den Hang zugaloppierten. Keine anderen Soldaten hätten einen ermutigenderen Anblick bieten können als diese Eingeborenen aus Indien mit Lanze und Schwert, die in irrwitziger Kavalkade auf die Hügellinie zuhielten. Ein paar verschwanden hinter ihr: Sie kamen nicht zurück. Auf die anderen richtete sich jedes Geschütz und Gewehr des Feindes.«
Soldaten, die in Vorbereitung eines solchen Angriffs vorverlegt wurden, erblickten die eigene Zukunft in dem schauerlichen Verkehr, der ihnen entgegen kam. »Die Flut der Verwundeten strömte in endlosen Kolonnen von Ambulanzwagen von den Schlachtfeldern an der Somme zurück«, schrieb der Korrespondent Philip Gibbs. »… Reihe um Reihe wurden die Schwerverwundeten auf blutbefleckten Bahren auf das Gras vor den Zelten gelegt, wo sie warteten, bis sie an die Reihe kamen … Wolken von Chloroformdunst wehten über die Straßen.«
In seinen Berichten begann Haig, das Wort »Erfolg« neu zu definieren: »Durchbruch« war gestern; den Deutschen durch einen »Abnützungskampf« Verluste zuzufügen wurde zum neuen Schlagwort. Seine vollmundigen Erfolgsversprechungen stützten sich nun nicht mehr auf die winzigen Gebietsgewinne, sondern auf den Preis an Toten und Verwundeten, der den Deutschen abverlangt wurde - der erste Hinweis auf einen grundlegenden Wandel seiner Rhetorik. Die Abnutzung zum Maßstab des Erfolgs zu machen war angesichts dieses Kriegs sicherlich realistischer, als Gebietsgewinne zu messen, nur hatte es den Nachteil, dass die Verluste der anderen Seite immer unbekannt waren. Das Einzige, was man mit Sicherheit wusste, waren die eigenen entsetzlichen Verluste, sodass nur die Hoffnung blieb, die des Feindes seien mindestens genauso groß. Nach einer Schlacht im August berichtete Haig auf einer höchst spärlichen empirischen Basis nach London, die deutschen Verluste »können nicht geringer als die unseren sein«.
Gelegentlich konnte Haig, durch diese perverse Logik veranlasst, in heftige Wut geraten, wenn er die britischen Verluste - und demzufolge die deutschen - für zu gering hielt. Nach einem Angriff der 49. Division auf den Delville-Wald bei Longueval war er so ärgerlich, dass er in seinem Tagebuch beklagte, dass »der Gesamtverlust dieser Division unter eintausend liegt!« Die Haltung des Oberbefehlshabers prägte die seiner Untergebenen. Am 30. September des folgenden Jahres schrieb General Rawlinson in sein Tagebuch: »Mit Lawford diniert. In blendender Verfassung. In seiner Division 11 000 Verluste seit dem 31. Juli.«
Einige Erzpatrioten unter den Zivilisten teilten Haigs Auffassung, dass hohe Verluste ein Maß des Erfolgs seien. Als die Schlacht an der Somme seit einem Monat tobte, erhielt der General einen Brief von einem anonymen Bewunderer: »Die Hoffnungen der Menschheit ruhen auf Ihnen - 'Hungriger Haig', wie Sie hier bei uns in der Heimat genannt werden. Und wenn Sie von 500 000 Opfern berichten, die Seele des Empire wird sie verschmerzen. Sie werden mit der Kavallerie Englands und Frankreichs durchbrechen und den größten Sieg erringen, den die Geschichte je gesehen hat … Weiter so, ruhmreicher General!«
zu Teil 3
Der Plan, nebeneinander in geordneter Linie vorzurücken, wurde rasch aufgegeben: Die Männer teilten sich in kleine Gruppen auf, die hinter kleinen Hügeln und in Granattrichtern Schutz suchten. Doch ein Rückzug kam für die stark dezimierten britischen Truppen nicht in Frage, denn jedes Bataillon hatte einige Männer als sogenannte »Schlachtpolizisten« eingeteilt, die Nachzügler vorwärts trieben. »Als wir zu den deutschen Drahtverhauen gelangten, sahen wir - nach allem, was man uns vorher erzählt hatte - zu unserer grenzenlosen Verblüffung, dass sie unbeschädigt waren«, erinnerte sich ein britischer Gefreiter. »Der Oberst und ich gingen hinter einer kleinen Böschung in Deckung, doch nach einer Weile erhob sich der Oberst auf Hände und Knie, um besser sehen zu können. Sofort wurde er von einer einzigen Kugel in die Stirn getroffen.« Da die Artillerie nur wenig Stacheldraht zerstört hatte, mussten die britischen Soldaten zusammenrücken, um durch die wenigen Lücken zu gelangen, die zu finden waren - wodurch das Schlachtfeld noch mehr zum Schießstand wurde. Viele Soldaten starben, als sie mit der Kleidung, vor allem die Schotten mit ihren wehenden Kilts, im Draht hängen blieben und dem gegnerischen Feuer preisgegeben waren. »Aus unserer ganzen Kompanie kamen dort nur drei durch«, berichtete ein Gefreiter des 4. Tyneside Scottish Battalion. »Da waren noch mein Leutnant, ein Feldwebel und ich. Die übrigen schien es im Niemandsland erwischt zu haben … Der Offizier sagte: 'Allmächtiger, wo ist der Rest der Jungs?'«
Die vielgepriesene »Feuerwalze«, die die deutschen MG- und Scharfschützen veranlassen sollte, in Deckung zu bleiben, richtete wenig aus. Sie kroch zwar entsprechend dem festgelegten Zeitplan vorwärts - setzte dann aber ihren Weg nutzlos in unbestimmte Ferne fort, während die britischen Soldaten, die ihr eigentlich folgen sollten, schon längst durch die intakten Stacheldrahtverhaue aufgehalten waren. Die Truppen hatten keine Möglichkeit, ihre Artillerie im rückwärtigen Bereich über die Planänderung zu informieren. Vergebens wartete die Kavallerie hinter den britischen Linien. Wer im Niemandsland überlebte, wartete manchmal bis zum Einbruch der Dunkelheit, bevor er in den eigenen Graben zurückkroch, doch selbst dann noch ließ das ständige Streufeuer der deutschen Maschinengewehre Funken aufstieben, wenn die Kugeln den britischen Stacheldraht trafen.
Von den 120 000 britischen Soldaten, die am 1. Juli 1916 in die Schlacht gingen, waren 57 000 tot oder verwundet, bevor der Tag vorüber war - fast zwei Mann Verlust pro Meter Front. 19 000 fielen, die meisten in der katastrophalen ersten Stunde des Angriffs, und weitere 2000 starben schwerverwundet in den Lazaretten. Bei den Deutschen betrugen die geschätzten Verluste 8000 Mann. Wie üblich waren die höchsten Opfer unter den Offizieren - drei Viertel wurden getötet oder verwundet. Viele hatten noch wenige Wochen zuvor das Festbankett für Eton-Absolventen besucht: Mehr als 30 ehemalige Eton-Schüler kamen am 1. Juli ums Leben. Captain Nevill von den East Surreys, der die Fußbälle verteilt hatte, erhielt in den ersten Minuten des Kampfes einen tödlichen Kopfschuss.
Das 1. Newfoundland Regiment, das sich auf seinen Viktoriakreuz-Träger und die junge Frau freute, die sich als Belohnung ausgelobt hatte, wurde praktisch ausgelöscht. Die 752 Männer kletterten aus ihren Gräben, um auf die skelettartigen Überreste eines Obstgartens vorzurücken, und wurden von einem deutschen Maschinengewehr unter Beschuss genommen; am Ende des Tages waren 684 tot, verwundet oder vermisst, darunter alle Offiziere. Die deutschen Truppen, die von den Neufundländern angegriffen wurden, verloren nicht einen einzigen Mann. Nur im äußersten Süden der Angriffszone, auf einem Frontabschnitt von rund 5 Kilometern, konnten die Briten einen nennenswerten Gebietsgewinn verzeichnen - rund anderthalb Kilometer. Es waren die blutigsten 24 Stunden, die irgendeine Armee in diesem Krieg erlitt.
Die angreifenden Soldaten hatten den Befehl bekommen, sich nicht um verwundete Kameraden zu kümmern, sondern sie den Bahrenträgern zu überlassen, die folgen würden. Zu den Toten und Verwundeten gehörten jedoch auch viele hundert Bahrenträger, nirgendwo gab es genügend Männer, um die Schwerverwundeten rechtzeitig zu Verbandsplätzen zu schaffen. Die Bahren gingen aus; einige Verwundete wurden zu zweit auf einer Bahre oder auf Wellblechen getragen, deren Ränder den Trägern die Finger aufrissen. Viele Verwundete, die den ersten Tag überlebten, blieben auf dem Schlachtfeld. Wochen später fanden ihre Kameraden sie in Granattrichtern, in denen sie kriechend Schutz gesucht, ihre Bibel herausgenommen und sich in ihre wasserdichte Zeltplane gewickelt hatten, um allein und in Schmerzen zu sterben.
Auch auf andere Weise forderte der schreckliche Tag noch im Nachhinein Opfer. Der Bataillonskommandeur Oberstleutnant E. T. F. Sandys, der an diesem Tag erleben musste, wie mehr als 500 seiner Männer fielen oder verwundet wurden, erschoss sich zwei Monate später in einem Londoner Hotelzimmer, nachdem er an einen Offizierskameraden geschrieben hatte: »Seit dem 1. Juli habe ich nicht mehr einen Augenblick lang meinen Frieden gefunden.«
Am zweiten Tag der Schlacht erhielt Haig die Mitteilung, dass die Verluste bislang mehr als 40 000 betrügen - eine starke Untertreibung, obwohl immer noch eine entsetzliche Zahl. »Das ist nicht als schwerer Verlust anzusehen«, schrieb er in sein Tagebuch, »bedenkt man die Zahl der Beteiligten und die Länge der angegriffenen Front.«
Im Fortgang der Kämpfe blieben die Gewinne minimal: eine halber Kilometer hier, ein paar hundert Meter dort, und an einigen Stellen kein Zentimeter. Aber das tat Haigs Optimismus keinen Abbruch. Als das Blutbad schon eine Woche andauerte, schrieb er an seine Frau: »Noch vierzehn Tage, und hoffe mit Gottes Hilfe, einige entscheidende Ergebnisse zu erzielen.« Einige Tage später teilte er ihr mit: »Wenn wir dieses Mal keinen Erfolg haben, wird er uns das nächste Mal zuteil werden !«
Sogar heute noch vertreten Haigs Fürsprecher die Ansicht, die Schlacht an der Somme habe ihre eigentliche Aufgabe erfüllt, indem sie bei Verdun den Druck auf die Franzosen milderte, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmte. Aber die Deutschen hatten bereits eine Woche vor Beginn der Somme-Offensive bei einem Entscheidungsangriff, der kläglich gescheitert war, jede Hoffnung auf Eroberung der Festung begraben müssen - wobei sie weitgehend die gleichen bitteren Erfahrungen machten wie die Briten: In diesem Krieg waren die Verteidiger gegenüber den Angreifern stets im Vorteil. Obwohl sich also die Gefahr bei Verdun verringert hatte, gab Haig stur und unnachgiebig immer neue Befehle zum Angriff an der Somme aus - unglaubliche viereinhalb Monate lang.
Die beste Waffe der Deutschen blieb der Stacheldraht. Jede Woche beförderten sie 7000 Tonnen davon an die Front, in langen Rollen, in zwei Lagen auf Güterwagen gestapelt. Beide Seiten verwendeten sehr wirksame neue Drahtsorten, die teilweise alle zwei bis fünf Zentimeter geschärfte Stacheln besaßen. Angesichts solcher Hindernisse waren die britischen Soldaten nicht mehr in der Stimmung, Fußbälle zu treten. Unter den Soldaten, die neu in die Schlacht geworfen wurden, »waren wenige, in deren Verhalten sich große Bereitschaft zum Kampf ausdrückte«, schrieb Graham Seton Hutchison, ein Kompaniechef. »Sie gingen sehr diszipliniert in Stellung, wirkten aber teilnahmslos, als schickten sie sich ins Unvermeidliche … Ich blickte über das Tal - lange Linien von Männern, Offiziere bewegten sich mit eingezogenem Kopf vorwärts, wie es die moderne Taktik verlangt, sodass sie eher Bittstellern glichen als der Vorhut einer großen Offensive … Weiß explodierende Schrapnelle tauchten über den Bäumen und spärlich über dem Kamm auf … Ein Inferno von Gewehr- und MG-Feuer setzte ein … Die Linie geriet ins Stocken. Schlaff und still fielen Männer nach vorn. Das Zischen und Krachen der Kugeln erfüllte die Luft und strich über die langen Gräser.«
Hutchison, der mit seinen Männern im Niemandsland festsaß, erblickte verblüfft »eine Schwadron indischer Kavallerie, dunkle Gesichter unter glänzenden Helmen, die durch das Tal auf den Hang zugaloppierten. Keine anderen Soldaten hätten einen ermutigenderen Anblick bieten können als diese Eingeborenen aus Indien mit Lanze und Schwert, die in irrwitziger Kavalkade auf die Hügellinie zuhielten. Ein paar verschwanden hinter ihr: Sie kamen nicht zurück. Auf die anderen richtete sich jedes Geschütz und Gewehr des Feindes.«
Soldaten, die in Vorbereitung eines solchen Angriffs vorverlegt wurden, erblickten die eigene Zukunft in dem schauerlichen Verkehr, der ihnen entgegen kam. »Die Flut der Verwundeten strömte in endlosen Kolonnen von Ambulanzwagen von den Schlachtfeldern an der Somme zurück«, schrieb der Korrespondent Philip Gibbs. »… Reihe um Reihe wurden die Schwerverwundeten auf blutbefleckten Bahren auf das Gras vor den Zelten gelegt, wo sie warteten, bis sie an die Reihe kamen … Wolken von Chloroformdunst wehten über die Straßen.«
In seinen Berichten begann Haig, das Wort »Erfolg« neu zu definieren: »Durchbruch« war gestern; den Deutschen durch einen »Abnützungskampf« Verluste zuzufügen wurde zum neuen Schlagwort. Seine vollmundigen Erfolgsversprechungen stützten sich nun nicht mehr auf die winzigen Gebietsgewinne, sondern auf den Preis an Toten und Verwundeten, der den Deutschen abverlangt wurde - der erste Hinweis auf einen grundlegenden Wandel seiner Rhetorik. Die Abnutzung zum Maßstab des Erfolgs zu machen war angesichts dieses Kriegs sicherlich realistischer, als Gebietsgewinne zu messen, nur hatte es den Nachteil, dass die Verluste der anderen Seite immer unbekannt waren. Das Einzige, was man mit Sicherheit wusste, waren die eigenen entsetzlichen Verluste, sodass nur die Hoffnung blieb, die des Feindes seien mindestens genauso groß. Nach einer Schlacht im August berichtete Haig auf einer höchst spärlichen empirischen Basis nach London, die deutschen Verluste »können nicht geringer als die unseren sein«.
Gelegentlich konnte Haig, durch diese perverse Logik veranlasst, in heftige Wut geraten, wenn er die britischen Verluste - und demzufolge die deutschen - für zu gering hielt. Nach einem Angriff der 49. Division auf den Delville-Wald bei Longueval war er so ärgerlich, dass er in seinem Tagebuch beklagte, dass »der Gesamtverlust dieser Division unter eintausend liegt!« Die Haltung des Oberbefehlshabers prägte die seiner Untergebenen. Am 30. September des folgenden Jahres schrieb General Rawlinson in sein Tagebuch: »Mit Lawford diniert. In blendender Verfassung. In seiner Division 11 000 Verluste seit dem 31. Juli.«
Einige Erzpatrioten unter den Zivilisten teilten Haigs Auffassung, dass hohe Verluste ein Maß des Erfolgs seien. Als die Schlacht an der Somme seit einem Monat tobte, erhielt der General einen Brief von einem anonymen Bewunderer: »Die Hoffnungen der Menschheit ruhen auf Ihnen - 'Hungriger Haig', wie Sie hier bei uns in der Heimat genannt werden. Und wenn Sie von 500 000 Opfern berichten, die Seele des Empire wird sie verschmerzen. Sie werden mit der Kavallerie Englands und Frankreichs durchbrechen und den größten Sieg erringen, den die Geschichte je gesehen hat … Weiter so, ruhmreicher General!«
zu Teil 3
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Miranda July: Auf allen vieren
Miranda July: Auf allen vieren Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung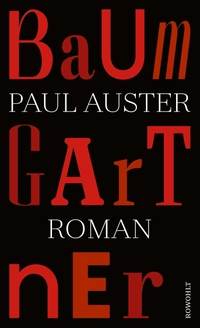 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner