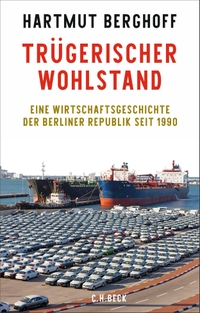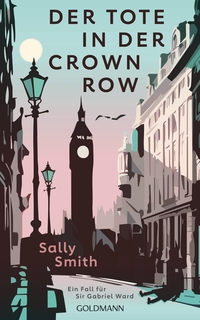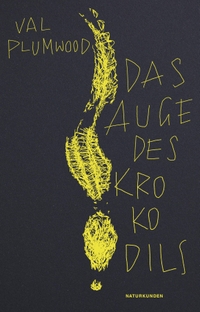Im Kino
Auch Paris ist vor Ort
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer
17.08.2011. Nach Paris, zwanziger Jahre, Nostalgie und Boheme geht das Begehren von Woody Allens wie stets starbestückter Fantasie "Midnight in Paris". Eine Deklination alltäglicherer und gegenwartsnäherer Liebes(un)fälle unternimmt die Komödie "Crazy, Stupid, Love".
Paris, Gegenwart. Ein kalifornisches Paar mit divergierenden Interessen. Der Mann hadert mit seinem Job als Drehbuchautor in Hollywood und schreibt an einem Roman, die Frau geht shoppen. Auch ihre Eltern sind da, der Vater ist ein Tea-Party-Fan. Auch Paris ist vor Ort. Gleich zu Beginn eine Serie von Postkartenbildern, mit denen Woody Allen ausdrücklich sagt, dass es ins Klischee geht und nirgend anderswohin.
Klischee, Gegenwart. Das ganze Allensche Middlebrow-Arsenal ist versammelt. Der Möchtegern-Künstler in einer Welt des Unverstands, die verkörpert wird durch die aus keinen sichtbar werdenden Gründen anverlobte Blondine. Der besserwissende andere Mann, satirisch gezeichnet. Hier heißt er Paul, kennt sich mit allen Dingen der Kunst von Rodin bis Versailles und Picasso hervorragend aus, lässt es die Welt wissen und bekommt vom Drehbuchverfasser jedes Mal einen Stich in den Rücken, der seine belehrende Rede mit lächerlichen Unsicherheitsfloskeln aufs enervierendste schmückt. Das Antiintellektuelle ist ein bei Allen ja gern mal übersehener Zug.

Owen Wilson ist Gil und gibt den üblichen Allen-Standin auf deutlich unübliche Art. Was daran liegt, dass Wilson, wie so ganz anders auch Allen, kein Schauspieler ist, sondern in jeder Rolle so ziemlich derselbe. Immer ein wenig in Verzug im Verstehen der Welt. Verletzlich. Sprechend in gaumig-herauskauendem Singsang. (Er gehört zu den Schauspielern, die man gar nicht synchronisieren kann. Wie er spricht, ist so zentral für das, was er darstellt.) Ein Westküsten-Timelag. Dieser Amerikaner nun also in Paris. Sein unfertiger Roman handelt von einem Nostalgie-Shop. Paris selbst wiederum sieht er mit den sehr nostalgischen Augen dann doch eher eines Ostküsten-Amerikaners. Das Goldene Zeitalter, die zwanziger Jahre, Pablo Picasso und Man Ray und Gertrude Stein und Ernest Hemingway und so fort.

Schlag zwölf geht dann unversehens die Tür auf. Ein Wagen rauscht heran und bringt den Westküstenmann ins Land seiner Träume. Das Goldene Zeitalter, die zwanziger Jahre, Pablo Picasso und Man Ray und Gertrude Stein und Ernest Hemingway und so fort. Ohne viel Drumrum öffnet Woody Allen dieses Portal in Richtung Kostümfilm und führt in den Kostümfilm seinen, naja, Gegenwartsmenschen hinein. Der staunt den einen oder anderen Bauklotz und wir staunen, wenn's nach der Regie geht, Bauklötze mit. Interessantes passiert eigentlich nicht. Ein bisschen Liebe mit Marion Cotillard. Die Goldenes-Zeitalter-Amerikaner sind rundheraus so, wie man sich das ungefähr vorstellt. Immerzu werden sie dem geneigten Betrachter auf Silbertabletten serviert und Gil mischt bald munter mit. Seine nicht enden wollende, aber nach einer Extratour durch die Belle Epoque doch endend müssende kindliche Freude ist eine Weile ganz reizend, dann ermüdet sie doch. Zum Glück hat das Drehbuch rechtzeitig eine passende Happyendsperson (Nostalgieshopverkäuferin und Cole-Porter-Liebhaberin) als Alternative zur epochenmäßig nicht passenden Adriana und zur shoppingverrückten Inez eingebaut.
Der Film als ganzes ist, wohin man auch blickt, bei aller Sanftheit reaktionär. Übrigens auch nicht sonderlich komisch, Allen spielt das mit nur gelegentlich eingerückten Pointen in aller Langweiligkeit ziemlich straight. Wolf Lepenies, der "Midnight in Paris" aus schwer erfindlichen Gründen für beinahe ein Meisterwerk hält, vergleicht ihn mit der Kugelmass-Geschichte des viel jüngeren Woody Allen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Beim frühen Allen hat jeder einzelne Satz eine absurde Pointe. Hier trabt nur sehr gelegentlich ein Rhinozeros von Salvadore Dali vorbei. Das bisschen Nostalgie-Metadiskurs, das Allen gelegentlich draufschraubt, sieht draufgeschraubt aus. In Wahrheit ist "Midnight in Paris" ein reines Nostalgiestück, ein recht lahmes dazu. Ein Regisseur, der sich schon lang nicht mehr für die Gegenwart interessiert - und ja sowieso immer nur an sehr speziellen Ausschnitten aus ihr interessiert war -, gibt hier den Restverstand dran und träumt sich in eine Vergangenheit, an der auch nichts stimmt, auf und davon.
***

Crazy, Stupid, Love: Alles andere als Fragmente einer Sprache der Liebe, vielmehr eine komplette Deklination. Gehen wir's durch. Der Mann, den seine Frau mit dem Kollegen betrügt. Dessen Sohn, der das Kindermädchen unglücklich liebt. Das Kindermädchen, das wiederum den Vater verehrt. Der Schönling, der mit einer obstinaten Juristin lange kein Glück hat. Die obstinate Juristin, die einen Ehemann will und keinen Kollegen. Die Lehrerin, die mit dem Vater schläft und ihn in der Elternsprechstunde vor dessen Noch-Ehefrau attackiert. Die Noch-Ehefrau, die eigentlich gerne den Ehemann wiederhätte. Der Ehemann, der sich mit Hilfe des Schönlings zum Womanizer entwickelt. Ein Ringelreihen der nicht immer durchsichtigen Freundschafts- und Verwandtschaftsverhältnisse. Als Komödie gespielt. Bombastisch besetzt: Steve Carrell, Julianne Moore, Ryan Gosling, Emma Stone, Kevin Bacon. Durchaus ganz nett. Vom aktuellen Komödienniveau der Apatowschule dann aber doch mehr als ein Stückchen entfernt.
Fragt sich: Wie kommt's? Zum Beispiel, weil sich jede der Figuren im Typus erschöpft. Weshalb auch der Wechsel vom einen Typus zum andern - der treueste aller Ehemänner, der über alberne Zwischenschritte zum Sex-Maniac wird - nur dank Komödienlizenz plausibel ist, im weiteren Sinn. Es entwickelt sich nichts. Man gelangt einzig im Sprung und in oft sehr einfallslos abrupten Schnitten, manchmal aber auch in etwas seltsamen Kamerafahrten von unter Tischen nach oben oder von oben nach irgendwie unten von Verblendung zu wahrer Erkenntnis. Die Juristin lehrt uns einsehen, dass im Schönling ein empfindsamer Mann steckt. Der treue Ehemann erkennt, dass er wirklich ein treuer Ehemann ist. Der Jüngling sieht ein, wie unüberbrückbar mit dreizehn vier Jahre zur angehimmelten Frau sind. Am Ende haben alle alles erkannt und es herrscht Frieden, als wär' nichts gewesen.

Was so im Großen schematisch bleibt, funktioniert dann auch im Detail nur bedingt. Cal - das ist der von Carrell gespielte Ehemann auf Onenightstandsfüßen - ist erst sturer, dann trotteliger, dann erfolgreicher, dann versöhnter als die Polizei erlaubt. Jacob - das ist der von Ryan Gosling gespielte Schönling - sieht man von Anfang an an, was er ist, und was nicht. Vielfach bemerkt wurde, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Das ist richtig und zugleich fragt man sich, warum die Deklination der verrücktdummen Liebe so ganz und gar weiß und hetero ausfällt. Gut situiert ist überdies jeder, im Buchhalterjob oder als - ja, was macht eigentlich Jacob mit seiner schicken Swimmingpoolvilla beruflich? Keine der Nöte, die die Leute hier plagen, ist echt. Und wo also von Anfang an nichts auf dem Spiel steht, kommt an ernst gemeintem Investment in Figuren und ihre Schicksale auch nicht viel rum. Es gibt hübsche Momente, gewiss. In den fast zwei Stunden, die der Film dauert, ohne zwischen Komödienmechanik und wahreren Werten je zu seinem Rhythmus zu finden, wird einem die Zeit dann aber oft doch recht lang.
Ekkehard Knörer
Midnight in Paris. Spanien / USA 2011 - Regie: Woody Allen - Darsteller: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Marion Cotillard, Lea Seydoux, Michael Sheen, Carla Bruni
Crazy, Stupid, Love. USA 2011 - Regie: Glenn Ficarra, John Requa - Darsteller: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei, John Carroll Lynch, Kevin Bacon, Analeigh Tipton
Kommentieren