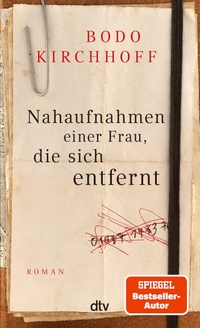Im Kino
Krisen lassen sich meistern
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh
07.10.2015. Ridley Scotts "Der Marsianer" ist ein Blockbuster ohne eindeutige Heldenfiguren, aber mit Menschen, die anpacken. In "The Tribe" beschreibt Miroslav Slaboshpytskiy die gemeinschaftliche Einschwörung auf die Horde in einem Internat für Gehörlose.
Watney (Matt Damon), der Botaniker einer Mars-Expedition, wird bei einem überraschenden Sandsturm vom Rest der Crew getrennt, für tot erklärt und zurückgelassen, weshalb er sich nun, ohne Funkverbindung, damit konfrontiert sieht, die Zeit bis zur nächsten Mars-Mission vier Jahre später überbrücken zu müssen - mit Proviant für etwa ein Jahr. Andy Weirs erst im Selbstverlag erschienener, dann von den traditionellen Verlagen weltweit rasch ins Sortiment aufgenommener Überraschungsbestseller "Der Marsianer" ist so etwas wie der Roman zur Stunde: Vordergründig eine Robinsonade, ist "Der Marsianer" ein Buch über das Individuum im Zeitalter des "quantified self", des ewigen Selbsttrackings, Kalorienzählens und der steten Übersetzung des eigenen Verhaltens und Handelns in Zahlen.
Das ist ganz und gar nicht ohne Reiz: Über weite Strecken in der Ich-Perspektive von Logbucheinträgen geschrieben, erleben wir minutiös - und wissenschaftlich wohl weitgehend abgesichert -, wie ein Mensch sich an den eigenen Haaren (bzw. mittels der eigenen Exkremente, irgendwoher muss der Dünger ja herkommen) aus dem Sumpf (bzw. der brachial trockenen Einöde des roten Nachbarplaneten) zieht, mit zwar überschaubarem, aber umso beherzterem Terraforming Kartoffeln pflanzt und sich beinahe in die Luft jagt, während er seinen Rover mit Plutonium auf Vordermann bringt; sich außerdem die Zeit gezwungenermaßen mit 70s Disco und 70s TV-Serien vertreibt und schließlich tatsächlich eine unorthodoxe Art der Kommunikation mit der Erde entwickelt.
Im Weltall hört dich keiner säen: Ridley Scott hat aus dem Stoff gerade keinen Film über die gähnende, bedrohliche Leere des Alls gedreht. Den hatte er 1979 schon mit "Alien" vorgelegt, einem Film, der elf Jahre nach Kubricks Weltall-Odyssee und zehn Jahre nach "Apollo 11" jeglichem "Auf ins All"-Enthusiasmus einen gehörigen Dämpfer verpasst hatte. Dass Science Fiction im Kino seitdem meist mit "Space Opera" übersetzt wurde und Fantasien vom konkreten Schritt der Menschheit ins All sich zuletzt oft auf melancholische Heimkehrer-Geschichten beschränkten (wie etwa Duncan Jones" "Moon", William Eubanks "Love", Alfonso Cuaróns "Gravity" und in mancher Hinsicht auch Christopher Nolans "Interstellar"), sagt viel aus über den Verlust an utopischem Potenzial der Science Fiction: Das All ist entweder der Schauplatz für Fantasy, die Magie in Technik übersetzt, oder ein Ort, aus dem man besser schnell wieder nach Hause zurückkehrt. Beide Vorstellungen werden, zumindest in astronomischen Maßstäben betrachtet, ein Problem, wenn in unserem Sonnensystem eines fernen Tages das Licht ausgeknipst wird.
Ridley Scotts "Der Marsianer" ist nun, getreu der Vorlage, eine interessante Abweichung. Zwar handelt es sich ebenfalls um eine Heimkehrer-Geschichte, doch weder um eine melancholische, noch um eine romantisch verklärte: Der von Matt Damon gespielte Mark Watney ist eine von tieferen Reflektionen weitgehend unbeleckte Frohnatur, ein zwar sanft angenerdeter, im wesentlichen aber hemdsärmerliger Wissenschaftler-Typus, der sich seiner zunächst aussichtslosen Situation einerseits voll bewusst ist ("I"m pretty much fucked", lautet der erste Satz im Roman), ihr aber dennoch mit kühl wissenschaftlichem Blick begegnet, als sei die Frage nach dem Überleben einige Millionen Kilometer weit weg von zu Hause die Sache eines Rätsels, bei dessen Lösung sich unvermeidbare Rückschläge fast immer in sarkastische Galgenhumor-Sprüche übersetzen lassen.

Was dabei entsteht, ist ein fast schon altmodischer, aber gelungener Abenteuer-Unterhaltungsfilm, der die im Roman gut funktionierende, von allerlei Kalorien- und Bakterienkalkulationen unterfütterte Agrikulturisierungsgeschichte gut genug beschrieben, um sie als faszinierende Survival-Weltaneignung im Kleinen zu betrachten. Dabei erschöpft sich "Der Marsianer" aber nicht "unfilmisch" im Erbsenzählen, sondern setzt im Medienwechsel gerade auf die Stärken audiovisuellen Erzählens (zu denen auch die Weglassung zählt: "7 Monate später", heißt es an einer Stelle lapidar). Im Buch ist das schon angelegt, in den Passagen der dritten Person etwa, wenn von der Erde aus Watneys Rettung organisiert wird: Für den Tonfall, das Timing und den Humor filmischer Blockbuster über Profis in Profi-Situationen hat Weir zwar ein exzellentes Gespür, doch sind diese Passagen die auch literarisch schwächsten, gerade weil sie sich so sehr als Drehbuch für einen Film verstehen. Scott wiederum übersetzt das in einen guten audivosuellen Flow: Endlich wieder ein Blockbuster, in dem nicht die ganze Welt gerettet und zu diesem Zweck ganze Städte auseinander gelegt werden - endlich geht es wieder um eine Situation, eine Herausforderung und Leute, die anpacken.
Auch politisch ist das von Reiz: Anders als der populäre Superheldenfilm, in dem die Rettung der Welt an ein Ensemble übermenschlicher Heilsfiguren delegiert wird (was man durchaus faschistisch finden kann), setzt "Der Marsianer" wie lange kein Krisen-Blockbuster mehr auf Kollaboration: Watney mag sein Überleben organisieren (wenngleich auch zusehends bloß durch Verstetigung der eigenen Existenz), aber er bewerkstelligt eben nicht seine eigene Rettung. Was auch der NASA nicht alleine gelingt und auch nicht der Missions-Crew, die sich auf dem mehrmonatigen Rückflug vom Mars zur Erde befindet und auf halber Strecke eine Entscheidung treffen muss. Vielmehr verzahnen sich diverse Kräfte: Hier USA, dort China, oben im All Watney und nicht allzu weit weg davon die Crew. Eindeutige Helden- oder Heldinnenfiguren gibt es nicht.
Auch wenn der "Marsianer" ein weiterer Heimkehrerfilm ist, birgt er damit doch ein utopisches Potenzial. Nicht nur, weil er sich wie kaum ein zweiter Blockbuster auf erfrischende Weise ganz auf Wissenschaft und analytisches Denken einlässt - die vom eher ressentimentgeladenen Emotionskino und Ganzheitlichkeits-Kitschnudeln in Sichtweite zu Esoterik, Homöopathie oder neuer Religiosität gerne abgetan wird (freilich eine ideologische Blindstelle: schließlich entspringen gerade Fotografie und Kino wie bis dahin keine zweite Form ästhetischer Massenproduktion direkt der naturwissenschaftlichen Forschung) -, sondern auch in seiner Betonung menschlicher Zusammenarbeit. Krisen lassen sich meistern - ein klarer Blick bringt mehr als die Lust am eigenen Untergang. Ein hoffnungsvoller Film zur Zeit.
Der Marsianer - USA 2015 - Originaltitel: The Martian - Regie: Ridley Scott - Darsteller: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Sean Bean - Laufzeit: 141 Minuten.
Thomas Groh
---

Körperkino. Ein Begriff, der üblicherweise einen Distanzverlust markiert: Der Körper auf der Leinwand als Spektakel, als Schauplatz ungeahnter Einwirkungen und Kräfte, was wiederum die Körper im Publikum affiziert. Doch Myroslav Slaboshpytskiys "The Tribe", zweifellos ein Körperkino-Film, schert aus: In dieser Geschichte um eine vernachlässigte Meute gehörloser Internatsschüler, die in einer verwahrlosten Sphäre weit jenseits von Rechtsstaatlichkeit und funktionierender Zivilgesellschaft erst Passanten ausrauben, dann ihre Freundinnen auf den Strich zwingen und sich nach Innen durch einen rigorosen Unterwerfungscodex auszeichnen, ist der Körper nicht nur aus Kommunikationsgründen expressiver in Szene gesetzt als in anderen sozialen Milieus oder eben Filmen - auch die Figuren sind geradezu auf diesen Körper reduziert. Er ist nicht nur das Mittel und Ort des primären Erlebens sozialer Interaktion, vielmehr scheint die ganze Welt allein um ihn herum zusammenzuschnurren.

Auch deshalb gibt es kaum so etwas wie Privatheit und Zurückgezogenheit in dieser Erzählwelt aus Internatsgängen, Gruppenzimmern, endlosen LKW-Parkplätzen, wo man den Truckern nachts die Mädchen andient. Als sich einer der Jungs in ein Mädchen aus der Clique verliebt, findet der erste, mechanisch-leidenschaftslose Sex in einem trüben Heizungskeller als offenbar letztem Rückzugsort statt. Der Rest ist existenziell: Die Grenze zwischen wild gestikuliertem Dialog und gewalttätigem Übergriff ist nicht immer auszumachen, wenn die Kids in Rage geraten. Daneben ziehen sie sich aus und an, prügeln sich und lungern raumgreifend herum. Körper, die sich in der Aktion ihres Daseins versichern. Jenseits-Orte gibt es kaum: Italien taucht einmal für einen kurzen Moment als utopischer Fluchtpunkt auf - aber auch nur weil die Mädchen gewinnbringend dorthin verkauft werden sollen.
Andererseits ist das kein übergriffig-affizierendes Kino. Die Kamera (Valentyn Vasyanovych) ist gefangen zwischen starrem Tableau in der Totalen (man darf und soll wohl auch an Ulrich Seidl denken - ein ästhetischer Verwandter im deutschen Gegenwartskino wäre Jan Soldat) und geschmeidigen, neugierig-folgsamen Bewegungen, sobald die Figuren in Gang kommen. Wobei auch hier die Distanz strikt gewahrt bleibt: Selten, dass man die Leute im Anschnitt sieht. Die Kamera hält Abstand, ermöglicht einen Reflexionsraum, der nötig ist, um ein Verhältnis zu entwickeln. Einen frei wandernden Blick ermöglicht das gerade nicht: "The Tribe" fordert ein punktuelles Sehen, da das Ohr für die Dialogebene nicht einfach mitlaufen kann, sondern sich dieser ebenso visuell vermittelt. Untertitel, Voice-Over oder ähnliche Einschübe gibt es keine - Gesten, die man nicht gesehen hat, sind fürs Verständnis des Films verloren.
Nicht, dass "The Tribe" ein Stummfilm wäre. Schon im ersten Bild, eine Situation im Straßenverkehr, ist der Atmo-Ton fast schmerzhaft deutlich präsent. Auch im Folgenden bilden der quietschende Laminatboden, die Luftschläge bei den dialogischen oder auch Drohgebärden, das wütende Hauchen der Figuren und das reibende Knarzen der Kleidung eine sehr eigene klangliche, haptische Textur. Vielleicht ist das auch nur der Effekt, der gerne dem Sinnverlust nachgesagt wird: Geht ein Sinn verloren, verstärkt sich dafür ein anderer. Wo Stimme und Sprache als Ausdrucksmittel fehlen, erregt das Geräusch umso mehr Aufmerksamkeit.

All dies ergibt eine einzigartige Fremderfahrung, die sicherlich zuweilen etwas marktschreierisch vermittelt wird - "The Tribe" hat als "The Gehörlosen-Film to see" seit seiner Uraufführung in Cannes 2014 einen beeindruckenden Festivalbuzz um sich generiert -, im wesentlichen aber intakt bleibt. Dass Slaboshpytskiy kein pädagogisches Projekt im Sinn hat, kommt dem zupass: Weder geht es dem Regisseur um fad sozialpädagogische "Heute mal in die Haut eines anderen schlüpfen und die Welt ganz anders erleben"-Folklore, noch schert er sich in irgendeiner Hinsicht darum, die Alltagsprobleme von Gehörlosen aufklärerisch in Szene zu setzen. Schon gar nicht geht es um Behinderten-Kitsch der Marke "Forrest Gump", der Menschen mit Handicap das berühmte Herz aus Gold attestiert. Trotz seiner inszenatorischen Ruhe entwickelt "The Tribe" vielmehr einiges an Wucht: Er erzählt von einer individuellen Verrohung in jenen wirtschaftlich peripheren Nischen, in denen gesellschaftliche Zivilisierung porös geworden ist und durch eine gemeinschaftliche Einschwörung auf die Horde ersetzt wird - eine quasi-postapokalyptische Geschichte der Entindividuierung, vom Einzelnen zum Stamm.
Thomas Groh
The Tribe - Ukraine 2014 - Originaltitel: Plemya - Regie: Miroslav Slaboshpitsky - Darsteller: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich, Yaroslav Biletskiy - Laufzeit: 126 Minuten.
The Tribe ist diesen Samstag auf dem Filmfest Osnabrück zu sehen. Der deutschlandweite Kinostart beginnt nächste Woche.
Kommentieren