Eine Familie mit zwei Kindern kommt herein, in einem umständlichen Gemenge, als wären es viel mehr als nur vier Personen, schieben sie sich durch den Eingang, dabei leise, vollkommen wortlos. Das eine Kind, noch fast ein Baby, wird von der Mutter auf dem Arm getragen, das andere geht an der Hand des Vaters, wir haben ein Zimmer reserviert, sagt er, mit Zusatzaufbettung für die Kinder. Ich sehe auf der Zimmerbelegungsliste im Computer nach, es wohnen nur drei weitere Gäste im Hotel. Ich lasse mir vom Mann den Personalausweis zeigen, trage auf einem Anmeldeformular die Ausweisnummer ein und schiebe es über den Tresen, damit er die persönlichen Angaben einträgt, Straße, Wohnort, Telefonnummer. Das Kind, ein Mädchen, sieht mich von unten her an, ihr macht wohl Urlaub, frage ich, was soll ich anderes fragen. Nicht Urlaub, sagt das Kind, sondern Ferien, wir haben Ferien, und ich bin schon fünf Jahre alt. Es zeigt mit einer Hand die Zahl fünf, und sagt immer wieder: fünf bin ich, fünf, fünf, es fängt neben dem das Formular ausfüllenden Vater zu hüpfen und zu singen an, fünf, fünf, und ich werde von dieser Begeisterung über das Alter oder über die Zahl fünf mitgerissen, plötzlich weiß ich wieder ganz genau, wie es als Kind gewesen ist: Ich dachte, daß nur ich auf der Welt, niemand sonst, gerade fünf oder sechs Jahre alt sei, und ich wollte es nie so recht glauben, daß es im Kindergarten andere gab, die im gleichen Alter waren. Ich suche auf dem Schlüsselbrett den Schlüssel von Zimmer fünf. Er ist nicht da, das Zimmer ist vergeben, ich nehme die Fünfundzwanzig. Sieh mal, sage ich, ihr bekommt das Zimmer fünfundzwanzig. Obwohl ich die Silbe ›fünf‹ extra betont habe, schaut das Kind verständnislos drein und macht einen kleinen Mund. Mit dem Hopsen und dem Singen hat es aufgehört, es verharrt, sagt nichts mehr, bereut womöglich, etwas gesagt zu haben. Die Frau mit dem Kleinkind im Arm sitzt auf einem Sessel unter dem Fenster, als ob sie gar nicht zu dem Mann und dem Mädchen gehörte, als ob sie und das Baby eine eigene Familie bildeten. Wenn nur die Strecke nicht so schlecht ausgeschildert wäre, sagt sie, immer diese mangelhaften Ausschilderungen auf den Straßen. Sie scheint es zu ihrem Mann gesagt zu haben, nicht zu mir, aber es ist nicht herauszuhören gewesen, ob es eine Anklage, ein Jammern oder nur eine sachliche Feststellung sein sollte. Ich weiß gar nicht, wie die Straßen ausgeschildert sind, ich habe darüber noch nie nachgedacht, und ich habe diesen Satz auch noch nie zuvor von jemandem ausgesprochen gehört: diese schlechten Ausschilderungen auf den Straßen. Ich könnte ihn höchstens einmal in der Tageszeitung gelesen haben, in einem Bericht über die Verkehrswege in den Alpen, aber ausgesprochen? Der Mann nimmt den Schlüssel entgegen, wobei er lächelt. Er hat womöglich den Satz seiner Frau schon den ganzen Tag lang gehört, während der Fahrt über die Autobahnen und die Bundesstraßen, oder ihn aber, wie ich, noch nie gehört, noch nie aus dem Mund eines anderen als Lautkette vernommen. Habe ich einmal etwas Vergleichbares zu Raimund gesagt, einen vollkommen ungewöhnlichen Satz ihm gegenüber ausgesprochen? Als ich von meiner Mutter einen antiken Küchentisch geschenkt bekommen habe, ausziehbar, aus Eiche, mit geschwungenen Beinen, habe ich abends mit Raimund im Wohnzimmer gesessen, durch die geöffnete Küchentür zum Tisch hinübergeschaut und gesagt: Der Tisch gibt der Küche Würde, und tatsächlich hat Raimund gelacht, mich sogar umarmt nur wegen dieses Satzes. Gerade heute Abend hätte ich Raimund gegenüber gern einen Satz ausgesprochen, der womöglich nicht einmal aus grammatikalischen Entwicklungen heraus entstanden wäre, eine Art Nullsatz oder Nichtsatz, der trotzdem eine nachhaltige Wirkung zeigte. Die Frau steht auf, das Baby auf dem Arm, und folgt dem Mann und der Tochter. Hintereinander gehen sie durch die Tür zum Treppenhaus, schieben sich in ihrem lautlosen Durcheinander aus dem Raum. Das Gepäck hole ich, wenn die Kinder im Bett sind, sagt der Mann zu seiner Frau.
Wenn es wirklich einen Satz gäbe, der auf alles zutrifft. Wenn es nur einen Satz gäbe, einen einzigen Satz, der alle weiteren Sätze enthält und neben den wenigen als gesichert geltenden Annahmen, die wir zu Hause in unseren Schatullen und Nachtschränkchen aufbewahren, auch die völlig ins Kraut schießenden Spekulationen ohne große Worte mit einschließt, der z.B. den Wust aus Kabeln auf der Rückseite des Computers in meinem Schlafzimmer nicht erklären kann, nicht von diesem Kabelverhau spricht, der aber, ausgesprochen, in jeder Sekunde den Kabelverhau des Computers meint, natürlich meint er den Kabelverhau, spricht ohne die notwendigen Worte von den Kabeln bis in die letzten Windungen der Kabel, der Satz handelt immer auch vom Kabelverhau und gleichzeitig von allem anderen, der Satz spricht von mir, von Raimund, vom Auszug aus den Häusern, vom den Häusern entgegengebrachten Gefühl, von meinem Vater und seinem dem Satz entgegengebrachten Gefühl, vom Einverleiben eines Satzes, aber er meint damit etwas, was über all das hinausgehen wird, und was im und mit dem Satz erst dann ausgesprochen werden kann, wenn die ungesicherten, wuchernden Kleinigkeiten, die unscharfen Bilder in diesen Satz umgewandelt worden sind, in eine unauffällige Folge aus Worten, aber das ist ja ganz unmöglich, habe ich einmal zu Raimund gesagt.
Und so sitze ich vor dem Hotelcomputer, der Bildschirm wirft sein Licht voraus auf etwas, das gesagt werden könnte. Es ist unmöglich, alles der Reihe nach auszusprechen. Wie die verschlungenen Kabel auf der Rückseite des Computers, die man nicht mehr auseinanderhalten kann, die sich von einem Kabelverhau in den nächsten fortzusetzen scheinen, enthalten die Sätze immer schon die anderen Sätze und bilden die anderen Sätze, wachsen in die anderen Sätze hinein, man kann nur versuchen, ein Bild davon zu geben, von den Verkleinerungen, Vergrößerungen, vom Makroskopischen im Mikroskopischen, ein Wimperntierchen, das an die Innenseite des Wals geschmiegt liegt, und ein Wal, der an die Innenseite des Wimperntierchens geschmiegt liegt.
Das Zimmer fünfundzwanzig, in das ich die Familie mit den zwei Kindern geschickt habe, ist, seit ich denken kann, immer gleich eingerichtet gewesen, eine Sitzgarnitur, ein Fernseher und ein Doppelbett, ein Tisch, ein Stuhl, Nachtschränkchen, Wandbord, wie in allen anderen Zimmern auch. Das gesamte Gebäude hat sich seit seinem Bau kaum verändert. Vielleicht ist hier und da eine Topfpflanze fortgenommen und an einen anderen Platz gestellt, ein Standaschenbecher in der Eingangshalle um einige Meter verschoben worden, das ist alles. Einzig die Einliegerwohnung unter dem Dach, in der die Familie gewohnt hat, ließ unsere Mutter renovieren, nachdem unser Vater aus dem Hotel ausgezogen war: Neue Fenster wurden eingesetzt und die Räume frisch tapeziert, außerdem wurde eine nichttragende Wand zwischen Flur und Küche herausgeschlagen und in anderem Verlauf neu gesetzt, was die Küche kleiner, den Flur sehr geräumig werden ließ. Vielleicht wird diese Eigenart sich neuerdings zunehmend verbreiten: Im Schmerz nimmt man Veränderungen am Grundriß der Wohnung vor und nicht Veränderungen dort, wo es, wenn schon nicht verständlich, wenigstens vorhersehbar wäre: am eigenen Körper, am Kleidungsstil, an der Frisur, nicht einmal an den kleinen persönlichen Lastern wird noch etwas verändert werden, man wird nicht anfangen, Sport zu treiben, weil man verlassen worden ist, wird nicht weniger trinken oder rauchen, sich nicht gesünder ernähren, in Körpernähe bleibt alles unangetastet. Verändert werden statt dessen die Immobilien, die Mauern, die den Körper in einigem Abstand umgeben. In derselben Bedenkenlosigkeit, mit der man einen Lichtschalter umlegt, kappt man, um sich zu regenerieren, die Verbindungsstellen zu den nichttragenden, sogar tragenden Wänden, und die Häuser werden schwer mitgenommen sein, sie knicken in den Grundfesten ein und werden am Ende schief und verbaut dastehen, nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen, man wird ihnen ansehen, wohin die Blicke der Bewohner einmal gegangen sind und wohin sie jetzt gehen; zu den Fenstern hinaus, zu einem beliebigen Punkt an der Biegung der Straße. Nach dem Ende der Bauarbeiten sah ich meine Mutter eines Tages mitten im Flur sitzen, auf einer umgedrehten Getränkekiste, und einen Becher Joghurt essen. Meine Mutter nahm immer nur so viel Joghurt auf, daß gerade die Spitze des Löffels davon bedeckt war; eine sehr langsame, leise Angelegenheit war dieses Einnehmen einer Zwischenmahlzeit, von der ich ahnte, daß ich sie nicht stören oder unterbrechen durfte, aus welchem Grund auch immer. Ich wollte mich gerade zurückziehen, als mich meine Mutter entdeckte und sofort begann, den Löffel ein paarmal hastig in den Becher zu stoßen und ihn zum Mund zu führen. Dann sprang sie auf und kam auf mich zu, und nachdem sie mich umarmt hatte, fragte sie mich nach meinem Tag, wie der Tag gewesen sei, ob es ein schöner Tag gewesen sei, ob es mir, alles in allem, gut gehe.
Mit freundlicher Genehmigung des Wallstein-Verlages
Informationen zum Buch und zur Autorin hier
Wenn es wirklich einen Satz gäbe, der auf alles zutrifft. Wenn es nur einen Satz gäbe, einen einzigen Satz, der alle weiteren Sätze enthält und neben den wenigen als gesichert geltenden Annahmen, die wir zu Hause in unseren Schatullen und Nachtschränkchen aufbewahren, auch die völlig ins Kraut schießenden Spekulationen ohne große Worte mit einschließt, der z.B. den Wust aus Kabeln auf der Rückseite des Computers in meinem Schlafzimmer nicht erklären kann, nicht von diesem Kabelverhau spricht, der aber, ausgesprochen, in jeder Sekunde den Kabelverhau des Computers meint, natürlich meint er den Kabelverhau, spricht ohne die notwendigen Worte von den Kabeln bis in die letzten Windungen der Kabel, der Satz handelt immer auch vom Kabelverhau und gleichzeitig von allem anderen, der Satz spricht von mir, von Raimund, vom Auszug aus den Häusern, vom den Häusern entgegengebrachten Gefühl, von meinem Vater und seinem dem Satz entgegengebrachten Gefühl, vom Einverleiben eines Satzes, aber er meint damit etwas, was über all das hinausgehen wird, und was im und mit dem Satz erst dann ausgesprochen werden kann, wenn die ungesicherten, wuchernden Kleinigkeiten, die unscharfen Bilder in diesen Satz umgewandelt worden sind, in eine unauffällige Folge aus Worten, aber das ist ja ganz unmöglich, habe ich einmal zu Raimund gesagt.
Und so sitze ich vor dem Hotelcomputer, der Bildschirm wirft sein Licht voraus auf etwas, das gesagt werden könnte. Es ist unmöglich, alles der Reihe nach auszusprechen. Wie die verschlungenen Kabel auf der Rückseite des Computers, die man nicht mehr auseinanderhalten kann, die sich von einem Kabelverhau in den nächsten fortzusetzen scheinen, enthalten die Sätze immer schon die anderen Sätze und bilden die anderen Sätze, wachsen in die anderen Sätze hinein, man kann nur versuchen, ein Bild davon zu geben, von den Verkleinerungen, Vergrößerungen, vom Makroskopischen im Mikroskopischen, ein Wimperntierchen, das an die Innenseite des Wals geschmiegt liegt, und ein Wal, der an die Innenseite des Wimperntierchens geschmiegt liegt.
Das Zimmer fünfundzwanzig, in das ich die Familie mit den zwei Kindern geschickt habe, ist, seit ich denken kann, immer gleich eingerichtet gewesen, eine Sitzgarnitur, ein Fernseher und ein Doppelbett, ein Tisch, ein Stuhl, Nachtschränkchen, Wandbord, wie in allen anderen Zimmern auch. Das gesamte Gebäude hat sich seit seinem Bau kaum verändert. Vielleicht ist hier und da eine Topfpflanze fortgenommen und an einen anderen Platz gestellt, ein Standaschenbecher in der Eingangshalle um einige Meter verschoben worden, das ist alles. Einzig die Einliegerwohnung unter dem Dach, in der die Familie gewohnt hat, ließ unsere Mutter renovieren, nachdem unser Vater aus dem Hotel ausgezogen war: Neue Fenster wurden eingesetzt und die Räume frisch tapeziert, außerdem wurde eine nichttragende Wand zwischen Flur und Küche herausgeschlagen und in anderem Verlauf neu gesetzt, was die Küche kleiner, den Flur sehr geräumig werden ließ. Vielleicht wird diese Eigenart sich neuerdings zunehmend verbreiten: Im Schmerz nimmt man Veränderungen am Grundriß der Wohnung vor und nicht Veränderungen dort, wo es, wenn schon nicht verständlich, wenigstens vorhersehbar wäre: am eigenen Körper, am Kleidungsstil, an der Frisur, nicht einmal an den kleinen persönlichen Lastern wird noch etwas verändert werden, man wird nicht anfangen, Sport zu treiben, weil man verlassen worden ist, wird nicht weniger trinken oder rauchen, sich nicht gesünder ernähren, in Körpernähe bleibt alles unangetastet. Verändert werden statt dessen die Immobilien, die Mauern, die den Körper in einigem Abstand umgeben. In derselben Bedenkenlosigkeit, mit der man einen Lichtschalter umlegt, kappt man, um sich zu regenerieren, die Verbindungsstellen zu den nichttragenden, sogar tragenden Wänden, und die Häuser werden schwer mitgenommen sein, sie knicken in den Grundfesten ein und werden am Ende schief und verbaut dastehen, nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen, man wird ihnen ansehen, wohin die Blicke der Bewohner einmal gegangen sind und wohin sie jetzt gehen; zu den Fenstern hinaus, zu einem beliebigen Punkt an der Biegung der Straße. Nach dem Ende der Bauarbeiten sah ich meine Mutter eines Tages mitten im Flur sitzen, auf einer umgedrehten Getränkekiste, und einen Becher Joghurt essen. Meine Mutter nahm immer nur so viel Joghurt auf, daß gerade die Spitze des Löffels davon bedeckt war; eine sehr langsame, leise Angelegenheit war dieses Einnehmen einer Zwischenmahlzeit, von der ich ahnte, daß ich sie nicht stören oder unterbrechen durfte, aus welchem Grund auch immer. Ich wollte mich gerade zurückziehen, als mich meine Mutter entdeckte und sofort begann, den Löffel ein paarmal hastig in den Becher zu stoßen und ihn zum Mund zu führen. Dann sprang sie auf und kam auf mich zu, und nachdem sie mich umarmt hatte, fragte sie mich nach meinem Tag, wie der Tag gewesen sei, ob es ein schöner Tag gewesen sei, ob es mir, alles in allem, gut gehe.
Mit freundlicher Genehmigung des Wallstein-Verlages
Informationen zum Buch und zur Autorin hier








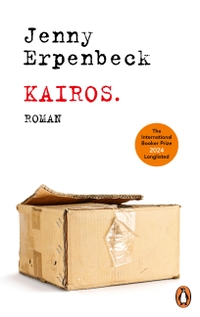 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung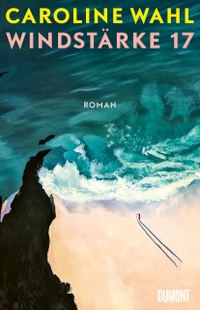 Caroline Wahl: Windstärke 17
Caroline Wahl: Windstärke 17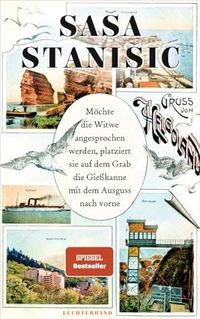 Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne
Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne