Im Kino
Innere Sinusschäden
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Patrick Holzapfel
11.07.2018. Lucrecia Martels hypnotischer neuer Film "Zama" beschreibt - und erzeugt - die Illusion eines endlosen Abstiegs in die Machtlosigkeit. Eine Wiederentdeckung ist Peter Sodans Holocaust- und Boxerdrama "Der Boxer und der Tod" mit Manfred Krug.
"Zum Warten gehört zutiefst die Unmöglichkeit zu warten." (Maurice Blanchot, Warten Vergessen)
In Lucrecia Martels "Zama" kann man hören, was man nicht sehen kann. Von Zeit zu Zeit ertönt in dieser sumpfigen Adaption von Antonio di Benedettos gleichnamigem Roman die Shepard-Skala, eine akustische Illusion, die dem Ohr einen unendlich absteigenden Ton und dem Publikum den Abstieg des Protagonisten Don Diego de Zama in die Machtlosigkeit suggeriert. Spätes 18. Jahrhundert, ein vom Kolonialismus pervertiertes Südamerika, die Orte im Film sind weniger konkret als bezeichnend, Zama wartet auf seine Versetzung. Er wartet darauf, dass das Warten endet.
Etwas unsicher herumirrend versucht er sich anzupassen und dennoch positiv aufzufallen; nur kein falscher Schritt, kein Einbüßen von Autorität. In ihm der Konflikt des Außenseiters, der Herrscher sein muss. Denn Zama ist nicht einmal ein Spanier. Er ist in Südamerika geboren. Das wird nicht wirklich erklärt, man spürt es in den Blicken. Einmal gilt es, in einem Verhör etwas herauszubekommen. Zama schafft es nicht so recht, ein Kollege der spanischen Krone macht es besser. Für einen flüchtigen Moment imitiert Zama dessen imperialistische Gesten. Ein Schritt, ein Abklopfen der Rute, eine Drohung. Er ist der perfekte Körper, der diese Gesten ausführt. Ein banaler Bürokrat, ein stummer Karrierist. Was in ihm vorgeht, wird stumm gestellt. Aber jetzt ist er müde. Er bittet um Versetzung, wird vertröstet, wartet weiter, folgt Befehlen.
Sieht man da womöglich Risse in seinem Gewissen? Oder ist er nur der ermattetste Charakter seit Ben Gazzaras Cosmo Vittelli in "The Killing of a Chinese Bookie"? Er blickt mit schwitzender Stirn aus der Hölle des Wartens in das absurde Gesicht der Welt und, folgt man den Sinnestäuschungen der unendlichen Tonleiter von Shepard, fällt und fällt und fällt er ins Bodenlose.
Der faszinierende Effekt dieses Glissandos, das übrigens auch von Hans Zimmer für seinen "Dunkirk"-Soundtrack verwendet wurde, ist nur ein Schein, ein Gefühl. Die Wirkung entsteht durch in ihrer Frequenz abnehmende Sinustöne, wobei dieser Effekt durch das Shepard-Risset-Glissando, benannt nach dem Komponisten Jean-Claude Risset, im Film noch verstärkt wird. Dabei werden die Teiltöne, bei kontinuierlichen Variationen der Frequenzen, durchgehend gehalten, was den Eindruck eines einzigen, fallenden Tons bewirkt. Innere Sinusschäden, die Zeit setzt aus, durch die leeren Bestrebungen fällt noch ein wenig Licht, aber Don Diegos Weg ins Delirium wird immer deutlicher. Wie dieses Glissando ist sein Warten ein Fallen.
Es gibt sich ewig vorbereitende Konjunktive in diesem Film, die nie ganz ihre Bestimmung finden. Zum Beispiel die Geschichte von Zama und seinem Kind mit einer Eingeborenen. Oder jene von Zama, der zu seiner Familie möchte, der nach Versetzung trachtet. Oder jene rund um den Verbrecher Vicuña Porto (Matheus Nachtergaele). Schließlich auch jene sexuelle Frustration, die sich bei den vergeblichen Annäherungen an Luciana Piñares de Luenga in Zama einstellen. All diese Episoden werden erzählt und nicht erzählt. Sie werden Erinnerung, Realität und Phantasma zugleich. Die Illusion bangt zugleich um ihre Existenz und ist doch das einzige, das bleibt zwischen diesen Narben von Gewalt und Macht.

Es wirkt so, als könne es immer weiter gehen, aber eigentlich ist es bereits vorbei. Es gibt nur in der Frequenz variierende Szenen des Immergleichen. Bis schließlich Vergangenheit und Gegenwart untrennbar sind, genau wie Wahn und Sinn. Dieser Zama, das wird einem nach wenigen Sekunden im Film klar, man muss nur die Haltung und Mimik von Darsteller Daniel Giménez Cacho studieren, hat zu oft dasselbe Licht am Morgen gesehen. Er treibt in einer identitätslosen Leere, die in einem hypnotischen und gewaltvollen Aufeinandertreffen mit indigenen Bewohnern des Kontinents an Grenzen stößt. Denn hier kann Zama nicht mehr sein. Er verliert seine Rolle, sogar sein Warten. Dass man diese Aufeinandertreffen eines Volks mit seiner Fremdheit, einer Welt mit ihrer Vergangenheit, politisch verstehen kann, ist offensichtlich.
Alle Töne und Lichter vermischen sich zu einem Morast, aus dem man nicht mehr fliehen kann. "Der Morast", so hieß auch der erste Spielfilm von Martel und so könnte eigentlich jeder ihrer bis dato vier Langfilme heißen. Man könnte trotzdem sagen, dass "Zama" ein Neubeginn für die argentinische Filmemacherin ist. Eigentlich arbeitete sie an einer Verfilmung des Graphic Novel El Eternauta von Héctor Germán Oesterheld. Dieser Film kam unter anderem aus finanziellen Gründen nicht zustande und auch "Zama" ist ein Co-Produktions-Ereignis, wie der gar nicht enden wollende Vorspann verrät. Umgerechnet an die drei Millionen Euro kostete der Film. Es ist die erste digitale Arbeit von Martel. Nie denkt man an Geld, während man ihn sieht. Man tut sich sowieso schwer mit dem Denken, man ist zu sehr mit der fesselnden Schwüle und Genauigkeit des Films beschäftigt.
Es wird viel gefächert im Film. Meist von Bediensteten und Sklaven, die, wie man das kennt von Martel, gleich eines unangenehmen Gewissens die zwischenzeitlich durchaus komische Absurdität der spanischen Etikette (Perücken, Floskeln und mehr Fächer) in bitteren Ernst verwandeln. Diese widerwärtigen Gesichter einer zum Scheitern verurteilten Ideologie. Sie klammern sich schwitzend an sich selbst, wollen alle nur mehr entkommen, in ihrem Atem erahnt man den Gestank endloser Ungerechtigkeit. Die beobachtende und durchaus analytische Präzision, mit der Martel Strukturen offenlegt, entsteht allerdings nicht aus einem Kino der Distanz. Stattdessen wird man mitten in den Sog geworfen, vor allem die virtuose Arbeit am Tondesign (man hat das Gefühl, dass Insekten unter den Bildern kriechen) stellt subjektive Sinnesbeschreibungen und Aggregatzustände her, mit denen Martel ihre Zuseher konfrontiert. Es geht hier weniger um Aufklärungsarbeit an der südamerikanischen Geschichte, als um das Spürbarmachen einer menschlichen Erfahrung, die notwendigerweise auch geschichtlich und politisch ist.

Don Diego durchläuft den Apparat, der dieses Warten verursacht von innen und außen. Wir sehen ihn machtlos im Getriebe und doch schuldig an der Arbeit desselben. Er ist sicher kein Opfer. Aus diesem Paradox schält sich letztlich die Verletzlichkeit des Films und der Welt, die er zeigt. So befindet sich eine Gruppe auf der Jagd nach dem berüchtigten Mörder Vicuña Porto. Nur: Dieser befindet sich unter ihnen. Eigentlich hatte man vorher im Film allerdings schon erfahren, dass er tot ist. Was absurd scheint, ist zum einen dem mentalen Delirium Zamas geschuldet, zum anderen aber stichhaltige Metapher einer Kolonialismus- und Kapitalismuskritik. Dann erscheint es einfach nur konsequent, dass der schlimmste, bereits totgesagte Verbrecher sich unter den imperialen Mächten befindet, die behaupten, ihn zu jagen.
Martel, die während der Arbeit am Film schwer erkrankte und die das Verhältnis zwischen Film und Literatur mit dem ihrer Krankheit zum Körper vergleicht, wird zurecht gefeiert für "Zama". Das ist auch deshalb besonders, weil der Film nach der Ablehnung durch das Filmfestival von Cannes und einem Screening jenseits des Hauptwettbewerbs in Venedig zunächst auf äußerst wackeligen Beinen stand. Martels Warten hat sich gelohnt. Darauf zu warten, diesen Film außerhalb des Kinos zu sehen, wäre allerdings fatal.
Patrick Holzapfel
Zama - Argentinien 2017 - Regie: Lucrecia Martel - Darsteller: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujín, Nahuel Cano, Mariana Nunes . Laufzeit: 115 Minuten.
---

Kleider machen Leute. Aus dem nervös auf den Boxsack einschlagenden Kraft (Manfred Krug) wird ein SS-Mann und Lageraufseher erst, nachdem er in der Kabine seine Sportkleidung über den Vorhang geworfen hat und gleich darauf in voller Montur wieder hervortritt. Später einmal wird dieser an expressiven Gesichtern nicht arme Film ein ausgemergeltes Gesicht erst im aufgezogenen Bild als das eines KZ-Wächters preisgeben. Kleider trennen auch Leute, sie entscheiden mitunter über Leben und Tod. Beziehungsweise darüber, ob und wie man ein KZ verlässt: Unbehelligt durchs große Tor oder ermordet und verbrannt als Rauch aus dem Schlot - ein Bild, das Peter Solans beeindruckender slowakischer Film "Der Boxer und der Tod" aus dem Jahr 1962 immer wieder gezielt im Bildhintergrund platziert.
Doch im Boxring, vor dem die Uniformen abgelegt werden, sind die Menschen gleich: Es zählen Manneskraft, Geschick und Technik. Eigentlich. Nur, dass in den Kämpfen dieses Films die Reduktion Mann gegen Mann doch wieder von Außen aufgeladen ist: Kraft, der keinen Vornamen zu tragen scheint und vom jungen Manfred Krug - was für ein begnadet körperlicher Schauspieler! - dem Namen entsprechend ausgefüllt wird, Kraft also ist gelangweilt vom Alltag im Lager und frönt in der Sporthalle allein mit sich selbst seiner eigentlichen Leidenschaft, dem Boxkampf. Als eine Gruppe ausgezehrter Slowaken beim Fluchtversuch erwischt wird, erkennt er in Jan Kominek (Stefan Kvietik) einen vormaligen Boxer und also die Chance, endlich auf seine Kosten zu kommen. Nur ein Problem: Kominek ist, natürlich, abgemagert. Die Parole an Krafts Gehilfen also: vier Kilo in drei Tagen - danach sieht man weiter.
Kominek sieht sich fortan mehrfach in Zwickmühlen wieder: Indem er sich verdreschen lässt, überlebt er - kriegt sogar reichlich zu essen. Das wiederum bringt ihm im Lager keine Sympathien ein, man sieht in ihm einen Sympathisanten und Günstling, vielleicht sogar einen Spitzel der Nazis. Nimmt er nicht rasch genug zu, steht er im Verdacht, seine Essensrationen zu verteilen. Gewinnt er im Ring, steht sein Leben auf dem Spiel. Verliert er im Ring zu leichtfertig, gilt dasselbe: Dann fühlt sich Kraft betrogen.

Im Grunde also klassischer Kino-Existenzialismus: ein Mann, eine verfahrene Situation, keine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, aber viel Herz. Doch die Sensibilitäten des osteuropäischen Autorenfilms - sechs Jahre später drehte Solan gemeinsam mit Zbynek Brynych und Jerzy Skolimowski den Episodenfilm "Dialog 20-40-60" - retten den Film davor, das historische Thema dem zugespitzten Spektakel zu opfern: "Der Boxer und der Tod" ist kein "edge of seat"-Film, sondern lebt von seiner gedämpften (An-)Spannung und deren allmählichen Aufbau - ein kleines Glanzstück in Sachen "show, don't tell".
Sicher, die Idee, einen Sportfilm vor Kulisse eines KZ-Dramas zu erzählen, würde heute an mittlerweile gewachsenen Vorbehalten scheitern. Was Solans Verfilmung einer Kurzgeschichte des polnischen Autors Józef Hen von neuerer, mitunter kitschiger Holocaust-Kinoware abhebt, ist die Abwesenheit von Pathos und Dämonologie. Dieser Kraft ist ein ganz gewöhnlicher Deutscher, jovial, flappsig, auf diese Berliner kumpelige Manfred-Krug-Art. Aber wenn ihm danach ist, schießt er dennoch aus dem Fenster auf die Gefangenen, nutzt das Machtgefälle skrupellos aus. Die Nazis, das sind bei Soltan keine aus dem Höllenreich gekrochenen Teufel, sondern Menschen, denen der Sadismus bis tief in kleine Gesten und Worte eingeschrieben ist.
Umgekehrt vermeidet der Film die Heiligsprechung der Opfer. Unter den KZ-Insassen gibt es Neid, Missgunst, Diebstahl, aber auch Formen des Zusammenhalts. Ganz gewöhnliche Menschen. "Der Boxer und der Tod" ruft in seiner konzentrierten, aufs Kunstwollen auf dem Rücken der Geschichte gerade nicht abzielenden Schilderung einer aussichtslosen Konstellation, nochmal in Erinnerung, was an Holocaust-Schmachtfetzen oft so stört: die retrospektive Melodramatisierung der Shoah-Opfer zu besonders guten, liebenswerten Menschen. Als wären nur solche Opfer des Mordapparats der Deutschen der emotionalen Affekte der Nachgeborenen wert.
Einmal mehr weist sich in dieser spannenden Wiederentdeckung, wie wichtig für die hiesige Filmkultur mittlerweile engagierte Heimmedien-Labels wie Bildstörung sind. Mit seinen Hebungen aus der reichen Geschichte (nicht nur, vor allem aber) des osteuropäischen Kinos kann der Kölner Anbieter die klaffende Lücke, die seit dem de facto Abschied der öffentlich-rechtlichen Sender aus der filmhistorischen Verantwortung entstanden ist, zwar kaum schließen. Aber immerhin den Schmerz darüber ein wenig lindern.
Thomas Groh
Der Boxer und der Tod - Regie: Peter Solan - Darsteller: Stefan Kvietik, Manfred Krug, Valentina Thielová, Józef Kondrat, Edwin Marian, Gerhard Rachold - Laufzeit: 120 Minuten. CSSR 1962
"Der Boxer und der Tod" ist beim Label Bildstörung auf BluRay und DVD erschienen.
Kommentieren








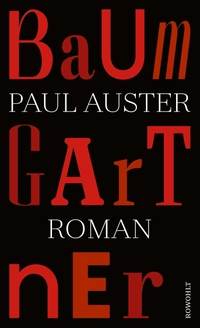 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung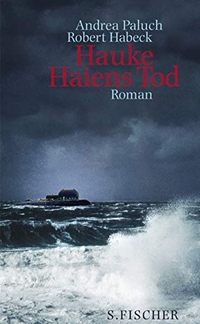 Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod
Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod