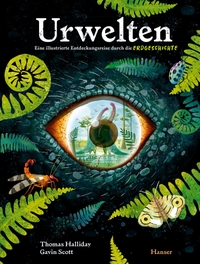Im Kino
Superheldenbarock
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster
15.06.2023. In den älteren Filmen über die Superheldenwerdung wurde immer auch das Problem der Kontinuität zwischen der Superheldenwelt und unserer eigenen mitverhandelt. Das Multiversum, in dem die jüngsten Filme spielen, kennt hingegen kein Außen mehr, es verweist nur noch auf andere Superheldenfilme. So auch in Andy Muschiettis "The Flash", wo den Helden gleich drei Batmans umschwirren und sein jüngeres Selbst.
Alle Batmans sind schon da. Wobei, nicht ganz alle. Emo-Batman (Robert Pattinson) fehlt und auch Fascho-Batman (Christian Bale) glänzt durch Abwesenheit. Aber mit grumpy Batman (Ben Affleck), gothic Batman (Michael Keaton) und Nippel-Batman (George Clooney) sind gleich drei Kinofledermäuse mit von der Partie - in einem Film allerdings, der nach einem ganz anderen Maskenträger benannt ist: Die Titelfigur The Flash selbst taucht in ihrem eigenen Film freilich, nachdem sie sich früh in der unübersichtlichen Handlung in einer Zeitreiseparadoxie verläuft, ebenfalls (mindestens) zweifach auf. Beide Versionen werden von dem als Mann geborenen nichtbinären Schauspieler Ezra Miller verkörpert, dessen Karriere nach einer Serie erratischer und teils aktenkundiger Episoden ins Schlingern geraten ist. "The Flash" hat den Sturm überlebt. Miller ist, wie es ausschaut, too big to cancel. Jedenfalls vorläufig und eventuell nur solange, bis die ersten belastbaren Box-Office-Zahlen zu "The Flash" eintreffen.
Dass die Kinokassen seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten fast nach Belieben dominierende Superheldengenre ist in seiner barocken Phase angekommen. Die Superhelden verdoppeln sich, suchen gegenseitig ihre Filme heim, wechseln nach Belieben die Kostüme und manchmal auch, wie in "The Flash" zum Beispiel Superman, das Geschlecht. Wie soll einer da den Überblick behalten? Das Superheldenkino rechnet inzwischen mit einem Publikum, das ins Kino geht, nicht um Superhelden zu sehen, sondern um sich an Superhelden zu erinnern. Und zwar: sehr genau und sehr differenziert zu erinnern. Wer unter Gedächtnisschwäche leidet oder vielleicht schlicht nicht alle Filme und Serien der diversen ausufernden Franchises gesehen hat, steht mehr und mehr auf verlorenem Posten.
Irgendeinen Eintrittspunkt benötigen die einzelnen Filme dennoch. Im Fall von "The Flash" ist es ein Coffeeshop. Kaffee trinken wir alle. The Flash heißt zunächst noch Barry Allen, arbeitet in einem Labor als forensischer Chemiker und möchte sich auf dem Weg zur Arbeit ein Heißgetränk gönnen. Der Barista aber lässt sich Zeit. Weil guter Kaffee eben Zeit braucht. Für die Titelfigur des Films hingegen ist Zeit bloßes Rohmaterial. Wenn aus Barry Allen The Flash wird, materialisiert und verräumlicht sich die sonst unsichtbare Zeit, der Superheld navigiert in teils ballettartig anmutenden Special-Effects-Szenen eine geleeig verlangsamte Welt und rettet dann zum Beispiel nicht nur wie einst Chow Yun Fat ein, sondern gleich acht Babys sowie außerdem noch eine Krankenschwester aus einem kollabierenden Hochhaus.

Und weil der Flash den Lauf der Zeit nicht nur anhalten, sondern gar umdrehen kann, gibt es wenig später eben, siehe oben, gleich zwei Flashs beziehungsweise Barrys. Wie die meisten Zeitreiseplots würde auch dieser durch eine Nacherzählung verlieren; weil das Zeitreisen im Kino fast stets nicht für sich selbst interessant ist, sondern als Medium für etwas anderes. In diesem Fall für ein Familienmelodram und eine komödiantische Coming-of-Age-Erzählung. The Flash möchte seine Superkräfte nutzen, um das Lebenstrauma des Todes seiner Mutter aus der Welt zu schaffen - und findet sich unversehens im Kinderzimmer seines jugendlichen, hormongesteuerten Doppelgängers wieder.
Was genau hat nun Batman mit all dem zu schaffen? Tatsächlich gar nicht einmal so viel, dennoch hängt der ewige Düsterling unter den Superhelden andauernd in der Peripherie der Handlung ab und zwar, eben, gleich in mehreren Inkarnationen. Das ist zunächst ein leicht durchschaubares kommerzielles Kalkül: Nachdem die Sony/Marvel-Konkurrenz mit "Spider-Man: No Way Home" auch dank des nostalgischen Schaulaufens diverser Spinnenmanndarsteller alle Rekorde brach, sollen nun die historischen Kinobatmans für Warner/DC den Trick wiederholen. Die Rechnung mag an den Kassen aufgehen oder auch nicht; im Trend liegt "The Flash" mit seiner multiplen Fledermaus in jedem Fall.
Die Entwicklung des alles andere verschlingenden Megagenres der Kinogegenwart lässt sich als Dreischritt beschreiben. Bis Anfang der Zehnerjahre war die sogenannte "origin Story" das wichtigste Superheldenfilmnarrativ.; anschließend wurden die einzelnen Ursprungserzählungen zu "Cinematic Universes" zusammenaddiert; und spätestens nach dem kolossal erfolgreichen Avengers-Diptych "Infinity War" (2018) und "Endgame" (2019) hat sich ein weiteres, drittes erzählerisches Paradigma etabliert: das Multiversum. Wobei der Unterschied letztlich weniger ein narrativer ist als einer des Weltbegriffs. In den älteren Filmen über die Superheldenwerdung wurde immer auch das Problem der Kontinuität zwischen der Superheldenwelt und unserer eigenen - sowie zwischen den Superheldenkörpern und unseren eigenen normalen - mitverhandelt, und auch das Konzept eines Superheldenuniversums lässt die Frage nach seinem Verhältnis zu unserem eigenen immerhin noch zu. Das Multiversum hingegen kennt kein Außen mehr und organisiert sich rekursiv: Batman verweist nicht mehr auf sein bürgerliches Alter Ego Bruce Wayne, sondern nur noch auf andere, alternative Batmen.

Bislang ist nicht abzusehen, ob es sich bei der aktuell tatsächlich, siehe "Everything Everywhere All At Once", auch außerhalb der klassischen Comicverfilmung grassierenden Multiversumswelle um eine neue Eskalationsstufe der nach wie vor kaum zu stoppenden Superheldisierung des Gegenwartskinos handelt, oder womöglich doch um den von nicht wenigen herbeigesehnten Anfang ihres Endes. Es hat sich in den letzten Jahren jedenfalls selten gelohnt, gegen das Superheldenkino zu wetten. In Bezug auf "The Flash" lässt sich dennoch feststellen: Je tiefer der Film in das Multiversum vordringt, desto öder wird es. Die Hochhaus-Babyszene zu Beginn ist grandios und auch die Comedy-Routinen um den doppelten Flash bereiten einige Freude. Tatsächlich scheint sich Regisseur Andy Muschietti hier dem emotionalen Kern des Films zu nähern: Erwachsenwerden heißt, nicht mehr ganz mit sich selbst identisch zu sein. Nicht umsonst ist uns in der Phase der Adoleszenz kaum etwas peinlicher als unser eigenes, ein paar Jahre jüngeres Ich. In genau solch einen unangenehm klarsichtigen Spiegel blickt auch der Flash, wenn er seinem unbeschwerten, naiven, noch nicht in die Geheimnisse der Zeitmanipulation eingeweihten Ebenbild entgegen tritt. Umgekehrt kann der jüngere Barry im älteren nicht viel mehr sehen als den sozial unangepassten Nerd, der letzterer in der Tat ist. All das funktioniert nicht zuletzt deshalb, weil Miller in den komischen Szenen eine deutlich bessere Figur macht denn als Actionstar.
Leider schlägt der wie fast jeder aktuelle Superheldenblockbuster deutlich zu lange Film noch vor der Halbzeit eine andere Richtung ein: Wieder einmal bedroht ein Weltraumbösewicht die Erde und wieder einmal kann nur die Gemeinschaft der Superhelden die Welt retten. In diesem Fall kennen wir nicht nur den Bösewicht, sondern sogar seinen bösen Masterplan bereits aus dem älteren "Man of Steel", als dessen bloßer, effekttechnisch minderwertiger Remix "The Flash" sich schlussendlich entpuppt. Da mag die Zeit auch noch so formbar sein: Ihr Anfang und ihr Ende und alles dazwischen ist immer nur Batman. Es gibt kein Entkommen. Bis auf Weiteres ist das Superheldenbarock die Welt, in der wir leben.
Lukas Foerster
The Flash - USA 2023 - Regie: Andy Muschietti - Darsteller: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston u.a. - Laufzeit: 144 Minuten.
Kommentieren