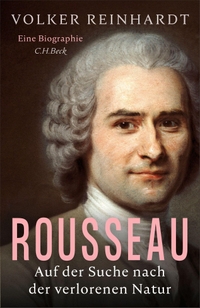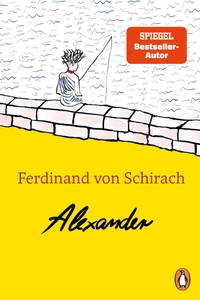Im Kino
Charisma mit Kurzhaarschnitt
Die Filmkolumne. Von Ekkehard Knörer, Karsten Munt
03.09.2020. Jan Komasas "Corpus Christi" um einen jungen Hochstapler-Priester lebt ganz von der Ausstrahlung und den blauen Augen des Hauptdarstellers Bartosz Bielenia. Schade nur, dass der Regisseur sich nicht entscheiden kann, wo er mit seinem Film hin will. Donnie Yen traktiert ein letztes Mal als "Ip Man" seinen Mu ren zhuang Trainingsdummy. Diesmal in San Francisco, wo amerikanische Rassisten ihn und Bruce Lee herausfordern.
Daniel hat Jahre im Jugendknast in Warschau verbracht, hat aber, anders als seine Mitinsassen, einen Zug ins Spirituelle. Der Weg ins Priesterseminar jedoch ist ihm seiner kriminellen Vergangenheit wegen versperrt. Offen ist nur der Weg in die Provinz, ein Knochenjob in einer Sägemühle ist ihm versprochen. Leer ist der Bus, einsam die Landschaft, groß der Zufall, der ihn auf dem Umweg über die Kirche und die spontane Lüge, er sei Absolvent eines Priesterseminars, ins Wohnzimmer des Priesters des kleinen Städtchens führt. Der Priester ist ausgebrannt, Alkoholiker, am nächsten Tag liegt er kaum ansprechbar neben dem Bett, muss ins Spital, das Städtchen braucht einen Priester, da kommt Daniel, der falsche Fuffziger, wie gerufen.
Der Ruf ist da, die Berufung spürt er auch, der Rest ist learning by doing. Bei der Abnahme der Beichte gerät er ins Schwitzen, aber Google ist sein Freund. Auch bei der Predigt dauert es nicht lang, dann findet er seine eigene Stimme und Körperlichkeit, sein aufrüttelnder Enthusiasmus führt einmal gar zu Szenenapplaus. (Als hieße es nicht schon bei Robert Gernhardt: "Paulus schrieb an die Apatschen: Ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen."). Daniel freundet sich mit einer jungen Frau namens Eliza an, die Freundschaft führt die beiden, das ist schnell zu erahnen, am Ende ins Bett, dabei hat Daniel kurz davor noch so überzeugend für das Zölibat argumentiert.
Eliza ist traumatisiert wie viele im Ort, ein schwerer Verkehrsunfall hat vor nicht langer Zeit eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Leben gerissen, unter ihnen Kuba, ihren Bruder. Vor einer improvisierten Gedenkstätte mitten im Ort versammeln sich die trauernden Hinterbliebenen im gemeinsamen Schmerz. Allerdings kultivieren sie zugleich ihren Hass auf den Fahrer des anderen Autos, auf den sie ihren Schmerz projizieren. Auch für sie kommt ein Priester wie gerufen, der mit zusehends evangelikal wirkenden Exaltationen Heilung für ihre Seelen verspricht. Als er dann allerdings ernst machen will mit dem christlichen Gebot des Verzeihens, verschließen sie ihre Seelen und gerieren sich wie der Trupp von Horrorfilm-Zombies, als den der Film sie ohnehin schon die ganze Zeit inszeniert.

"Corpus Christi" folgt in den Grundzügen einer wahren Geschichte. Der Film war in Polen ein Riesenhit, schaffte es unter die letzten Fünf beim Auslandsoscar und machte seinen Hauptdarsteller Bartosz Bielenia und seinen Regisseur Jan Komasa zum Star. Im Fall von Bielenia ist das nachzuvollziehen. Sein Charisma mit Kurzhaarschnitt glüht durch eisblaue Augen, man versteht den Wunsch der Menschen, einem wie ihm zu verfallen. Plausibel in einem strikt psychologischen Sinn wird die Figur nicht, aber als überlebensgroße Kinogestalt haut er hin. Jan Komasa schafft den passenden Rahmen für eine solche Figur. Die sehr breite Leinwand signalisiert Großzügigkeit gegenüber kleinlichen Realismusansprüchen. Oft leicht milchig durchströmt das Licht die Bilder mit ihrem Drang in Richtung altmeisterlicher Komposition. Das ist so glatt und auf Schönheit bedacht inszeniert, dass sich der Verdacht tiefer Bedeutsamkeit der Veranstaltung aufdrängt.
Nur bestätigen lässt er sich nicht. In seinen allegorischen Moves bleibt das Ganze letztlich konfus. In seinem grandiosen Roman "Die schwarze Messe" erzählt Charles Willeford die Geschichte eines Hochstapler-Priesters als abgründigen Karneval, der das Erbärmliche und das Teuflische in ein einziges Drunter und Drüber verwirrt. Die Konstruktion von "Corpus Christi" dagegen kann sich für nichts recht entscheiden, auch nicht fürs Bitterböse: Ist es die Geschichte einer verwirrten Seele, die Anklage einer verlogenen Christengemeinde, das Porträt eines polnischen Provinzstädtchens inklusiver korrupter Unternehmerfigur, die Komödie einer sich verselbständigenden Hochstapelei? Horror-Film, Tatort-Krimi? Alles davon ist im Buch angelegt, nichts davon überzeugend realisiert. Gelungene Parabeln bringen alle wichtigen Bewegungen des Plots unter den Hut einer Deutungsrichtung. "Corpus Christi" dagegen zerfällt in eher realistische Momente und eher triviale Thesen wie die, dass der Mensch glauben will, zur Not auch an einen Betrüger, dass Verzeihen schwer ist, wo der Schmerz groß und so weiter.
Bestätigung findet die Frustration mit "Corpus Christi" übrigens im Nachfolgewerk "Hejter", das Jan Komasa in diesem Jahr mit demselben Drehbuchautor, dem erst 28-jährigen Mateusz Pacewicz, produziert hat und das auf Netflix zu sehen ist. Im Zentrum eine sehr ähnliche Jungmännerfigur, nun allerdings stärker ins Narzisstisch-Pathologische verschoben. Dieser Tomasz, früh im Leben ähnlich gestrandet wie Daniel, wird zum Internet-Manipulator in betrügerischen Social-Media-Kampagnen, der Film versteht sich als scharfe Kritik sowohl der polnischen Rechten wie des Internet-Zeitalters wie des liberalen Kulturbürgertums, das als rüde klassistisch vorgeführt werden soll. Dasselbe Problem wie bei "Corpus Christi": Figur und mögliche These finden nicht zueinander, Realismusanspruch trifft auf nicht gedeckte Behauptung, es ist zu viel auf einmal in konfuser Weise im Spiel. Für Komasa gilt, was für den falschen Priester Daniel gilt: Dieser Kaiser ist nicht ganz nackt, er ist nicht mal ganz ohne, aber dem Hype glaubt man dann doch besser nicht.
Ekkehard Knörer
Corpus Christi - Polen 2019 - OT: Boze Cialo - Regie: Jan Komasa - Dartsteller: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Zietek, Zdzislaw Wardejn - Laufzeit: 115 Minuten.
---

Es existieren nur wenige Filmaufnahmen vom legendären Kampfkünstler Ip Man. Die einzige veröffentlichte Aufnahme zeigt den fast Achtzigjährigen kurz vor seinem Krebstod beim Training mit seiner ikonischen Holzpuppe. Der Mu ren zhuang genannte Trainingsdummy ist das Symbol für das von Ip Man perfektionierte Wing Chun. In der vierteiligen Ip-Man-Reihe von Wilson Yip wird der Holzmann immer wieder auf unterschiedliche Art zum symbolischen Zentrum der Geschichte. Auch im vierten Teil der Reihe weist Yip dem Mu ren zhuang zentralen Symbolcharakter zu. Kurz nachdem Hartman Wu (ein Schüler von Bruce Lee, der seinerseits Schüler von Ip Man war) das Trainingsgerät auf eine amerikanische Militärbasis bringt, wird es von seinem Vorgesetzten in Flammen gesetzt. Wie das Kreuz bei einer Ku-Klux-Klan-Versammlung steht der brennende Mu ren zhuang vor der Baracke, um die die chinesischen Rekruten eine Strafrunde drehen. Der Vorgesetzte ist der von Scott Adkins verkörperte Gunnery Sergeant Geddes. Eine neue Version der Ip-Man-Antagonisten, die allesamt kampfkunstgeschulte und rassistische Monster aus dem Ausland (wahlweise Japan oder USA) sind. Es geht also (wieder einmal) um Rassismus. Die Xenophobie, die in der Filmreihe immer wieder eine durchaus fragwürdige Hauptrolle spielt, wird im vierten Teil zum Zentrum des Films - ohne sich von der Idee zu lösen, dass die Auseinandersetzung primär als Faustkampf zwischen wutentbrannten Rassisten und integren Kampfkünstlern ausgetragen wird.
Diesmal werden diese Kämpfe nicht in China oder Hong Kong, sondern in San Francisco abgehalten. Der kürzlich mit Krebs diagnostizierte Ip Man gerät, auf der Suche nach einer geeigneten Schule für seinen Sohn, zwischen die Fronten. Auf der einen Seite steht die chinesische Minderheit. Ihr Wortführer, der Vorsitzende der "Chinese Benevolent Association" Wan Zong Hua (Yue Wu) ist beleidigt, weil Ip Mans ehemaliger Schüler Bruce Lee (Danny Kwok-Kwan Chan) die verfeindeten Amerikaner chinesische Kampfkunst lehrt. Statt Ip Man einen schriftliche Empfehlung für seinen Sohn auszustellen, beginnt Hua das erste, stilechte Duell auf amerikanischem Boden: die Kampfkunst-Meister schieben mit unsichtbarer Kraft eine Tischplatte hin und her, bis dessen Glas unter dem Druck in tausend Teile zerspringt.
Auf der anderen Seite stehen die über diverse Behörden verstreuten amerikanischen Rassisten, die nicht nur Hua und dem bereits erwähnten GI Hartman Wu das Leben schwer machen, sondern auch Bruce Lee immer wieder in Konflikte verwickeln. Als Bruce Lee und Ip Man sich das erste Mal in San Francisco treffen, stürmt eine Gruppe amerikanischer Karate-Schüler das Diner, um Lee und seine Schüler herauszufordern. Während der Meister beim diplomatischen Teetrinken die Tischplatten zum Bersten bringt oder beim Schulbesuch ein paar gewalttätigen Teenagern die Ohren lang zieht, tritt der Schüler mit One-Inch-Punch, Roundhouse-Kick und Nunchaku gegen irre Karateka an.

Das ganze rutscht schnell in die Blödelei ab, aber genau hier wirkt "Ip Man 4" am gelungensten. Zwischen sahnecremefarbenen Cadillacs, glitzernden Pompons, Leuchtreklamen, Lampions und den anderen nostalgischen Attraktionen kommt nicht nur die Choreografie, sondern auch das Rassismusthema am besten zur Geltung. Die Kampfszenen bleiben das Herzstück der Reihe. Ip Man und sein Schüler verteilen nicht nur Backpfeifen an Nationalisten, sondern versuchen stets ihr Gegenüber im Wettkampf zu bekehren. Bruce Lee ringt einem Widersacher ein "Daumen hoch" ab, als dieser nach einem Tritt vor die Brust seine Niederlage eingestehen muss und wandelt damit die Straßenprügelei in ein respektvolles Sparring. Ip Mans Gegner zeigen sich weniger kooperationsbereit. Die rohe Gewalt vom cholerischen Stiefelträger Geddes prallt auf die bereits deutlich gealterten Knochen von Ip Man und bietet eine brutales Gegenmodell zum drahtseilgestützten Synchrontanz, den die Kung-Fu-Meister untereinander abhalten.
Die bewährte Erfolgsformel ist also geblieben: Yip charakterisiert nicht abseits des Kampfes, sondern währenddessen. Doch fehlt dem vierten Teil letztlich das Gegengewicht zum eleganten Nahkampf, der für Yips Figur immer einen komfortablen Ausweg bietet. In den Vorgängerfilmen war der unbesiegbare Ip Man immer mit Kräften konfrontiert, die er nicht zum Zweikampf stellen konnte (die japanische Besatzung, die Krebserkrankung seiner Frau). Ein Dilemma, das die Figur des Nationalhelden stets ein bisschen einfing und zur Zwischenmenschlichkeit zwang, im vierten Teil der Reihe aber weitgehend ignoriert wird. Ip Mans Krebsdiagnose gerät schlicht in Vergessenheit und wird letztlich nur als Fußnote nachgereicht. Als er bereits von der Krankheit geschwächt ist, wendet sich der große Meister ein letztes Mal dem Mu ren zhuang zu. Von seinem Sohn gefilmt, demonstriert er noch einmal die Formen und verliert sich ganz in der geliebten Kampfkunst. Es sind die letzten Filmaufnahmen von Ip Man. Mit ihnen nimmt der Film Abschied - ganz ohne Tragik.
Karsten Munt
Ip Man 4 - Hongkong 2019 - OT: Yip Man 4 - Regie: Wilson Yip - Darsteller: Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwak Chan, Vanness Wu, Jim Liu, Kent Cheng - Laufzeit: 107 Minuten.
Kommentieren