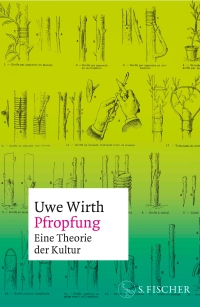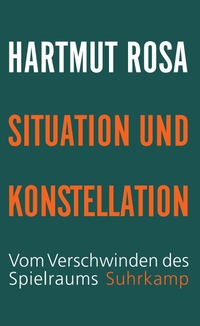Im Kino
"I'm so fuckin' proud of you"
Die Filmkolumne. Von Katrin Doerksen
05.10.2023. Für bare Münze darf man nichts nehmen in Chloe Domonts Spielfilmdebüt "Fair Play". Im Zentrum steht ein Liebespaar, dessen emotionaler Beziehungshaushalt durch den beruflichen Erfolg der Frau aus den Fugen gerät.
"I love to love you baby" haucht Donna Summer ein paar Mal die legendäre Liedzeile, die nur für völlig Unbedarfte so klingt, als gehe es um den besungenen Adressaten. Damit findet die Tonspur, noch bevor überhaupt das Bild einsetzt, zu der Aufgabe, die sie in "Fair Play" häufig übernehmen wird, nämlich das Sichtbare zu hinterfragen, zu warnen: Nimm, was du siehst, nicht für bare Münze. Na klar möchte man ein überglückliches Paar sehen, wenn Luke (Alden Ehrenreich) den Kopf seiner frisch Verlobten in seine Hände nimmt, sein "I fuckin' love you so fuckin' much" herauspresst. Aber warum diese verbale Übersprungshandlung, der Kraftausdruck, die verzweifelte Aggression darin? Da geht es mehr um ihn als um seine Gefühle für sie - genau deswegen stellen sich später die Nackenhaare auf, kleine verlässliche Alarmrezeptoren die sie sind, wenn er wieder sagt: "I'm so fuckin' proud of you". Da ist Emily (Phoebe Dynevor) gerade befördert worden - auf eine Position, von der er dachte, dass sie ihm angeboten würde.
Also ist Chloe Domonts Spielfilmdebüt "Fair Play", das nach seiner Sundance-Premiere an Netflix verkauft wurde und parallel in einigen Kinos startet, die Geschichte eines New Yorker Finanzanalysten, der nicht damit klar kommt, dass sein Boss Campbell (Eddie Marsan) seine Verlobte für fähiger hält als ihn? In einer Branche zumal, die auch nach #MeToo von männlichen Anzugträgern, von Dominanzverhalten und skrupellosem Wettbewerb geprägt ist. Wobei sich die Situation noch dadurch verkompliziert, dass Emily und Luke mit ihrer Beziehung die Firmenpolicy brechen. Vor den Kollegen geben sie vor, sich nur flüchtig zu kennen, nehmen getrennte Arbeitswege. Aber auch hier gilt: Es ist kompliziert.
Effizient baut die an Kurzfilmen und Serienepisoden von "Suits" bis "Billions" geschulte Domont in "Fair Play" zunächst eine Lebenswelt auf, in der nichts außer der Arbeit zählt: Alles spielt sich in Bürogebäuden, teuren Cocktailbars und auf den Rücksitzen von Uber-Limousinen ab, klare Linien, spiegelndes Glas, Leder und edle Hölzer. Zuhause ist man nur um ein paar Stunden zu schlafen, lebt in nahezu vollkommener Isolation von der Familie, von Freunden außerhalb der Hedgefund-Bubble oder Leuten mit nur durchschnittlichem Jahreseinkommen. Ähnlich wie schon in der ZDF-Serie "Bad Banks" habe ich als Ottonormalzuschauerin von dieser Welt im Detail nicht viel mehr verstanden, als dass permanent High-Stakes-Entscheidungen mit millionenschweren Konsequenzen getroffen werden müssen, manchmal mit einem Gewinn und manchmal mit einem Verlust als Resultat.

Die emotionalen, zwischenmenschlichen Konsequenzen sind dafür umso leichter zu verstehen. Zuerst bemüht sich Luke wirklich darum, alles richtig zu machen, ein guter Freund zu sein, nur gelegentlich kommt ihm ein selbstironischer Spruch über die Lippen. Später, wenn er und Emily über die Stadien der aufgesetzten Freude und passiven Aggressionen hinaus sind und zu verletzender Offenheit übergehen, erweckt das eigene Defizit den Arbeitsrechtler in ihm: Nun ist von Grenzen die Rede, die sie setzen müsse, von der Atmosphäre der Angst, die Campbell im Büro kultiviere, don't hate the player, hate the game. Damit hat er nicht einmal Unrecht. Bitter ist nur, dass er erst den Psychopathen in wirklich allen hier Beteiligten erkennt, als es längst zu spät ist.
Es ist nicht unbedingt überraschend, dass Domont in "Fair Play" die übliche Liste an Horrorthriller-Stilmitteln abhakt, um die Atmosphäre zuzuspitzen: Blutflecken, kleine Verletzungen, dissonante Streicher, unübersichtlich dunkle Zimmer und eine nervöse Kamera, die zuweilen an Emilys Rücken zu kleben scheint. Heraus sticht vor allem das sprichwörtliche Glashaus, die lediglich durch Fensterscheiben abgetrennten Einzelbüros der Führungsetage der Firma. Dahinter als einzige von sanftem natürlichen Licht bestrahlt und um Schreibtische und Besprechungssessel herum drapiert, wirken die Vorgesetzten ein bisschen wie die sorgsam angeordneten Figuren auf einem Vermeer-Gemälde.
Wie auf einem Bildschirm können die niederen Finanzanalysten so durch das Glas die gesamte Palette an Emotionen betrachten, derer Menschen unter immensem Druck fähig sind: Ein soeben Entlassener schluchzt jämmerlich, ein Anderer schlägt mit seinem Golfschläger den Monitor kurz und klein. Angezählte demütigen ihre Untergebenen und wenn nötig auch sich selbst, dazwischen Stolz, Panik, gelegentlich joviales Gelächter. Beinahe schön wirken sie alle, zumindest aber: auf eine künstlich entrückte Weise lebendiger, als die Fassade übermenschlich professioneller Normalität, die mit der Zeit von Luke und Emily abfällt.
Katrin Doerksen
Fair Play - USA 2023 - Regie: Chloe Domont - Darsteller: Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marsan, Rich Sommer, Sebastian de Souza - Laufzeit: 113 Minuten.
Kommentieren