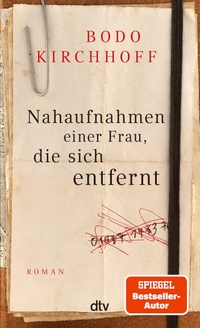Intervention
Mythos Kennedy
Von Richard Herzinger
05.06.2023. Vor bald sechzig Jahren besuchte John F. Kennedy Berlin und sprach seinen berühmten Satz: "Ich bin ein Berliner." Längst sind die dunklen Seiten Kennedys bekannt - und doch behält er als historische Figur seine Strahlkraft. Mehr denn je sind heute Führungsfiguren vom Schlage Kennedys vonnöten, die dieses vielfältig schillernde Potenzial der Demokratie mitreißend verkörpern.John F. Kennedys Besuch in West-Berlin vor sechzig Jahren, der zu einem Triumphzug wurde, markierte den Höhepunkt seines Ansehens als unbestrittener, strahlender Anführer und Hoffnungsträger der freien Welt. Mit seiner Ermordung nur knapp ein halbes Jahr später begann Kennedys Verklärung zur Lichtgestalt der freiheitlichen Demokratie schlechthin.
Inzwischen haben die Historiker jedoch auch die dunklen Seiten des ebenso charismatischen wie tragischen US-Präsidenten aufgedeckt. Das Sündenregister, das ihm vorgehalten wird, ist lang: Dass er in Wahrheit schwer krank und gebrechlich war, verbarg er vor der Öffentlichkeit systematisch hinter dem schönen Schein jugendlicher Vitalität. Weit davon entfernt, mit seiner glamourösen Traumfrau Jacqueline ("Jackie") eine harmonische Ehe zu führen, war Kennedy ein manischer Schürzenjäger, der sexuelle Eroberungen wie eine Trophäenjagd betrieb. Und seine Wahl zum Präsidenten verdankte er wohl auch undurchsichtigen Querverbindungen zur Mafia.
In der konkreten politischen Praxis war er durchaus nicht jener visionäre, zupackende Idealist, als der er sich gerne inszenierte, sondern eher ein machtbewusster Pragmatiker ohne tiefere Überzeugungen, der den Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassentrennung in den Südstaaten zunächst nur zögerlich unterstützte und die USA in den verhängnisvollen Vietnamkrieg verstrickte. In der Kubakrise 1962 agierte er nicht mit der souveränen staatsmännischen Entschlossenheit und strategischen Weitsicht, die ihm allgemein zugeschrieben wird. Dass die Welt damals vor dem Atomkrieg bewahrt wurde, verdankt sie eher einer glücklichen Fügung.
Doch all diese ernüchternden Erkenntnisse haben dem Mythos um John F. Kennedy nichts anhaben können. Sein Nimbus als strahlender Erneuerer der westlichen Welt bleibt ungebrochen - und dies nicht obwohl, sondern vermutlich gerade weil deutlich geworden ist, dass er ein fehlbarer Mensch mit gravierenden Schwächen und kein moralisch fleckenloser Tugendapostel war. Denn mit diesen seinen Fehlern, Mängeln und Ungereimtheiten personifiziert er umso mehr den Geist und das Wesen der modernen westlichen Demokratie.
Die Botschaft, für die der Kennedy-Mythos steht, lautet: Die pluralistische Demokratie ist jung, dynamisch und hat eine glänzende Zukunft, wenn sie nur an sich und ihre Werte glaubt - ungeachtet ihrer Unvollkommenheit, ihrer zahllosen Missstände, ihrer schmutzigen und unansehnlichen Seiten und düsteren Abgründe. Diese mag sie vor sich selbst und anderen zu verbergen versuchen, doch früher oder später kommt in einer offenen Gesellschaft auch die unangenehmste Wahrheit ans Licht. Die Demokratie ist nicht etwa deshalb stark, weil sie eine ideale Welt repräsentieren würde oder jemals herstellen könnte, sondern weil sie die einzige Staatsform ist, in der freie Menschen lernen können, mit allen Schrecken und Unzulänglichkeiten der realen Welt in Würde und Selbstverantwortung umzugehen. Und weil sie als einzige Staatsform die Chance bietet, die unvollkommene Realität Schritt für Schritt ein wenig besser, gerechter, kurz: erträglicher zu machen.
Kennedys inspirierende Präsenz und jugendlicher Charme vermittelten nicht nur den USA, sondern der gesamten freien Welt Zutrauen in ihre Stärke und Fähigkeit zur Regeneration. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der Totalitarismus in seiner kommunistischen Variante auf dem Vormarsch schien und der vermeintlich "dekadente" Westen darüber in Paranoia und Selbstzweifeln zu erstarren drohte. In dieser Lage vermittelten John F. Kennedy und seine weltgewandte Gattin die Gewissheit, dass die demokratische Zivilisation keineswegs zum Untergang verurteilt, sondern kraftvoll genug ist, nicht nur eine neue, unverbrauchte Führungsgeneration hervorzubringen, sondern auch ein auf den gesamten Globus ausstrahlendes Lebensgefühl, das dem grauen Kollektivismus ihrer Feinde jederzeit vorzuziehen ist.
Die Kennedys verliehen dem zuweilen verbissenen und teils ins Reaktionäre abgleitenden Antikommunismus ein frisches, optimistisches, liberales Gesicht und eine leichtfüßige, elegante Gestalt. "Jack" (wie die Kennedy nahe stehenden Personen ihn nannten) und Jackie signalisierten der Welt, dass die Demokratie nicht nur effektiv und wehrhaft sein muss, sondern auch sexy sein kann. Angesichts dieser enormen Symbolwirkung ist die Tatsache verblasst, dass Kennedys realpolitischen Erfolge eher bescheiden ausfielen. Während seine Reformbestrebungen zu Hause nur schleppend vorankamen, hat er alleine mit seiner berühmten Rede in Berlin im Juni 1963, die in dem legendären Ausruf: "Ich bin ein Berliner" gipfelte, ein Signal mit Ewigkeitswert gesetzt.
Dieser Satz brachte eine zeitlose universale Freiheitsbotschaft plastisch in eine anschauliche und eingängige Form. Kennedy lenkte damit den Blick der ganzen Welt auf das vom Kommunismus umzingelte westliche Berlin als den aktuellen Vorposten im Kampf der gesamten freien Menschheit um Würde und Selbstbestimmung. Wo immer sich Menschen gegen die scheinbare Übermacht der Unrechts auflehnen, so der Kern seiner Aussage, liegt sich das Zentrum der gesamten freien Welt. Die heutige Entsprechung zu diesem weltbürgerlichen Bekenntnis Kennedys würde lauten: "Ich bin ein Ukrainer".
Auch die moderne Demokratie braucht Mythen, durch die sie sich ihrer grundlegenden Bestimmung versichern kann. Im Mythos verdichten sich in fiktionaler Überhöhung Erinnerungen, Überlieferungen, Sehnsüchte, Träume, Ängste zu einem ebenso komplexen wie eingängigen kollektiven Selbstbild. Im Mythos Kennedy erkennt sich die demokratische Gesellschaft in ihrem Glanz ebenso wie in ihrer Tragik, in ihren gewaltigen Möglichkeiten wie in ihrer Beschränktheit und Endlichkeit, in ihren märchenhaften Errungenschaften wíe in ihren verhängnisvollen Irr- und Abwegen. Und mehr denn je sind heute Führungsfiguren vom Schlage Kennedys vonnöten, die dieses vielfältig schillernde Potenzial der Demokratie mitreißend verkörpern. Dass solche politische Persönlichkeiten in den etablierten Demokratien des Westens nicht in Sicht sind, könnte diesen zum Verhängnis werden.
Richard Herzinger
Der Autor arbeitet als Publizist in Berlin. Hier seine Seite "hold these truths". Wir übernehmen in lockerer Folge eine Kolumne, die Richard Herzinger für die ukrainische Zeitschrift Tyzhden schreibt. Hier der Link zur Originalkolumne.
Inzwischen haben die Historiker jedoch auch die dunklen Seiten des ebenso charismatischen wie tragischen US-Präsidenten aufgedeckt. Das Sündenregister, das ihm vorgehalten wird, ist lang: Dass er in Wahrheit schwer krank und gebrechlich war, verbarg er vor der Öffentlichkeit systematisch hinter dem schönen Schein jugendlicher Vitalität. Weit davon entfernt, mit seiner glamourösen Traumfrau Jacqueline ("Jackie") eine harmonische Ehe zu führen, war Kennedy ein manischer Schürzenjäger, der sexuelle Eroberungen wie eine Trophäenjagd betrieb. Und seine Wahl zum Präsidenten verdankte er wohl auch undurchsichtigen Querverbindungen zur Mafia.
In der konkreten politischen Praxis war er durchaus nicht jener visionäre, zupackende Idealist, als der er sich gerne inszenierte, sondern eher ein machtbewusster Pragmatiker ohne tiefere Überzeugungen, der den Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassentrennung in den Südstaaten zunächst nur zögerlich unterstützte und die USA in den verhängnisvollen Vietnamkrieg verstrickte. In der Kubakrise 1962 agierte er nicht mit der souveränen staatsmännischen Entschlossenheit und strategischen Weitsicht, die ihm allgemein zugeschrieben wird. Dass die Welt damals vor dem Atomkrieg bewahrt wurde, verdankt sie eher einer glücklichen Fügung.
Doch all diese ernüchternden Erkenntnisse haben dem Mythos um John F. Kennedy nichts anhaben können. Sein Nimbus als strahlender Erneuerer der westlichen Welt bleibt ungebrochen - und dies nicht obwohl, sondern vermutlich gerade weil deutlich geworden ist, dass er ein fehlbarer Mensch mit gravierenden Schwächen und kein moralisch fleckenloser Tugendapostel war. Denn mit diesen seinen Fehlern, Mängeln und Ungereimtheiten personifiziert er umso mehr den Geist und das Wesen der modernen westlichen Demokratie.
Die Botschaft, für die der Kennedy-Mythos steht, lautet: Die pluralistische Demokratie ist jung, dynamisch und hat eine glänzende Zukunft, wenn sie nur an sich und ihre Werte glaubt - ungeachtet ihrer Unvollkommenheit, ihrer zahllosen Missstände, ihrer schmutzigen und unansehnlichen Seiten und düsteren Abgründe. Diese mag sie vor sich selbst und anderen zu verbergen versuchen, doch früher oder später kommt in einer offenen Gesellschaft auch die unangenehmste Wahrheit ans Licht. Die Demokratie ist nicht etwa deshalb stark, weil sie eine ideale Welt repräsentieren würde oder jemals herstellen könnte, sondern weil sie die einzige Staatsform ist, in der freie Menschen lernen können, mit allen Schrecken und Unzulänglichkeiten der realen Welt in Würde und Selbstverantwortung umzugehen. Und weil sie als einzige Staatsform die Chance bietet, die unvollkommene Realität Schritt für Schritt ein wenig besser, gerechter, kurz: erträglicher zu machen.
Kennedys inspirierende Präsenz und jugendlicher Charme vermittelten nicht nur den USA, sondern der gesamten freien Welt Zutrauen in ihre Stärke und Fähigkeit zur Regeneration. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der Totalitarismus in seiner kommunistischen Variante auf dem Vormarsch schien und der vermeintlich "dekadente" Westen darüber in Paranoia und Selbstzweifeln zu erstarren drohte. In dieser Lage vermittelten John F. Kennedy und seine weltgewandte Gattin die Gewissheit, dass die demokratische Zivilisation keineswegs zum Untergang verurteilt, sondern kraftvoll genug ist, nicht nur eine neue, unverbrauchte Führungsgeneration hervorzubringen, sondern auch ein auf den gesamten Globus ausstrahlendes Lebensgefühl, das dem grauen Kollektivismus ihrer Feinde jederzeit vorzuziehen ist.
Die Kennedys verliehen dem zuweilen verbissenen und teils ins Reaktionäre abgleitenden Antikommunismus ein frisches, optimistisches, liberales Gesicht und eine leichtfüßige, elegante Gestalt. "Jack" (wie die Kennedy nahe stehenden Personen ihn nannten) und Jackie signalisierten der Welt, dass die Demokratie nicht nur effektiv und wehrhaft sein muss, sondern auch sexy sein kann. Angesichts dieser enormen Symbolwirkung ist die Tatsache verblasst, dass Kennedys realpolitischen Erfolge eher bescheiden ausfielen. Während seine Reformbestrebungen zu Hause nur schleppend vorankamen, hat er alleine mit seiner berühmten Rede in Berlin im Juni 1963, die in dem legendären Ausruf: "Ich bin ein Berliner" gipfelte, ein Signal mit Ewigkeitswert gesetzt.
Dieser Satz brachte eine zeitlose universale Freiheitsbotschaft plastisch in eine anschauliche und eingängige Form. Kennedy lenkte damit den Blick der ganzen Welt auf das vom Kommunismus umzingelte westliche Berlin als den aktuellen Vorposten im Kampf der gesamten freien Menschheit um Würde und Selbstbestimmung. Wo immer sich Menschen gegen die scheinbare Übermacht der Unrechts auflehnen, so der Kern seiner Aussage, liegt sich das Zentrum der gesamten freien Welt. Die heutige Entsprechung zu diesem weltbürgerlichen Bekenntnis Kennedys würde lauten: "Ich bin ein Ukrainer".
Auch die moderne Demokratie braucht Mythen, durch die sie sich ihrer grundlegenden Bestimmung versichern kann. Im Mythos verdichten sich in fiktionaler Überhöhung Erinnerungen, Überlieferungen, Sehnsüchte, Träume, Ängste zu einem ebenso komplexen wie eingängigen kollektiven Selbstbild. Im Mythos Kennedy erkennt sich die demokratische Gesellschaft in ihrem Glanz ebenso wie in ihrer Tragik, in ihren gewaltigen Möglichkeiten wie in ihrer Beschränktheit und Endlichkeit, in ihren märchenhaften Errungenschaften wíe in ihren verhängnisvollen Irr- und Abwegen. Und mehr denn je sind heute Führungsfiguren vom Schlage Kennedys vonnöten, die dieses vielfältig schillernde Potenzial der Demokratie mitreißend verkörpern. Dass solche politische Persönlichkeiten in den etablierten Demokratien des Westens nicht in Sicht sind, könnte diesen zum Verhängnis werden.
Richard Herzinger
Der Autor arbeitet als Publizist in Berlin. Hier seine Seite "hold these truths". Wir übernehmen in lockerer Folge eine Kolumne, die Richard Herzinger für die ukrainische Zeitschrift Tyzhden schreibt. Hier der Link zur Originalkolumne.
1 Kommentar