Gelegenheiten, sich schämen zu müssen
 Fotolot 13.03.2024 Mari Katayama, Laia Abril und Joanna Szproch formulieren - mit unterschiedlichen Erfolgen, auch bei Publikum und Kuratoren - drei relevante feministische Positionen in der aktuellen Fotografie. Bei manchen dieser Arbeiten fragt sich allerdings, ob sie ihr Potenzial, zum Denken anzuregen, nicht in anderen Räumen als denen der offiziellen Kunstrepräsentation besser entfalten könnten. Von Peter Truschner
Fotolot 13.03.2024 Mari Katayama, Laia Abril und Joanna Szproch formulieren - mit unterschiedlichen Erfolgen, auch bei Publikum und Kuratoren - drei relevante feministische Positionen in der aktuellen Fotografie. Bei manchen dieser Arbeiten fragt sich allerdings, ob sie ihr Potenzial, zum Denken anzuregen, nicht in anderen Räumen als denen der offiziellen Kunstrepräsentation besser entfalten könnten. Von Peter Truschner





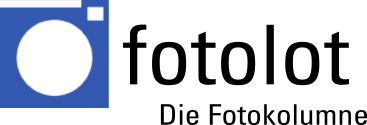
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e) Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Leila Slimani: Trag das Feuer weiter