Aufsaugen des Rauches
 Fotolot 28.10.2023 Wer war Erwin Quedenfeldt, ein Fotograf, der Apparate nutzte, um sich von Apparaten zu emanzipieren - und dessen Fotografien am Ende aussahen wie Gemälde? Irmgard Siebert hat über ihn eine interessante Studie vorgelegt, sieht ihn als Kontrahenten von Laszlo Moholy-Nagy , an den er am Ende - entgegen Sieberts Meinung - nicht heranreicht. Von Peter Truschner
Fotolot 28.10.2023 Wer war Erwin Quedenfeldt, ein Fotograf, der Apparate nutzte, um sich von Apparaten zu emanzipieren - und dessen Fotografien am Ende aussahen wie Gemälde? Irmgard Siebert hat über ihn eine interessante Studie vorgelegt, sieht ihn als Kontrahenten von Laszlo Moholy-Nagy , an den er am Ende - entgegen Sieberts Meinung - nicht heranreicht. Von Peter Truschner





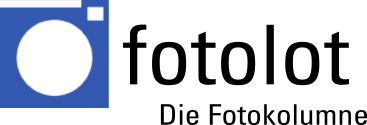
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e) Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Leila Slimani: Trag das Feuer weiter