BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Wolfram Lotz: Träume in Europa
Du sitzt im Taxi in Amsterdam, aber seltsamerweise musst du selbst fahren, während der Taxifahrer daneben sitzt. Ein Bekannter aus dem Internet umarmt dich zu Hause, du fühlst…
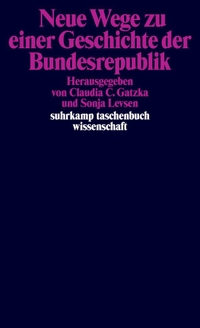
Claudia Gatzka (Hg.), Sonja Levsen (Hg.): Neue Wege zu einer Geschichte der Bundesrepublik
Lange erzählten Historiker der Bundesrepublik Geschichten von wachsendem Wohlstand, Modernisierung, erlernter Liberalität und stabiler Demokratie. Deutschland schien "im…
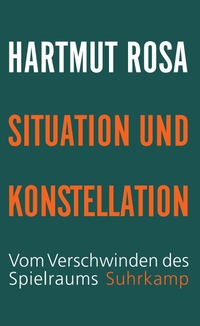
Hartmut Rosa: Situation und Konstellation
Die Lehrerin, die Noten nicht zur Ermutigung vergeben kann, die Ärztin, die Bildschirme statt Patienten behandelt, der Schiri, dessen Augenmaß vom VAR verdrängt wird: Unmerklich…

Antje Damm: Da ist besetzt!
"Guten Morgen! Ist da noch frei?", fragt Drache Flux den miesepetrigen Herrn Schröder. Und so beginnt eine zaghafte Annäherung, bei der Herr Schröder lernt, dass es nie zu…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier