BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Barbara Honigmann: Mischka
Eigentlich war es kein Kreis, eher ein Kosmos, ein Universum, das mich in meiner Kindheit und Jugend umstrahlte." Barbara Honigmann erzählt vom Leben und Überleben der Freunde…

Anatoli Kusnezow: Babyn Jar
Aus dem Russischen neu übersetzt von Christiane Körner. Mit einem Nachwort des Historikers Bert Hoppe, das die geschichtlichen Ereignisse nachzeichnet. Und einem Nachwort…

Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Mia, erfolgreiche Schriftstellerin in Paris, kämpft mit "brain fog", einem Gehirnnebel, der ihre Erinnerungen und ihre Arbeit beeinträchtigt.…
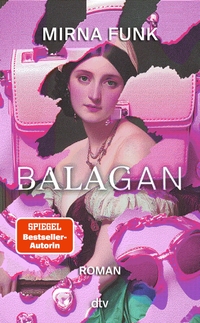
Mirna Funk: Balagan
Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 29.11.2023 […] Karsten Munt
Maestro - USA 2023 - Regie: Bradley Cooper - Darsteller: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Vincenzo Amato, Greg Hildreth, Michael Urie - Laufzeit: 129 Minuten. […] Von Karsten Munt
Im Kino 29.11.2023 […] Karsten Munt
Maestro - USA 2023 - Regie: Bradley Cooper - Darsteller: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Vincenzo Amato, Greg Hildreth, Michael Urie - Laufzeit: 129 Minuten. […] Von Karsten Munt