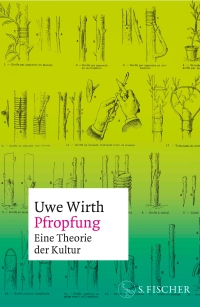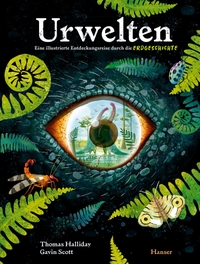Essay
Wie eine Nussschale
Von Thierry Chervel
10.03.2020. Vor zwanzig Jahren haben wir den Perlentaucher gegründet. Seitdem hat sich die Öffentlichkeit radikal verändert, und sie ist leider nicht nur besser geworden. Das Internet ist von gewaltigen Machtinteressen umstellt - und da es heute die Form der Öffentlichkeit ist, bedrohen diese Machtinteressen die Demokratie selbst. Es wäre Zeit, das Internet als ein "Common" zu begreifen.Dieser Essay erscheint einige Tage vor dem zwanzigsten Geburtstag des Perlentaucher am 15. März. Wir feiern den Geburtstag im Literaturhaus Berlin mit einem Podium zum Thema "Das Neue erzählen", mehr hier. D.Red.
=====================
Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt ist unbestritten eine Menschheitsaufgabe. Sie ist ein Common, ein Gemeingut. Ein Common ist immer auch, was alles andere ermöglicht. Ohne eine saubere Umwelt kann sich die Menschheit nicht weiterentwickeln. Ohne Luft kann sie nicht atmen. Ohne Straßennetz kann sie nicht wirtschaften.
Es ist Zeit, auch das Internet als ein "Common" zu begreifen. Ohne Internet kann die Öffentlichkeit nicht funktionieren. Das Internet ist nicht Teil, sondern heute die Form der Öffentlichkeit.
In Europa hat niemand auf das Internet gewartet. Viele der offenen Standards des Internets - Html, mp3, Linux - sind zwar in Europa erfunden worden. Aber die europäische Öffentlichkeit hatte bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht den blassesten Schimmer, welch ein Umbruch sie ergreifen würde.
Auch die Journalisten nicht, die angeblich immer die Nase im Wind haben. Als wir vor zwanzig Jahren mit dem Perlentaucher online gingen, waren wir allein auf weiter Flur. Außer ein paar Rentnern und Außenseiterinnen haben kaum Journalisten eigenständige Gründungen im Netz gewagt. Davon leben kann auch kaum einer.
Deutsche Journalisten haben das Internet im Grunde erst liebgewonnen, als sie auf Facebook und Twitter die altgewohnten Blasen replizieren konnten. Nicht wenige prominente Journalisten gehören in den sozialen Medien inzwischen zu den Wortführern. Twitter ist längst nicht mehr der bunte Neuigkeitenstrom, der es mal war, sondern eine permanente Caféhaus-Schlägerei. Hier werden informelle Hierarchien austariert, es geht um Deutungshoheit und Wortführerschaft. Journalisten haben das Internet maßgeblich zum schlechteren verändert. Zugleich sind aber die traditionellen Medien die Zentralorgane jener Kulturkritik am Internet, die die Debatte in Deutschland und dem alten Europa dominiert.
Die Internetexperten der Leitmedien heißen Jaron Lanier (der alles andere als ein "Internetpionier" ist, mehr hier), Shoshana Zuboff, Evgeni Morozov, Adrian Lobe. Ihnen allen gemein ist ein fast apokalyptischer Ton, wenn sie über Entwicklungen im Netz sprechen. Mit ihrer Kritik an Google, Amazon und Facebook haben sie oft recht. Aber sie ziehen den ganzen Rest sehr gern mit runter. Vor allem entwickeln sie keinerlei Idee eines offenen Netzes. Pioniere dieser Idee wie Richard Stallman, Yochai Benkler oder Lewis Hyde sind in Deutschland nahezu unbekannt.
Lanier hatte die Wikipedia - das vornehmste Sinnbild der Idee der Offenheit im Netz - einst "digitalen Maoismus" genannt. Als Alternative setzen sie - aus einem möglicherweise ehrenwerten sozialdemokratischen Impuls - meist auf den Staat als übergeordnete Instanz der Regulierung. Um sich klarzumachen, wie dubios die Idee einer staatlichen Überwachung des "Überwachungskapitalismus" ist, muss man nur nach China, Iran oder Russland blicken.
Dass die sozialen Medien - vor allem Facebook - dazu beigetragen haben, die Öffentlichkeit zu verderben, steht außer Frage. Sie spülen nach oben, was an Hass und Verachtung bisher eher im Verborgenen zirkulierte. Durch ihre Algorithmen verstärken sie diese bösen Leidenschaften noch. Sie sind wie Crack, ein gestrecktes, aufgeschäumtes und kristallisiertes Kokain, das den Urstoff noch giftiger macht. Besonders Facebook hat ein kapillares System entwickelt, um dieses algorithmenverstärkte Gift genau dorthin zu lenken, wo es am besten wirkt. Die aktive Kooperation des Konzerns mit Agenturen wie Cambridge Analytica, die Manipulation von Wahlen im Sinne von Trump, Brexit oder Autokraten in weit entfernten Ländern wirkt im Nachhinein wie eine Vivisektion an der demokratischen Öffentlichkeit. Zauberlehrling Zuckerberg ist seitdem zurückgerudert, aber die Gefahr ist nach wie vor akut.
Natürlich müssen demokratische Staaten mit Gesetzen in diese Prozesse hineinwirken, Selbstverpflichtungen der Konzerne reichen nicht aus und haben bisher nicht genug Wirkung gezeigt. Aber staatliche Regulierungen von Öffentlichkeit sind immer auch prekär. Besser wäre eine funktionierende und sanktionierende Öffentlichkeit selbst.
Dabei sollte klar sein, dass die demokratische Öffentlichkeit noch nie ein Rosengarten war. In ihr agieren mächtige Interessengruppen, die gern ihre Sicht auf die Dinge einhegen oder durchsetzen wollen. Das Beleidigtsein darf nicht zum Kriterium werden. In den zwanzig Jahren, die sich der Perlentaucher im Internet tummelt, ist mir klar geworden, dass es Höheres gibt als verletzte Gefühle: Die Mohammed-Karikaturen wurden von den meisten Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien nicht gezeigt, zumindest nicht, als die Debatte tobte. Erst im Internet konnte sich das Publikum kundig machen. Darum sind Facebook wie auch das Internet gegen die "dezente Mode" heutiger Kulturkritik auch zu schützen. Es muss scheppern dürfen, und zwar kräftig. Über den frommen Gefühlen der Islam-Funktionäre und ihrer linken WeggenossInnen, über dem Beleidigtsein von AfD-Mimöschen, die dann um so böser treten, steht die Meinungsfreiheit.
Der libertäre Impuls
Es stimmt schon: Im Internet steckt immer schon so etwas wie eine Revolte gegen die Institutionen. In Amerika gibt es ja nicht nur einen rechten, sondern auch einen linken Libertarismus. Die Idee, Individuen zu einer neuen Öffentlichkeit ohne Zutrittsbarrieren zu vernetzen, richtete sich von Anfang sowohl gegen den Staat als auch gegen Konglomerate wie Microsoft, die für eine totale Machtergreifung über den Code standen - und stehen. Lanier war Microsoft-Ingenieur und repräsentiert diese Praxis und nicht das frühe Internet. Kein Wunder also, dass der Börsenverein des Buchhandels ihn mit dem Friedenspreis auszeichnet. Mir wäre Tim Berners-Lee lieber gewesen!
Allzu viele libertäre Revolten gegen das Establishment sind aus der Geschichte des deutschen Internets nicht überliefert. Eine Affäre ließe sich aber so einordnen und hat zumindest das Verhältnis der deutschen Medien zum Internet geprägt - die Plagiatsaffäre Guttenberg im Jahr 2011. Die Affäre hatte auch deshalb eine symbolische Seite, weil Karl-Theodor zu Guttenberg im langen Defilee der potenziellen Merkel-Killer ein absoluter Mediendarling war. Guttenberg war der Inbegriff des kommenden Manns. Die Diskussion um Guttenbergs Doktorarbeit war zwar durch einen SZ-Artikel angestoßen worden, gewann ihre Dynamik aber erst durch das "GuttenplagWiki", das laut Wikipedia am Ende auf 82 Prozent aller Seiten Plagiate gefunden hatte. Die Affäre zeigte, dass im Internet nicht nur Fake News und Hass, sondern auch Wahrheit produziert werden. Und sie erwischte die auf ihre personalpolitischen Inszenierungen fixierte Hauptstadtpresse auf dem linken Fuß - dieser Abgang stand nicht auf ihrer Agenda.
Aber die Antwort der "vierten Gewalt" folgte schnell und war noch um einiges brutaler als die Guttenberg-Affäre. Meiner Meinung nach wollte eine verstörte Presse mit der "Wulff-Affäre" zeigen, wo der Hammer hängt. Die Jagd auf Christian und Bettina Wulff wurde in den Stuben der Chefredakteure beschlossen und hatte mit dem Internet bis auf die übliche Begleitmusik in den stärker werdenden sozialen Medien nicht viel zu tun. Bei sehr vielen Beteiligten hinterließ sie am Ende einen schalen Nachgeschmack. Im Wikipedia-Artikel zur Affäre scheint es, als sei vor allem die Bild-Zeitung die treibende Kraft gewesen. Aber selbst wenn es zutrifft, dass die Bild nach wie vor das größte Zerstörungspotenzial für Politikerkarrieren hat, ist meine Erinnerung an die Affäre anders: eigentlich waren so gut wie alle Medien beteiligt.
Für mich markiert die Wulff-Affäre in Deutschland den Moment eines symbolischen Rollbacks. Die klassischen Medien mögen durch den digitalen Wandel zerrupft dastehen, im Spiel mit den ebenfalls geschwächten Institutionen und der politische Sphäre sind sie aber nach wie vor entscheidende Instanzen - und haben es der Politik gezeigt. Politiker bekundeten danach ihre Verbundenheit, indem sie bei wichtigen politischen Entscheidungen wie etwa der europäischen Reform des Urheberrechts brav der Lobbymacht der klassischen Medienindustrien nachgaben: Bei Leistungsschutzrechten, Uploadfiltern und Verlegerbeteiligung entschieden sie stets gegen Google oder Facebook und, wichtiger noch, gegen die Interessen des Publikums und pro Springer und Warner Brothers. Diese Sätze kann man übrigens nur in Internetmedien wie Netzpolitik, Perlentaucher oder Übermedien sagen - in einer Zeitung habe ich diesen Standpunkt noch nie gelesen. Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurde über dieses Thema so gut wie gar nicht diskutiert.
Die Wulff-Affäre war harmlos verglichen mit Ereignissen, die mit der Wucht einer Panzerarmee anrollten, und die ebenfalls maßgeblich von klassischen Medien orchestriert wurden: Donald Trump mag zwar über Twitter direkt mit seinen Anhängern kommunizieren, zunächst aber war er ein Mann des Fernsehens. Was wäre Trump ohne Rupert Murdurchs Fox Broadcasting Company? Und wo wäre Boris Johnson ohne den Telegraph, die Sun und die Daily Mail?
Dass sich in Ländern wie Ungarn und Polen Populisten durchsetzten, dass Wladimir Putin zum Idol linker und rechter Systemkritiker wurde, dass sich in Amerika Trump und in Britannien der Brexit durchsetzte, ist also keineswegs allein dem Medienwandel zuzuschreiben. Klassische Medien, die neue Rollenmodelle für sich suchen, waren zentrale Agenturen dieser Brüche. Dort, wo öffentlich-rechtliche Medien schlecht gegen die Ansprüche der politische Sphäre abgesichert waren, wurden sie ebenfalls zu Megafonen dieses Bruchs. Auch Zeitungen lassen sich gleichschalten oder werden abgeschafft, wie Ungarn und die Türkei zeigen.
Das Internet ist heute ein öffentlicher Raum, der vom Zugriff gewaltiger Machtinteressen bedroht ist. Gegen drei Tendenzen müsste sich eine Öffentlichkeit, die ein offenes Internet als Common betrachtet, wehren:
- die Monopolmacht von gigantischen Konzernen wie Google und Facebook, die zugleich neue Allianzen mit den alten Medienindustrien suchen.
- den Übergriff autokratischer Regimes wie Russland, China und Iran auf die westlichen Öffentlicheiten.
- die totale Verrechtlichung des Netzes und der breiteren Öffentlichkeit vor allem in den noch funktionierenden Demokratien.
Alle drei Punkte verdienen ganze Abhandlungen, ja Forschungsinstitute und können hier nur skizzenhaft angerissen werden.
1. Google, Facebook, die Medien und die Macht
Google und Facebook (auch Amazon, Ebay und andere) haben im Internet Plattformen geschaffen, die heute die Öffentlichkeit weithin prägen und strukturieren. Google Maps legt sich über die Welt wie eine Karte im Maßstab 1 zu 1. Gegen den Überwachungskapitalismus dieser Konzerne hat sich eine ganze Industrie kulturkritischen Klagens entwickelt, die heute die Diskussion über das Internet in den seriöseren Medien dominiert. Ich empfinde den Diskurs der Mozorovs und Laniers, bei allen Punkte, die sie machen, über weite Strecken als heuchlerisch, vor allem weil sie die Idee der offenen Standards verhöhnen, die meiner Meinung nach als einzige einen Weg aus der Vermachtung des Netzes weist.
Meist verkennt die Kritik an Google und Facebook auch das Votum des Publikums: Sie sind auch mächtig, weil sie - was man bedauern kann! - nützlich sind. Sie haben ein Potenzial erkannt, das andere Institutionen aus Ignoranz und Arroganz brachliegen ließen. Es ist halt praktisch, wenn in Google Maps die Fahrzeiten der Busse in Echtzeit angezeigt werden. Und Google arbeitet mit Sicherheit daran , dass man mit dem Handy demnächst automatisch bezahlt, wenn man in diesen Bus einsteigt. Man mag über den Überwachungskapitalismus, der darin liegt, klagen, das Dumme ist aber, dass die Städte und ihre Verkehrsbetriebe offenbar nicht selbst auf die Idee gekommen sind, ihre Dienste zu vernetzen und zum Beispiel mit Open Maps zusammenzuarbeiten. Stattdessen hat jeder Betrieb seine eigene App erstellen lassen, die genau an der Stadtgrenze endet. Stefan Laurin hat einmal bei den Salonkolumnisten das Gewirrr des öffentlichen Nahverkehrs im Ruhrgebiet beschrieben: Es hängen wohl auch zu viele Interessen dran, zu viele gut bezahlte Posten für zu viele Chefs von Verkehrsbetrieben.
Öffentliche Dienste begreifen sich eben allzu häufig nicht als "Common", sondern als Behörde, die den Bürgern vorgesetzt wird. Wäre es nicht die verdammte Pflicht gerade großer öffentlicher Institutionen wie etwa der EU gewesen, sich für offene Standards einzusetzen? Der ehemalige Microsoft-Ingenieur Jaron Lanier wird sicher nicht dagegen protestieren, dass so gut wie aller öffentliche Dienst in Europa von Microsoft-Programmen abhängt. Statt dass, von der EU ausgehend, öffentliche Institutionen die Entwicklung von auf Linux basierenden Alternativen vorantreiben, haben sie auch hier dem Lobbydruck nachgegeben. Harald Schumann hat darüber vor zwei Jahren eine beeindruckende Dokumentation gedreht. Die Milliarden, die Microsoft verdient, sind großenteils Gelder, die der Steuerzahler für Lizengebühren entrichten muss.
Google und Facebook kapern die Öffentlichkeit auf andere Weise. Ihr System ist kapillarer und darum schwerer einzuhegen, obwohl die EU mit einigen Bußgeldern durchaus gezeigt hat, dass sie die Konzerne in die Schranken weisen kann. Google und Facebook organisieren heute im wesentlichen den Anzeigenmarkt - Milliarden Dollar Quartal um Quartal, die den klassischen Medien längst abhanden gekommen sind. Die privat finanzierten Medien haben auf den Verlust ihres Geschäftsmodells im Internet schließlich mit Zahlschranken reagiert. Zuvor hatten sie feststellen müssen, dass sie sich über Werbung nicht finanzieren können. Das Netz ist dadurch um einiges steriler geworden, das Publikum wird noch weiter in die Arme von Google und Facebook getrieben, denn dort kann man kostenlos an der Debatte teilnehmen. In Frankreich etwa gibt es kein Medium mehr ohne Zahlschranke. Und die Internetmedien, die mal die Szenerie aufmischten wie rue89 oder slate.fr sind entweder von Medienkonzernen aufgekauft oder nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Auch in Amerika mussten Internetmedien wie Buzzfeed empfindliche Kürzungen hinnehmen.
Ein, zwei Medien mag der informationshungrige Nutzer am Ende abonnieren. Gerade beim qualifizierten Publikum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um englischsprachige Medien handelt. Die New York Times ist in Europa für 4 Dollar monatlich zu haben, die FAZ kostet digital 46,90 Euro monatlich. Gerade im Moment ihres Auflagen-, Einfluss- und Einnahmeverlustes errichten die Medien Schranken, obwohl in einer vernetzten Welt die Identifikation mit einer einzelnen Quelle ebenfalls eher abnimmt. Man abonniert nicht Le Point, um dann L'Express zu abonnieren, damit man eine Reaktion auf den Nouvel Obs lesen kann. Die Fragmentierung unterhöhlt das Potenzial des Netzes, gibt populistischen Stimmen mehr Raum und schwächt die Medien ein weiteres mal. Auch hier ist es den vereinzelten Akteuren nicht gelungen, einen Standard zu entwickeln, um ein medienübergreifendes Abonnement zu ermöglichen, trotz einiger Ansätze wie Blendle.
Diese Schwächung und Vereinzelung machen es Google und Facebook noch leichter, die Öffentlichkeit zu kapern. Beide setzen auf Medien-Kooperationen, die Hunderte von Millionen Euro schwer sind. Und sie helfen damit, die überkommenen Hierarchien der alten Medienlandschaft neu zu betonieren, wie der Autor und Medientheoretiker Dan Hind aus sehr linker, aber lesenswerter Perspektive in einem Essay für Eurozine feststellt. Medien wie die New York Times, das Wall Street Journal und ihre Entsprechungen in Europa werden eine privilegierte, von den Plattformkonzernen subventionierte und durch Beteiligung an Werbeeinnahmen attraktive Platzierung in diesen Plattformen bekommen. "Facebook ist da sehr offen, Google diskreter. Sie stellen die alte Trennung zwischen dem Mainstream und den Rändern wieder her, die das Vor-Internet-Zeitalter prägte. Eine kleine Handvoll Unternehmen wird die News und Inhalte liefern, zu denen das Publikum regelmäßig durch das Internet Zugang erhält. Ein bunter Rand kleinerer Akteure wird in verschiedenen Formen überleben. Aber sie bekommen keine Anzeigeneinnahmen und werden Schwierigkeiten haben, Abonnenten zu finden".
Eine Wiederherstellung der alten Machtverhältnisse unter neuen Vorzeichen also - allerdings müssen die Medien akzeptieren, dass ihre Paten Google und Facebook heißen. Schon jetzt fällt auf, dass Google und Facebook zu den wenigen Playern gehören, die die Zeitungen noch regelmäßig mit ganzseitigen Anzeigen beglücken, auch eine Form der Subventionierung und gleichzeitig Adressierung der Politiker, für die die Zeitungen noch maßgeblich sind, um ihre Machtpositionen auszutarieren. Printanzeigenpreise in überregionalen Zeitungen sind exorbitant. Die Zeitungen mussten auch deshalb ihren Umfang reduzieren und ihre Preise erhöhen, weil sich das Format als obsolet erwiesen hat. Wer heute noch in Zeitungen ganzseitige Anzeigen schaltet, tut dies häufig aus politischen Gründen. Niemals kämen Google oder Facebook auf die Idee, ähnliche Preise im Internet zu bezahlen.
Eine Subventionierung der Medien durch Facebook und Google wird die freie Berichterstattung über die Macht dieser Konzerne sicher nicht befördern. Hind macht aber auch darauf aufmerksam, dass die "Legacy Media" keineswegs immer gegen Fake News immun sind. "Von der Invasion im Irak bis zur Finanzkrise haben die großen Medien immer wieder gezeigt, dass sie sich manipulieren ließen und der Einschüchterung mächtiger Akteure in Staat und Wirtschaft erlagen. Und sie haben Themen von großer Wichtigkeit falsch dargestellt, wenn die Wahrheit ihre Anzeigen- oder Lizenzeinnahmen gefährdete."
Leider hat Hind hier recht. In der Debatte um die europäische Urheberrechtsreform und um Leistungsschutzrechte für Presseverleger zeigte sich, dass auch seriöse Zeitungen keinerlei Skrupel haben, extrem tendenziös zu berichten, wenn ihre Interessen berührt sind. Das gleiche gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn es um ihre Gebühren und ihren Status geht. Was heute Öffentlichkeit ist, kann nicht mehr durch den Burgfrieden dieser Großmassive ausgemacht werden. Erst im Internet wird sie komplett, und im Grunde ist das Internet - auch wenn nicht alles zugänglich ist - das Biotop, das man heute überhaupt erst Öffentlichkeit nennen kann.
2. Der Zugriff der Autokratien
Zeitungen gehören heute oft Milliardären und Oligarchen. Auch auf Deutschland hat das Phänomen übergegriffen, als Holger und Silke Friedrich die Berliner Zeitung kauften und als erstes Egon Krenz für den Mauerfall dankten. Boris Johnson verbringt gern mal ein Wochenende in der Villa seines Freunds Alexander Lebedew, eines (mal wieder) in London ansässigen Oligarchen, dem zusammen mit seinem Sohn Jewgeni der Independent und der Evening Standard gehören. Um fair zu sein: Er hat laut Wikipedia auch Anteile an der regimekritischen russischen Zeitung Nowaja Gaseta, der einstigen Zeitung Anna Politkowskajas. Aber er war auch KGB-Spion und setzte sich für die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland ein. Boris Johnson zeigte sich am Tag nach seinem Wahlsieg bei der Party zu Lebedews 60. Geburtstag in dessen Londoner Villa. Lebedews Evening Standard hatte für Johnson getrommelt (während der Independent eher kritisch ist). Den "Russlandbericht" des Geheimdienstausschusses im britischen Parlament, der russische Einflussnahme auf die britische Politik untersucht, hält Johnson bis heute zurück, berichtet Luke Harding im Guardian.
Auch Jeremy Corbyn war übrigens zu der Party eingeladen, ist aber nicht erschienen. Dafür äußerte er sich gern ab und zu im iranischen Press TV, wo er bis zu 20.000 Pfund Honorar erhalten haben soll (mehr hier ).
In Frankreich hatte der junge Milliardär Alexandre Pougatchev schon 2009 die einstige Boulevardzeitung France Soir gekauft, die heute nur noch online erscheint und ein Schatten ihrer selbst ist.
Aber es gibt andere Medien, mit denen Russland Einfluss nimmt. RT France ist das Zentralorgan der Gilets jaunes. Romain Bornstein erzählt in der französischen Ausgabe der Vanity Fair, wie die Journalisten in dem Sender gleichgeschaltet werden und zu bloßen Sprachrohren eines von oben gesteuerten Systems umfunktioniert. Viele RT-Journalisten haben sich ihm unter der Bedingung der Anonymität geöffnet. "Je mehr ich ihren Ausführungen zuhörte, desto mehr zeichnete sich mir ein nie dagewesenes, zugleich faszinierendes und erschreckendes System ab, wo eine 'Information' nur Wert hat, wenn sie Empörung auslöst und sich wie ein Raketenschweif durch die sozialen Netze bewegen kann." RT France wurde bald zum populärsten Medium der Gilets jaunes. Wer "Gilets jaunes violence " eingebe, "dem schlägt Google drei Videos von RT France innerhalb der ersten fünf vor. Die Titel: 'Polizeigewalt - Gilet jaune verstümmelt, um ein Exempel zu statuieren', 'Straßburg, Zusammenstöße zwischen Gilets jaunes und Polizisten' oder 'Fünf Hiebe mit dem Knüppel, zehn Tage Arbeitsunfähigkeit, ein Gilet jaune spricht über Polizeigewalt'".
Wie bei den Gilets jaunes selbst, ist es bei RT France eigentlich ganz egal, ob der Hass aufs "System" von ganz rechts oder ganz links kommt. Jean-Luc Mélenchons "Unbeugsames Frankreich" äußert sich sehr gern auf RT France. Ein junger brillanter Vertrauter von Mélenchon, Andréa Kotarac, wurde besonders häufig eingeladen. Heute kandidiert er in Lyon für Mélenchons rechte Konkurrentin Marine Le Pen vom Rassemblement national. Verbindendes Element: der Hass auf Emmanuel Macron.
RT France zeigt, dass Fake News, für die immer wieder "das Netz" verantwortlich gemacht wird, oft ganz klare Fabrikationen sind und ganz klaren Interessen dienen.
Das chinesische Beispiel ist fast noch unheimlicher, denn China ist konkurrenzfähig und gerade für Deutschland der wichtigste aller Märkte. Gegen China wirkt Putin wie ein Giftzwerg. Das Ausmaß des chinesischen Einflusses lässt sich gewissermaßen umgekehrt proportional an der Absenz des Dalai Lama ermessen, der früher überall so gern empfangen wurde. Wer denkt heute noch an Liu Xiaobo, dessen Asche das Regime im Meer verstreute, um keinen Gedenkort entstehen zu lassen? Liu Xia, seine Frau, ist heute in Berlin und verstummt. Die Misshandlung der Uiguren durch die chinesische Zentralregierung wird von westlichen Regierungen kaum mehr benannt, während Medien hier, oft international vernetzt, zum Glück gute Arbeit machen. Hinzu kommt die fieberhafte Entwicklung neuer Überwachungstechnologien, deren Einsatz bald auch in westlichen Ländern droht.
Über die Russophilie in Deutschland muss man kein Wort verlieren. Allein die Thüringer Ereignisse haben gezeigt, das einer immer gewinnt: Wladimir Putin. AfD: "Die Drohgebärden gegen Russland müssen ein Ende haben!" CDU Thüringen: "Mohring für Abbau der Russland-Sanktionen." Die Linke Thüringen: "Auch Ramelow für Ende der Russland-Sanktionen."
Gegen diese Tendenzen hilft in den westlichen Ländern nur eine starke und möglichst vielgestaltige Öffentlichkeit mit sämtlichen Akteuren: den öffentlich-rechtlichen, denen man aber die Öffentlichkeit nicht angesichts der Schwäche der Privatmedien völlig überlassen sollte, den Privatmedien, die aber bei vielen Themen selbst ein Machtfaktor sind und kritische Begleitung verdienen, und also auch diesem wabernden riesigen Ding namens Internet, in dem die Informationen so frei und so verifizierbar wie möglich zirkulieren sollten.
3. Verrechtlichung
Diese freie Zirkulation wird aber immer schwieriger, nicht nur wegen der Paywalls. Schlimmer wirkt sich aus, dass die Kulturindustrien nach der Krise ihrer ursprünglichen Geschäftsmodelle immer mehr auf Einnahmen setzen, die bislang sekundär waren - immer mehr verhindern Urheberrechte, die Monopolisierung von Werken durch riesige Konzerne und Leistungsschutzrechte die Auseinandersetzung mit Kultur und Information.
Getty Images besitzt Milliarden Bilder - auch solche, die gemeinfrei sind - und beansprucht Rechte daran. 2016 ging der Fall der Fotografin Carol Highsmith durch die Medien, die ihre Fotos der Library of Congress überließ und sie offen nutzen lassen wollte - und dann feststellte, dass Getty Images aus eben diesen Bildern Lizenzeinnahmen erzielte. Ihre Klage gegen Getty Images fiel in sich zusammen. Was Getty unter juristisch raffinierter Ausnutzung verschiedener internationaler Copyrightsysteme macht, ist rechtens. Getty Images vermarktet außerhalb Chinas auch die Bilder der Corbis Agentur, nachdem Bill Gates die Agentur an die Visual China Group verkauft hatte. Zu den gigantischen Sammlungen von Corbis und Getty Images gehören Millionen historischer Bilder, die man heute oft mit Copyright-Verweis auf Getty Images abgebildet sieht. Viele davon lassen sich zwar für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos einbetten - aber: definiere "nicht kommerziell":
Sucht man bei Getty Images zum Beispiel nach "Rubens", findet man einen Stich von 1833, der längst rechtefrei ist, und daneben Preisangaben von 50 Euro bis 475 Euro und die rätselhafte Erläuterung: "Alle Lizenzen für lizenzfreie Inhalte beinhalten weltweite Nutzungsrechte, umfangreichen Schutz und eine einfache Preisgestaltung mit Mengenrabatten." Lizenzen für lizenzfreie Inhalte?
Die Verwerterindustrien haben sich auch in vielen anderen Bereichen durchgesetzt, so etwa die drei Majors der Musikindustrie, die das Europäische Parlament im Jahr 2012 dazu brachten, die Schutzfristen auf Tonaufnahmen von fünfzig auf siebzig Jahre zu verlängern. Besonders für berühmte Aufnahmen klassischer Musik, die ihre große Zeit nach der Erfindung der Langspielplatte hatten, ist das eine tragische Fristverlängerung. Man hätte sich etwa vorstellen können, solche Aufnahmen in der Wikipedia zu den Artikel über die Werke oder die Interpreten zu stellen.
"Spürbar wird die Verlängerung nicht so sehr bei Aufnahmen von Werken sein, die immer noch urheberrechtlich geschützt sind, wohl aber bei Aufnahmen gemeinfreier Werke und bei solchen Aufnahmen, die ganz andere Dinge als Werke enthalten (wie Gespräche, Geräusche, Samples)", schrieb John Hendrik Weitzmann 2012 bei irights.info. "Als Kollateralschaden werden auch die wirtschaftlich wenig interessanten und gar nicht mehr im Markt befindlichen Aufnahmen für weitere Jahrzehnte blockiert. Das führt nicht nur zu einer Verfügbarkeitslücke dieser Aufnahmen, sondern behindert auch massiv die Überführung historischer Aufnahmen in digitale Form." In der Presse hat dieses Thema damals nicht den geringsten Widerhall gefunden.
Zeitungen möchten sich künftig auch Überschriften à la "Bayern München siegt mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt" lizenzieren lassen. FAZ-Medienredakteur Michael Hanfeld betonte neulich noch mal, dass er nicht mal ein briefmarkengroßes zitiertes Bild neben einer solchen Aussage stehen haben möchte, ohne dass Suchmaschinen und wer weiß noch alles dafür zahlen. Das "wer weiß noch alles" könnte jeden Blogger betreffen. Die bloße Drohung mit Prozessen reicht ja meistens aus, um kleinere Akteure abzuschrecken.
Die Bundesregierung versucht gerade, das europäische Leistungsschutzrecht für Deutschland umzusetzen, nachdem die deutsche Version, die ihre Vorgänger den Verlegern vor der letzten Bundestagswahlen geschenkt hatten, so gefloppt war. 28 mal 28 Pixel sollen Bilder nach dem Vorschlag, der Hanfeld so empört, groß sein dürfen. Überhaupt Bildrechte. Bilder können ja gar nicht "zitiert" werden. Die kleinste illustrative Abbildung ist kostenpflichtig. Ein befreundeter Autor, der ein Buch über die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts geschrieben hat - die liegen bekanntlich fast hundert Jahre zurück! - erhielt von der VG Bildkunst einen Kostenvoranschlag von 9.000 Euro, weil er ein paar Bauhaus-Möbel zeigen wollte. Irgendwo sitzen immer Erben, die sich ihre Rente aufbessern wollen. Wolfgang Ullrich hat im Perlentaucher gezeigt, dass bekannte Maler und Fotografen ihre Bildrechte inzwischen nutzen, um die Berichterstattung über sich zu steuern. Wer nicht genehm ist, bekommt keine Genehmigung, oder nur zu Bedingungen, die für den Autor nicht akzeptabel sind.
Das Urheberrecht mit seinen absurden Schutzfristen von siebzig Jahren nach dem Tod des Autors verhindert ohnehin schon eine den digitalen Zeiten angemessene Rezeption kultureller Inhalte. Es wird ja viel gespottet über die Demokratisierungshoffnungen, die anfangs mit dem Internet verbunden waren, aber immerhin ermöglicht es auch Zugang an Orten, wo nicht eine Bibliothek oder eine Videothek mit Filmklassikern um die Ecke steht. Schutzfristen von siebzig Jahren nützen wenigen Erben bekannter Urheber und ihren Verlegern und Repräsentanten. Für die große Masse der Autoren bedeuten sie den zweiten Tod, weil sie die Rezeption erschweren. Aber auch berühmte Autoren können wegen der Urheberrechte einen zweiten Tod sterben - Bertolt Brecht ist ein Beispiel, dessen Erben bei Neuinszenierungen so dogmatisch agierten, dass die Theater von ihm abließen. Erst ab 2027, wenn die Rechte an Brecht ausgelaufen sind, könnte eine Brecht-Renaissance einsetzen. Oskar Schlemmers Werk war jahrelang nicht zu sehen, weil die Erben zerstritten waren (mehr hier). Es gibt viele Beispiele dafür, dass eine Rezeption erst nach Ablauf der Rechte einsetzte. Der Gustav-Mahler-Boom der sechziger und siebziger Jahre ist eines: Mahler war 1911 gestorben. Damals lagen die Fristen noch bei fünfzig Jahren. Und Wiederauferstehungen kann man natürlich nicht garantieren. Bei Schlemmer gab es nur ein kurzes Flackern. Ob Brechts Leiche wiederbelebt werden kann? Ob in fünfzig oder hundert Jahren sich irgendjemand wieder für die Filme von Hawks, Antonioni oder Truffaut interessiert?
Der verlorenen Sichtbarkeit von Kultur entspricht die Alterung des Publikums und ihr Prestigeverlust. Es erscheinen ja nicht weniger Bücher, mag man einwenden. Aber als wir mit dem Perlentaucher anfingen, haben wir 800 Buchkritiken der Zeit jährlich resümiert, jetzt sind es noch 220. Die Zeit ist deshalb ein gutes Beispiel, weil sie mit ihrer moralischen Wellnessmischung so reüssiert. Sie gehört zu den wenigen Medien, deren Auflage noch steigt. Dass das Feuilleton in den letzten zwanzig Jahren so gestutzt wurde, hat also offenbar keine ökonomischen Gründe. Dafür sind feuilletonähnliche neue Ressorts wie "Glauben & Zweifeln", "Wissen", "Streit" aus dem Boden gestampft worden.
Die Schätze der europäischen Kultur des 20. Jahrhunderts sind großenteils versteckt und können aus rechtlichen Gründen nicht geborgen werden. Die Archive der öffentlich-rechtlichen Sender sind fürs Publikum so gut wie unzugänglich. In den Mediatheken zirkuliert ja nur das Neueste mit Fristen von sieben Tagen bis zu einem Jahr. Die dreistündige Radiosendung Theodor W. Adornos über "schöne Stellen" aber bleibt unzugänglich. Das Radio war in den fünfziger und sechziger Jahren fast mehr als die Zeitungen der Ort der Intellektuellen und experimenteller Künstler. Wer weiß das heute noch? Und wie ist es eigentlich mit all den Aufnahmen all der öffentlich finanzierten Rundfunkorchester? Müssten sie nicht, auch rechtlich öffentlich, ein "Common" sein (sofern es sich um Aufnahmen gemeinfreier Werke handelt)? Gibt es bei den Sendern überhaupt ein Bewusstsein für diese Frage?
Beim europäischen Nachkriegskino, so scheint mir, ist der Faden schon gerissen. Arno Widmann klagte neulich in der FR darüber, wie allein er sich mit seiner Liebe zu Federico Fellini fühlt (unser Resümee). Im gebildeteren Publikum unter vierzig kann man die Kenntnis seiner Filme heute kaum mehr voraussetzen. Ab und zu läuft sicher mal etwas auf Arte, aber die Zeit der großen Retrospektiven in den dritten Programmen (die heute eher Kutschfahrten durchs Weserbergland bieten) ist vorbei. Müsste nicht längst so etwas wie eine europäische Kinemathek entstehen, in der nach und nach das Filmerbe der einzelnen Länder gebündelt und mit Untertiteln online verfügbar gemacht wird? In Berlin gibt es noch zwei, drei Videotheken, die Filmklassiker horten. Aber wohin genau soll ich mich wenden, wenn ich in Halle oder Braunschweig wohne und einen Film von Dino Risi oder Andrzej Wajda sehen will? Selbst auf DVD sind deren Filme heute oft nicht erhältlich.
Eine solche europäische Kinemathek müsste übrigens nicht - oder nicht nur - als Anstalt gedacht werden. Sie könnte sich öffnen für Sammler, Nerds und Experten, die mit ihrem Wissen über die Filme beitragen könnten oder auch Filme untertiteln. Die Wikipedia bietet heute das Modell für das, was "öffentlich" ist. Alle Institutionen und Akteure, die das "Öffentliche" im Namen oder im Herzen tragen, sollten sich mit diesem Modell befassen, sich öffnen und nach Kooperation mit der Wikipedia suchen. Auch die Wikipedia ist ein soziales Netz, und bei allen Editorenkriegen, lückenhaften und manchmal tendenziösen Artikeln beweist sie, dass ein soziales Netz nicht nur Fake News, sondern Wahrheit produzieren kann.
Dass die Wikipedia wie auch das Internet selbst von Autokraten gern mal ausgeschaltet werden - wenn sich die Länder nicht ganz davon abkoppeln - zeigt vor allem eins: Die demokratische Auseinandersetzung findet heute in diesen oft verletzlichen, angreifbaren, heiklen Räumen statt. Die ursprüngliche Idee des Internets ist der Link - das Teilen und Vernetzen. Ihr setzen sich heute gewaltige Kräfte entgegen. Die einen - Google oder Facebook - wollen sie monopolisieren und sich ihre Früchte aneignen. Die anderen - die Medien- und Kulturindustrien - richten Barrieren auf.
Aber die Idee ist richtig. Und von ihr hängt einiges ab. Für die Demokratien eigentlich alles.
Thierry Chervel
=====================
Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt ist unbestritten eine Menschheitsaufgabe. Sie ist ein Common, ein Gemeingut. Ein Common ist immer auch, was alles andere ermöglicht. Ohne eine saubere Umwelt kann sich die Menschheit nicht weiterentwickeln. Ohne Luft kann sie nicht atmen. Ohne Straßennetz kann sie nicht wirtschaften.
Es ist Zeit, auch das Internet als ein "Common" zu begreifen. Ohne Internet kann die Öffentlichkeit nicht funktionieren. Das Internet ist nicht Teil, sondern heute die Form der Öffentlichkeit.
In Europa hat niemand auf das Internet gewartet. Viele der offenen Standards des Internets - Html, mp3, Linux - sind zwar in Europa erfunden worden. Aber die europäische Öffentlichkeit hatte bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht den blassesten Schimmer, welch ein Umbruch sie ergreifen würde.
Auch die Journalisten nicht, die angeblich immer die Nase im Wind haben. Als wir vor zwanzig Jahren mit dem Perlentaucher online gingen, waren wir allein auf weiter Flur. Außer ein paar Rentnern und Außenseiterinnen haben kaum Journalisten eigenständige Gründungen im Netz gewagt. Davon leben kann auch kaum einer.
Deutsche Journalisten haben das Internet im Grunde erst liebgewonnen, als sie auf Facebook und Twitter die altgewohnten Blasen replizieren konnten. Nicht wenige prominente Journalisten gehören in den sozialen Medien inzwischen zu den Wortführern. Twitter ist längst nicht mehr der bunte Neuigkeitenstrom, der es mal war, sondern eine permanente Caféhaus-Schlägerei. Hier werden informelle Hierarchien austariert, es geht um Deutungshoheit und Wortführerschaft. Journalisten haben das Internet maßgeblich zum schlechteren verändert. Zugleich sind aber die traditionellen Medien die Zentralorgane jener Kulturkritik am Internet, die die Debatte in Deutschland und dem alten Europa dominiert.
Die Internetexperten der Leitmedien heißen Jaron Lanier (der alles andere als ein "Internetpionier" ist, mehr hier), Shoshana Zuboff, Evgeni Morozov, Adrian Lobe. Ihnen allen gemein ist ein fast apokalyptischer Ton, wenn sie über Entwicklungen im Netz sprechen. Mit ihrer Kritik an Google, Amazon und Facebook haben sie oft recht. Aber sie ziehen den ganzen Rest sehr gern mit runter. Vor allem entwickeln sie keinerlei Idee eines offenen Netzes. Pioniere dieser Idee wie Richard Stallman, Yochai Benkler oder Lewis Hyde sind in Deutschland nahezu unbekannt.
Lanier hatte die Wikipedia - das vornehmste Sinnbild der Idee der Offenheit im Netz - einst "digitalen Maoismus" genannt. Als Alternative setzen sie - aus einem möglicherweise ehrenwerten sozialdemokratischen Impuls - meist auf den Staat als übergeordnete Instanz der Regulierung. Um sich klarzumachen, wie dubios die Idee einer staatlichen Überwachung des "Überwachungskapitalismus" ist, muss man nur nach China, Iran oder Russland blicken.
Dass die sozialen Medien - vor allem Facebook - dazu beigetragen haben, die Öffentlichkeit zu verderben, steht außer Frage. Sie spülen nach oben, was an Hass und Verachtung bisher eher im Verborgenen zirkulierte. Durch ihre Algorithmen verstärken sie diese bösen Leidenschaften noch. Sie sind wie Crack, ein gestrecktes, aufgeschäumtes und kristallisiertes Kokain, das den Urstoff noch giftiger macht. Besonders Facebook hat ein kapillares System entwickelt, um dieses algorithmenverstärkte Gift genau dorthin zu lenken, wo es am besten wirkt. Die aktive Kooperation des Konzerns mit Agenturen wie Cambridge Analytica, die Manipulation von Wahlen im Sinne von Trump, Brexit oder Autokraten in weit entfernten Ländern wirkt im Nachhinein wie eine Vivisektion an der demokratischen Öffentlichkeit. Zauberlehrling Zuckerberg ist seitdem zurückgerudert, aber die Gefahr ist nach wie vor akut.
Natürlich müssen demokratische Staaten mit Gesetzen in diese Prozesse hineinwirken, Selbstverpflichtungen der Konzerne reichen nicht aus und haben bisher nicht genug Wirkung gezeigt. Aber staatliche Regulierungen von Öffentlichkeit sind immer auch prekär. Besser wäre eine funktionierende und sanktionierende Öffentlichkeit selbst.
Dabei sollte klar sein, dass die demokratische Öffentlichkeit noch nie ein Rosengarten war. In ihr agieren mächtige Interessengruppen, die gern ihre Sicht auf die Dinge einhegen oder durchsetzen wollen. Das Beleidigtsein darf nicht zum Kriterium werden. In den zwanzig Jahren, die sich der Perlentaucher im Internet tummelt, ist mir klar geworden, dass es Höheres gibt als verletzte Gefühle: Die Mohammed-Karikaturen wurden von den meisten Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien nicht gezeigt, zumindest nicht, als die Debatte tobte. Erst im Internet konnte sich das Publikum kundig machen. Darum sind Facebook wie auch das Internet gegen die "dezente Mode" heutiger Kulturkritik auch zu schützen. Es muss scheppern dürfen, und zwar kräftig. Über den frommen Gefühlen der Islam-Funktionäre und ihrer linken WeggenossInnen, über dem Beleidigtsein von AfD-Mimöschen, die dann um so böser treten, steht die Meinungsfreiheit.
Der libertäre Impuls
Es stimmt schon: Im Internet steckt immer schon so etwas wie eine Revolte gegen die Institutionen. In Amerika gibt es ja nicht nur einen rechten, sondern auch einen linken Libertarismus. Die Idee, Individuen zu einer neuen Öffentlichkeit ohne Zutrittsbarrieren zu vernetzen, richtete sich von Anfang sowohl gegen den Staat als auch gegen Konglomerate wie Microsoft, die für eine totale Machtergreifung über den Code standen - und stehen. Lanier war Microsoft-Ingenieur und repräsentiert diese Praxis und nicht das frühe Internet. Kein Wunder also, dass der Börsenverein des Buchhandels ihn mit dem Friedenspreis auszeichnet. Mir wäre Tim Berners-Lee lieber gewesen!
Allzu viele libertäre Revolten gegen das Establishment sind aus der Geschichte des deutschen Internets nicht überliefert. Eine Affäre ließe sich aber so einordnen und hat zumindest das Verhältnis der deutschen Medien zum Internet geprägt - die Plagiatsaffäre Guttenberg im Jahr 2011. Die Affäre hatte auch deshalb eine symbolische Seite, weil Karl-Theodor zu Guttenberg im langen Defilee der potenziellen Merkel-Killer ein absoluter Mediendarling war. Guttenberg war der Inbegriff des kommenden Manns. Die Diskussion um Guttenbergs Doktorarbeit war zwar durch einen SZ-Artikel angestoßen worden, gewann ihre Dynamik aber erst durch das "GuttenplagWiki", das laut Wikipedia am Ende auf 82 Prozent aller Seiten Plagiate gefunden hatte. Die Affäre zeigte, dass im Internet nicht nur Fake News und Hass, sondern auch Wahrheit produziert werden. Und sie erwischte die auf ihre personalpolitischen Inszenierungen fixierte Hauptstadtpresse auf dem linken Fuß - dieser Abgang stand nicht auf ihrer Agenda.
Aber die Antwort der "vierten Gewalt" folgte schnell und war noch um einiges brutaler als die Guttenberg-Affäre. Meiner Meinung nach wollte eine verstörte Presse mit der "Wulff-Affäre" zeigen, wo der Hammer hängt. Die Jagd auf Christian und Bettina Wulff wurde in den Stuben der Chefredakteure beschlossen und hatte mit dem Internet bis auf die übliche Begleitmusik in den stärker werdenden sozialen Medien nicht viel zu tun. Bei sehr vielen Beteiligten hinterließ sie am Ende einen schalen Nachgeschmack. Im Wikipedia-Artikel zur Affäre scheint es, als sei vor allem die Bild-Zeitung die treibende Kraft gewesen. Aber selbst wenn es zutrifft, dass die Bild nach wie vor das größte Zerstörungspotenzial für Politikerkarrieren hat, ist meine Erinnerung an die Affäre anders: eigentlich waren so gut wie alle Medien beteiligt.
Für mich markiert die Wulff-Affäre in Deutschland den Moment eines symbolischen Rollbacks. Die klassischen Medien mögen durch den digitalen Wandel zerrupft dastehen, im Spiel mit den ebenfalls geschwächten Institutionen und der politische Sphäre sind sie aber nach wie vor entscheidende Instanzen - und haben es der Politik gezeigt. Politiker bekundeten danach ihre Verbundenheit, indem sie bei wichtigen politischen Entscheidungen wie etwa der europäischen Reform des Urheberrechts brav der Lobbymacht der klassischen Medienindustrien nachgaben: Bei Leistungsschutzrechten, Uploadfiltern und Verlegerbeteiligung entschieden sie stets gegen Google oder Facebook und, wichtiger noch, gegen die Interessen des Publikums und pro Springer und Warner Brothers. Diese Sätze kann man übrigens nur in Internetmedien wie Netzpolitik, Perlentaucher oder Übermedien sagen - in einer Zeitung habe ich diesen Standpunkt noch nie gelesen. Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurde über dieses Thema so gut wie gar nicht diskutiert.
Die Wulff-Affäre war harmlos verglichen mit Ereignissen, die mit der Wucht einer Panzerarmee anrollten, und die ebenfalls maßgeblich von klassischen Medien orchestriert wurden: Donald Trump mag zwar über Twitter direkt mit seinen Anhängern kommunizieren, zunächst aber war er ein Mann des Fernsehens. Was wäre Trump ohne Rupert Murdurchs Fox Broadcasting Company? Und wo wäre Boris Johnson ohne den Telegraph, die Sun und die Daily Mail?
Dass sich in Ländern wie Ungarn und Polen Populisten durchsetzten, dass Wladimir Putin zum Idol linker und rechter Systemkritiker wurde, dass sich in Amerika Trump und in Britannien der Brexit durchsetzte, ist also keineswegs allein dem Medienwandel zuzuschreiben. Klassische Medien, die neue Rollenmodelle für sich suchen, waren zentrale Agenturen dieser Brüche. Dort, wo öffentlich-rechtliche Medien schlecht gegen die Ansprüche der politische Sphäre abgesichert waren, wurden sie ebenfalls zu Megafonen dieses Bruchs. Auch Zeitungen lassen sich gleichschalten oder werden abgeschafft, wie Ungarn und die Türkei zeigen.
Das Internet ist heute ein öffentlicher Raum, der vom Zugriff gewaltiger Machtinteressen bedroht ist. Gegen drei Tendenzen müsste sich eine Öffentlichkeit, die ein offenes Internet als Common betrachtet, wehren:
- die Monopolmacht von gigantischen Konzernen wie Google und Facebook, die zugleich neue Allianzen mit den alten Medienindustrien suchen.
- den Übergriff autokratischer Regimes wie Russland, China und Iran auf die westlichen Öffentlicheiten.
- die totale Verrechtlichung des Netzes und der breiteren Öffentlichkeit vor allem in den noch funktionierenden Demokratien.
Alle drei Punkte verdienen ganze Abhandlungen, ja Forschungsinstitute und können hier nur skizzenhaft angerissen werden.
1. Google, Facebook, die Medien und die Macht
Google und Facebook (auch Amazon, Ebay und andere) haben im Internet Plattformen geschaffen, die heute die Öffentlichkeit weithin prägen und strukturieren. Google Maps legt sich über die Welt wie eine Karte im Maßstab 1 zu 1. Gegen den Überwachungskapitalismus dieser Konzerne hat sich eine ganze Industrie kulturkritischen Klagens entwickelt, die heute die Diskussion über das Internet in den seriöseren Medien dominiert. Ich empfinde den Diskurs der Mozorovs und Laniers, bei allen Punkte, die sie machen, über weite Strecken als heuchlerisch, vor allem weil sie die Idee der offenen Standards verhöhnen, die meiner Meinung nach als einzige einen Weg aus der Vermachtung des Netzes weist.
Meist verkennt die Kritik an Google und Facebook auch das Votum des Publikums: Sie sind auch mächtig, weil sie - was man bedauern kann! - nützlich sind. Sie haben ein Potenzial erkannt, das andere Institutionen aus Ignoranz und Arroganz brachliegen ließen. Es ist halt praktisch, wenn in Google Maps die Fahrzeiten der Busse in Echtzeit angezeigt werden. Und Google arbeitet mit Sicherheit daran , dass man mit dem Handy demnächst automatisch bezahlt, wenn man in diesen Bus einsteigt. Man mag über den Überwachungskapitalismus, der darin liegt, klagen, das Dumme ist aber, dass die Städte und ihre Verkehrsbetriebe offenbar nicht selbst auf die Idee gekommen sind, ihre Dienste zu vernetzen und zum Beispiel mit Open Maps zusammenzuarbeiten. Stattdessen hat jeder Betrieb seine eigene App erstellen lassen, die genau an der Stadtgrenze endet. Stefan Laurin hat einmal bei den Salonkolumnisten das Gewirrr des öffentlichen Nahverkehrs im Ruhrgebiet beschrieben: Es hängen wohl auch zu viele Interessen dran, zu viele gut bezahlte Posten für zu viele Chefs von Verkehrsbetrieben.
Öffentliche Dienste begreifen sich eben allzu häufig nicht als "Common", sondern als Behörde, die den Bürgern vorgesetzt wird. Wäre es nicht die verdammte Pflicht gerade großer öffentlicher Institutionen wie etwa der EU gewesen, sich für offene Standards einzusetzen? Der ehemalige Microsoft-Ingenieur Jaron Lanier wird sicher nicht dagegen protestieren, dass so gut wie aller öffentliche Dienst in Europa von Microsoft-Programmen abhängt. Statt dass, von der EU ausgehend, öffentliche Institutionen die Entwicklung von auf Linux basierenden Alternativen vorantreiben, haben sie auch hier dem Lobbydruck nachgegeben. Harald Schumann hat darüber vor zwei Jahren eine beeindruckende Dokumentation gedreht. Die Milliarden, die Microsoft verdient, sind großenteils Gelder, die der Steuerzahler für Lizengebühren entrichten muss.
Google und Facebook kapern die Öffentlichkeit auf andere Weise. Ihr System ist kapillarer und darum schwerer einzuhegen, obwohl die EU mit einigen Bußgeldern durchaus gezeigt hat, dass sie die Konzerne in die Schranken weisen kann. Google und Facebook organisieren heute im wesentlichen den Anzeigenmarkt - Milliarden Dollar Quartal um Quartal, die den klassischen Medien längst abhanden gekommen sind. Die privat finanzierten Medien haben auf den Verlust ihres Geschäftsmodells im Internet schließlich mit Zahlschranken reagiert. Zuvor hatten sie feststellen müssen, dass sie sich über Werbung nicht finanzieren können. Das Netz ist dadurch um einiges steriler geworden, das Publikum wird noch weiter in die Arme von Google und Facebook getrieben, denn dort kann man kostenlos an der Debatte teilnehmen. In Frankreich etwa gibt es kein Medium mehr ohne Zahlschranke. Und die Internetmedien, die mal die Szenerie aufmischten wie rue89 oder slate.fr sind entweder von Medienkonzernen aufgekauft oder nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Auch in Amerika mussten Internetmedien wie Buzzfeed empfindliche Kürzungen hinnehmen.
Ein, zwei Medien mag der informationshungrige Nutzer am Ende abonnieren. Gerade beim qualifizierten Publikum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um englischsprachige Medien handelt. Die New York Times ist in Europa für 4 Dollar monatlich zu haben, die FAZ kostet digital 46,90 Euro monatlich. Gerade im Moment ihres Auflagen-, Einfluss- und Einnahmeverlustes errichten die Medien Schranken, obwohl in einer vernetzten Welt die Identifikation mit einer einzelnen Quelle ebenfalls eher abnimmt. Man abonniert nicht Le Point, um dann L'Express zu abonnieren, damit man eine Reaktion auf den Nouvel Obs lesen kann. Die Fragmentierung unterhöhlt das Potenzial des Netzes, gibt populistischen Stimmen mehr Raum und schwächt die Medien ein weiteres mal. Auch hier ist es den vereinzelten Akteuren nicht gelungen, einen Standard zu entwickeln, um ein medienübergreifendes Abonnement zu ermöglichen, trotz einiger Ansätze wie Blendle.
Diese Schwächung und Vereinzelung machen es Google und Facebook noch leichter, die Öffentlichkeit zu kapern. Beide setzen auf Medien-Kooperationen, die Hunderte von Millionen Euro schwer sind. Und sie helfen damit, die überkommenen Hierarchien der alten Medienlandschaft neu zu betonieren, wie der Autor und Medientheoretiker Dan Hind aus sehr linker, aber lesenswerter Perspektive in einem Essay für Eurozine feststellt. Medien wie die New York Times, das Wall Street Journal und ihre Entsprechungen in Europa werden eine privilegierte, von den Plattformkonzernen subventionierte und durch Beteiligung an Werbeeinnahmen attraktive Platzierung in diesen Plattformen bekommen. "Facebook ist da sehr offen, Google diskreter. Sie stellen die alte Trennung zwischen dem Mainstream und den Rändern wieder her, die das Vor-Internet-Zeitalter prägte. Eine kleine Handvoll Unternehmen wird die News und Inhalte liefern, zu denen das Publikum regelmäßig durch das Internet Zugang erhält. Ein bunter Rand kleinerer Akteure wird in verschiedenen Formen überleben. Aber sie bekommen keine Anzeigeneinnahmen und werden Schwierigkeiten haben, Abonnenten zu finden".
Eine Wiederherstellung der alten Machtverhältnisse unter neuen Vorzeichen also - allerdings müssen die Medien akzeptieren, dass ihre Paten Google und Facebook heißen. Schon jetzt fällt auf, dass Google und Facebook zu den wenigen Playern gehören, die die Zeitungen noch regelmäßig mit ganzseitigen Anzeigen beglücken, auch eine Form der Subventionierung und gleichzeitig Adressierung der Politiker, für die die Zeitungen noch maßgeblich sind, um ihre Machtpositionen auszutarieren. Printanzeigenpreise in überregionalen Zeitungen sind exorbitant. Die Zeitungen mussten auch deshalb ihren Umfang reduzieren und ihre Preise erhöhen, weil sich das Format als obsolet erwiesen hat. Wer heute noch in Zeitungen ganzseitige Anzeigen schaltet, tut dies häufig aus politischen Gründen. Niemals kämen Google oder Facebook auf die Idee, ähnliche Preise im Internet zu bezahlen.
Eine Subventionierung der Medien durch Facebook und Google wird die freie Berichterstattung über die Macht dieser Konzerne sicher nicht befördern. Hind macht aber auch darauf aufmerksam, dass die "Legacy Media" keineswegs immer gegen Fake News immun sind. "Von der Invasion im Irak bis zur Finanzkrise haben die großen Medien immer wieder gezeigt, dass sie sich manipulieren ließen und der Einschüchterung mächtiger Akteure in Staat und Wirtschaft erlagen. Und sie haben Themen von großer Wichtigkeit falsch dargestellt, wenn die Wahrheit ihre Anzeigen- oder Lizenzeinnahmen gefährdete."
Leider hat Hind hier recht. In der Debatte um die europäische Urheberrechtsreform und um Leistungsschutzrechte für Presseverleger zeigte sich, dass auch seriöse Zeitungen keinerlei Skrupel haben, extrem tendenziös zu berichten, wenn ihre Interessen berührt sind. Das gleiche gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn es um ihre Gebühren und ihren Status geht. Was heute Öffentlichkeit ist, kann nicht mehr durch den Burgfrieden dieser Großmassive ausgemacht werden. Erst im Internet wird sie komplett, und im Grunde ist das Internet - auch wenn nicht alles zugänglich ist - das Biotop, das man heute überhaupt erst Öffentlichkeit nennen kann.
2. Der Zugriff der Autokratien
Zeitungen gehören heute oft Milliardären und Oligarchen. Auch auf Deutschland hat das Phänomen übergegriffen, als Holger und Silke Friedrich die Berliner Zeitung kauften und als erstes Egon Krenz für den Mauerfall dankten. Boris Johnson verbringt gern mal ein Wochenende in der Villa seines Freunds Alexander Lebedew, eines (mal wieder) in London ansässigen Oligarchen, dem zusammen mit seinem Sohn Jewgeni der Independent und der Evening Standard gehören. Um fair zu sein: Er hat laut Wikipedia auch Anteile an der regimekritischen russischen Zeitung Nowaja Gaseta, der einstigen Zeitung Anna Politkowskajas. Aber er war auch KGB-Spion und setzte sich für die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland ein. Boris Johnson zeigte sich am Tag nach seinem Wahlsieg bei der Party zu Lebedews 60. Geburtstag in dessen Londoner Villa. Lebedews Evening Standard hatte für Johnson getrommelt (während der Independent eher kritisch ist). Den "Russlandbericht" des Geheimdienstausschusses im britischen Parlament, der russische Einflussnahme auf die britische Politik untersucht, hält Johnson bis heute zurück, berichtet Luke Harding im Guardian.
Auch Jeremy Corbyn war übrigens zu der Party eingeladen, ist aber nicht erschienen. Dafür äußerte er sich gern ab und zu im iranischen Press TV, wo er bis zu 20.000 Pfund Honorar erhalten haben soll (mehr hier ).
In Frankreich hatte der junge Milliardär Alexandre Pougatchev schon 2009 die einstige Boulevardzeitung France Soir gekauft, die heute nur noch online erscheint und ein Schatten ihrer selbst ist.
Aber es gibt andere Medien, mit denen Russland Einfluss nimmt. RT France ist das Zentralorgan der Gilets jaunes. Romain Bornstein erzählt in der französischen Ausgabe der Vanity Fair, wie die Journalisten in dem Sender gleichgeschaltet werden und zu bloßen Sprachrohren eines von oben gesteuerten Systems umfunktioniert. Viele RT-Journalisten haben sich ihm unter der Bedingung der Anonymität geöffnet. "Je mehr ich ihren Ausführungen zuhörte, desto mehr zeichnete sich mir ein nie dagewesenes, zugleich faszinierendes und erschreckendes System ab, wo eine 'Information' nur Wert hat, wenn sie Empörung auslöst und sich wie ein Raketenschweif durch die sozialen Netze bewegen kann." RT France wurde bald zum populärsten Medium der Gilets jaunes. Wer "Gilets jaunes violence " eingebe, "dem schlägt Google drei Videos von RT France innerhalb der ersten fünf vor. Die Titel: 'Polizeigewalt - Gilet jaune verstümmelt, um ein Exempel zu statuieren', 'Straßburg, Zusammenstöße zwischen Gilets jaunes und Polizisten' oder 'Fünf Hiebe mit dem Knüppel, zehn Tage Arbeitsunfähigkeit, ein Gilet jaune spricht über Polizeigewalt'".
Wie bei den Gilets jaunes selbst, ist es bei RT France eigentlich ganz egal, ob der Hass aufs "System" von ganz rechts oder ganz links kommt. Jean-Luc Mélenchons "Unbeugsames Frankreich" äußert sich sehr gern auf RT France. Ein junger brillanter Vertrauter von Mélenchon, Andréa Kotarac, wurde besonders häufig eingeladen. Heute kandidiert er in Lyon für Mélenchons rechte Konkurrentin Marine Le Pen vom Rassemblement national. Verbindendes Element: der Hass auf Emmanuel Macron.
RT France zeigt, dass Fake News, für die immer wieder "das Netz" verantwortlich gemacht wird, oft ganz klare Fabrikationen sind und ganz klaren Interessen dienen.
Das chinesische Beispiel ist fast noch unheimlicher, denn China ist konkurrenzfähig und gerade für Deutschland der wichtigste aller Märkte. Gegen China wirkt Putin wie ein Giftzwerg. Das Ausmaß des chinesischen Einflusses lässt sich gewissermaßen umgekehrt proportional an der Absenz des Dalai Lama ermessen, der früher überall so gern empfangen wurde. Wer denkt heute noch an Liu Xiaobo, dessen Asche das Regime im Meer verstreute, um keinen Gedenkort entstehen zu lassen? Liu Xia, seine Frau, ist heute in Berlin und verstummt. Die Misshandlung der Uiguren durch die chinesische Zentralregierung wird von westlichen Regierungen kaum mehr benannt, während Medien hier, oft international vernetzt, zum Glück gute Arbeit machen. Hinzu kommt die fieberhafte Entwicklung neuer Überwachungstechnologien, deren Einsatz bald auch in westlichen Ländern droht.
Über die Russophilie in Deutschland muss man kein Wort verlieren. Allein die Thüringer Ereignisse haben gezeigt, das einer immer gewinnt: Wladimir Putin. AfD: "Die Drohgebärden gegen Russland müssen ein Ende haben!" CDU Thüringen: "Mohring für Abbau der Russland-Sanktionen." Die Linke Thüringen: "Auch Ramelow für Ende der Russland-Sanktionen."
Gegen diese Tendenzen hilft in den westlichen Ländern nur eine starke und möglichst vielgestaltige Öffentlichkeit mit sämtlichen Akteuren: den öffentlich-rechtlichen, denen man aber die Öffentlichkeit nicht angesichts der Schwäche der Privatmedien völlig überlassen sollte, den Privatmedien, die aber bei vielen Themen selbst ein Machtfaktor sind und kritische Begleitung verdienen, und also auch diesem wabernden riesigen Ding namens Internet, in dem die Informationen so frei und so verifizierbar wie möglich zirkulieren sollten.
3. Verrechtlichung
Diese freie Zirkulation wird aber immer schwieriger, nicht nur wegen der Paywalls. Schlimmer wirkt sich aus, dass die Kulturindustrien nach der Krise ihrer ursprünglichen Geschäftsmodelle immer mehr auf Einnahmen setzen, die bislang sekundär waren - immer mehr verhindern Urheberrechte, die Monopolisierung von Werken durch riesige Konzerne und Leistungsschutzrechte die Auseinandersetzung mit Kultur und Information.
Getty Images besitzt Milliarden Bilder - auch solche, die gemeinfrei sind - und beansprucht Rechte daran. 2016 ging der Fall der Fotografin Carol Highsmith durch die Medien, die ihre Fotos der Library of Congress überließ und sie offen nutzen lassen wollte - und dann feststellte, dass Getty Images aus eben diesen Bildern Lizenzeinnahmen erzielte. Ihre Klage gegen Getty Images fiel in sich zusammen. Was Getty unter juristisch raffinierter Ausnutzung verschiedener internationaler Copyrightsysteme macht, ist rechtens. Getty Images vermarktet außerhalb Chinas auch die Bilder der Corbis Agentur, nachdem Bill Gates die Agentur an die Visual China Group verkauft hatte. Zu den gigantischen Sammlungen von Corbis und Getty Images gehören Millionen historischer Bilder, die man heute oft mit Copyright-Verweis auf Getty Images abgebildet sieht. Viele davon lassen sich zwar für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos einbetten - aber: definiere "nicht kommerziell":
Sucht man bei Getty Images zum Beispiel nach "Rubens", findet man einen Stich von 1833, der längst rechtefrei ist, und daneben Preisangaben von 50 Euro bis 475 Euro und die rätselhafte Erläuterung: "Alle Lizenzen für lizenzfreie Inhalte beinhalten weltweite Nutzungsrechte, umfangreichen Schutz und eine einfache Preisgestaltung mit Mengenrabatten." Lizenzen für lizenzfreie Inhalte?
Die Verwerterindustrien haben sich auch in vielen anderen Bereichen durchgesetzt, so etwa die drei Majors der Musikindustrie, die das Europäische Parlament im Jahr 2012 dazu brachten, die Schutzfristen auf Tonaufnahmen von fünfzig auf siebzig Jahre zu verlängern. Besonders für berühmte Aufnahmen klassischer Musik, die ihre große Zeit nach der Erfindung der Langspielplatte hatten, ist das eine tragische Fristverlängerung. Man hätte sich etwa vorstellen können, solche Aufnahmen in der Wikipedia zu den Artikel über die Werke oder die Interpreten zu stellen.
"Spürbar wird die Verlängerung nicht so sehr bei Aufnahmen von Werken sein, die immer noch urheberrechtlich geschützt sind, wohl aber bei Aufnahmen gemeinfreier Werke und bei solchen Aufnahmen, die ganz andere Dinge als Werke enthalten (wie Gespräche, Geräusche, Samples)", schrieb John Hendrik Weitzmann 2012 bei irights.info. "Als Kollateralschaden werden auch die wirtschaftlich wenig interessanten und gar nicht mehr im Markt befindlichen Aufnahmen für weitere Jahrzehnte blockiert. Das führt nicht nur zu einer Verfügbarkeitslücke dieser Aufnahmen, sondern behindert auch massiv die Überführung historischer Aufnahmen in digitale Form." In der Presse hat dieses Thema damals nicht den geringsten Widerhall gefunden.
Zeitungen möchten sich künftig auch Überschriften à la "Bayern München siegt mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt" lizenzieren lassen. FAZ-Medienredakteur Michael Hanfeld betonte neulich noch mal, dass er nicht mal ein briefmarkengroßes zitiertes Bild neben einer solchen Aussage stehen haben möchte, ohne dass Suchmaschinen und wer weiß noch alles dafür zahlen. Das "wer weiß noch alles" könnte jeden Blogger betreffen. Die bloße Drohung mit Prozessen reicht ja meistens aus, um kleinere Akteure abzuschrecken.
Die Bundesregierung versucht gerade, das europäische Leistungsschutzrecht für Deutschland umzusetzen, nachdem die deutsche Version, die ihre Vorgänger den Verlegern vor der letzten Bundestagswahlen geschenkt hatten, so gefloppt war. 28 mal 28 Pixel sollen Bilder nach dem Vorschlag, der Hanfeld so empört, groß sein dürfen. Überhaupt Bildrechte. Bilder können ja gar nicht "zitiert" werden. Die kleinste illustrative Abbildung ist kostenpflichtig. Ein befreundeter Autor, der ein Buch über die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts geschrieben hat - die liegen bekanntlich fast hundert Jahre zurück! - erhielt von der VG Bildkunst einen Kostenvoranschlag von 9.000 Euro, weil er ein paar Bauhaus-Möbel zeigen wollte. Irgendwo sitzen immer Erben, die sich ihre Rente aufbessern wollen. Wolfgang Ullrich hat im Perlentaucher gezeigt, dass bekannte Maler und Fotografen ihre Bildrechte inzwischen nutzen, um die Berichterstattung über sich zu steuern. Wer nicht genehm ist, bekommt keine Genehmigung, oder nur zu Bedingungen, die für den Autor nicht akzeptabel sind.
Das Urheberrecht mit seinen absurden Schutzfristen von siebzig Jahren nach dem Tod des Autors verhindert ohnehin schon eine den digitalen Zeiten angemessene Rezeption kultureller Inhalte. Es wird ja viel gespottet über die Demokratisierungshoffnungen, die anfangs mit dem Internet verbunden waren, aber immerhin ermöglicht es auch Zugang an Orten, wo nicht eine Bibliothek oder eine Videothek mit Filmklassikern um die Ecke steht. Schutzfristen von siebzig Jahren nützen wenigen Erben bekannter Urheber und ihren Verlegern und Repräsentanten. Für die große Masse der Autoren bedeuten sie den zweiten Tod, weil sie die Rezeption erschweren. Aber auch berühmte Autoren können wegen der Urheberrechte einen zweiten Tod sterben - Bertolt Brecht ist ein Beispiel, dessen Erben bei Neuinszenierungen so dogmatisch agierten, dass die Theater von ihm abließen. Erst ab 2027, wenn die Rechte an Brecht ausgelaufen sind, könnte eine Brecht-Renaissance einsetzen. Oskar Schlemmers Werk war jahrelang nicht zu sehen, weil die Erben zerstritten waren (mehr hier). Es gibt viele Beispiele dafür, dass eine Rezeption erst nach Ablauf der Rechte einsetzte. Der Gustav-Mahler-Boom der sechziger und siebziger Jahre ist eines: Mahler war 1911 gestorben. Damals lagen die Fristen noch bei fünfzig Jahren. Und Wiederauferstehungen kann man natürlich nicht garantieren. Bei Schlemmer gab es nur ein kurzes Flackern. Ob Brechts Leiche wiederbelebt werden kann? Ob in fünfzig oder hundert Jahren sich irgendjemand wieder für die Filme von Hawks, Antonioni oder Truffaut interessiert?
Der verlorenen Sichtbarkeit von Kultur entspricht die Alterung des Publikums und ihr Prestigeverlust. Es erscheinen ja nicht weniger Bücher, mag man einwenden. Aber als wir mit dem Perlentaucher anfingen, haben wir 800 Buchkritiken der Zeit jährlich resümiert, jetzt sind es noch 220. Die Zeit ist deshalb ein gutes Beispiel, weil sie mit ihrer moralischen Wellnessmischung so reüssiert. Sie gehört zu den wenigen Medien, deren Auflage noch steigt. Dass das Feuilleton in den letzten zwanzig Jahren so gestutzt wurde, hat also offenbar keine ökonomischen Gründe. Dafür sind feuilletonähnliche neue Ressorts wie "Glauben & Zweifeln", "Wissen", "Streit" aus dem Boden gestampft worden.
Die Schätze der europäischen Kultur des 20. Jahrhunderts sind großenteils versteckt und können aus rechtlichen Gründen nicht geborgen werden. Die Archive der öffentlich-rechtlichen Sender sind fürs Publikum so gut wie unzugänglich. In den Mediatheken zirkuliert ja nur das Neueste mit Fristen von sieben Tagen bis zu einem Jahr. Die dreistündige Radiosendung Theodor W. Adornos über "schöne Stellen" aber bleibt unzugänglich. Das Radio war in den fünfziger und sechziger Jahren fast mehr als die Zeitungen der Ort der Intellektuellen und experimenteller Künstler. Wer weiß das heute noch? Und wie ist es eigentlich mit all den Aufnahmen all der öffentlich finanzierten Rundfunkorchester? Müssten sie nicht, auch rechtlich öffentlich, ein "Common" sein (sofern es sich um Aufnahmen gemeinfreier Werke handelt)? Gibt es bei den Sendern überhaupt ein Bewusstsein für diese Frage?
Beim europäischen Nachkriegskino, so scheint mir, ist der Faden schon gerissen. Arno Widmann klagte neulich in der FR darüber, wie allein er sich mit seiner Liebe zu Federico Fellini fühlt (unser Resümee). Im gebildeteren Publikum unter vierzig kann man die Kenntnis seiner Filme heute kaum mehr voraussetzen. Ab und zu läuft sicher mal etwas auf Arte, aber die Zeit der großen Retrospektiven in den dritten Programmen (die heute eher Kutschfahrten durchs Weserbergland bieten) ist vorbei. Müsste nicht längst so etwas wie eine europäische Kinemathek entstehen, in der nach und nach das Filmerbe der einzelnen Länder gebündelt und mit Untertiteln online verfügbar gemacht wird? In Berlin gibt es noch zwei, drei Videotheken, die Filmklassiker horten. Aber wohin genau soll ich mich wenden, wenn ich in Halle oder Braunschweig wohne und einen Film von Dino Risi oder Andrzej Wajda sehen will? Selbst auf DVD sind deren Filme heute oft nicht erhältlich.
Eine solche europäische Kinemathek müsste übrigens nicht - oder nicht nur - als Anstalt gedacht werden. Sie könnte sich öffnen für Sammler, Nerds und Experten, die mit ihrem Wissen über die Filme beitragen könnten oder auch Filme untertiteln. Die Wikipedia bietet heute das Modell für das, was "öffentlich" ist. Alle Institutionen und Akteure, die das "Öffentliche" im Namen oder im Herzen tragen, sollten sich mit diesem Modell befassen, sich öffnen und nach Kooperation mit der Wikipedia suchen. Auch die Wikipedia ist ein soziales Netz, und bei allen Editorenkriegen, lückenhaften und manchmal tendenziösen Artikeln beweist sie, dass ein soziales Netz nicht nur Fake News, sondern Wahrheit produzieren kann.
Dass die Wikipedia wie auch das Internet selbst von Autokraten gern mal ausgeschaltet werden - wenn sich die Länder nicht ganz davon abkoppeln - zeigt vor allem eins: Die demokratische Auseinandersetzung findet heute in diesen oft verletzlichen, angreifbaren, heiklen Räumen statt. Die ursprüngliche Idee des Internets ist der Link - das Teilen und Vernetzen. Ihr setzen sich heute gewaltige Kräfte entgegen. Die einen - Google oder Facebook - wollen sie monopolisieren und sich ihre Früchte aneignen. Die anderen - die Medien- und Kulturindustrien - richten Barrieren auf.
Aber die Idee ist richtig. Und von ihr hängt einiges ab. Für die Demokratien eigentlich alles.
Thierry Chervel
2 Kommentare