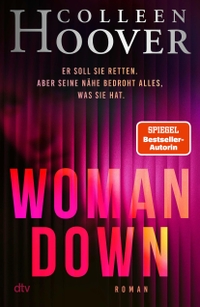Essay
Die kritische Differenz
Von Eva-Maria Troelenberg
17.01.2018. Wolfgang Ullrich preist in seiner Bilanz des "Superkunstjahres" 2017 die Freiheit des Kunstmarktes gegenüber dem Moralismus der Kuratorenkunst - aber er meint die Freiheit des ökonomisch Erfolgreichen. Wer mehr Freiheit in der Kunst will, müsste mehr (und nicht weniger) über soziale Differenz sprechen, die sich an Kategorien von Ethnie, Geschlecht, und eben nicht zuletzt auch ökonomischer Teilhabe manifestiert. Eine ReplikAufschlussreich für die Lesart ist der Teaser, mit dem Ullrich diesen Text auf seinem Blog ideenfreiheit.de verlinkt: "So gerne man dem Kapitalismus - also dem gewinnorientierten, auf Spekulation getrimmten Denken - vorhält, keine Werte und keine Moral zu kennen, so sehr kann gerade das zum Vorteil für eine Kunst werden, die unter den Druck moralischer Rechtfertigung gerät. Denn soweit der Markt amoralisch ist, herrscht auf ihm auch nicht jener Druck; vielmehr lässt er der Kunst in moralischer Hinsicht Freiheit." Es passt ganz gut zur kalkulierten Kälte dieses Arguments, dass sich die titelgebende "offene Feindschaft" dann auch nicht etwa simpel zwischen Markt und Museum abspielt, vielmehr wird die Moral (oder auch ihr Fehlen) zur entscheidenden Variable zwischen den Institutionen und Instanzen, anhand derer sich, im wahrsten und mehrfachen Sinn, die Werthaltigkeit virulenter Gegenwartsdebatten ermitteln lasse.
Als Beispiele führt Ullrich die Diskussionen um teils jahrzehntealte Werke von Cindy Sherman, Jimmie Durham, Dana Schutz und anderen Künstlern an, die zuletzt von jüngeren Aktivisten aufgrund ihrer nicht mehr zeitgemäßen Haltung gegenüber rassistisch codierten ästhetischen Praktiken scharf angegriffen wurden. "In westlichen Ländern stellt es eine neue Entwicklung dar, dass Kunst in offener Feindschaft und ohne Kompromissbereitschaft an den Pranger gestellt wird (...). Fast immer handelt es sich dabei um Fälle, bei denen Künstler Probleme mit anderen Ethnien bekommen, auf die sie sich in ihren Werken beziehen". Solche kritischen Diskurse seien als moralische Identitätspolitik letztlich "Abrechnung" oder "Vernichtung". Die Vermischung von dominanten und emanzipatorischen Identitätsbegriffen mag noch der notwendigen relativen Kürze des Textes geschuldet sein, dessen Verfasser kein Spezialist der Differenzforschung ist. Man wird aber einem Autor wie Wolfgang Ullrich kaum unterstellen dürfen, dass er die deutschsprachige Kunstpolitik des 20. Jahrhunderts nur lückenhaft im Kopf hat. Umso mehr Unbehagen bleibt angesichts der hier gewählten Terminologie, und der schiefen Vergleiche, die sie subtextuell - und wenn auch unbeabsichtigt - aufrufen kann.
Die Kunst, so geht es weiter, sei "genauso zum Gegenstand und Spielball politischer Interessengruppen geworden wie Lehrpläne, der Journalismus oder die Werbung". Das hier explizit eine Parallele zur Werbung gezogen wird, ist interessant, denn: "An dieser Stelle fällt auf, dass der Markt als Gegeninstanz wirken kann." Und hier vollzieht sich dann die argumentative Volte, an der der Text als Ganzes aufgehängt ist: Museen, Biennalen und andere Foren der Kuratorenkunst zeigten sich mehr und mehr unter dem wachsenden Einfluss einer "identitätspolitischen Vorstellung von Kunst" - beinahe, als wäre eine politisch engagierte Kunst ein Novum: "Also bestehen kuratierte Ereignisse wie eine Biennale oder die Documenta vor allem aus Arbeiten, die sich emanzipatorisch-gesellschaftskritischen oder ökonomisch-investigativen Themen widmen."
Bisherige Blue Chips des Kunstbetriebs wie David Hockney, Jeff Wall, Jonathan Meese oder Neo Rauch bis hin zu Anselm Kiefer seien in diesem Zusammenhang diskreditiert und fänden keinen Raum mehr, während Sammler und Kunstmarkt ihnen immerhin bis auf Weiteres ungebrochene Aufmerksamkeit widmeten. Nur wenige Künstler, wie etwa Olafur Eliasson, schafften es, ein erfolgreiches Mittelfeld zwischen beiden Bereichen zu bespielen, jedoch: "Künstler, die (...) ihre Werke ausschließlich nach Kriterien beurteilt wissen wollen, die dem Begriff der Kunst entstammen, haben es schwerer als früher, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu finden". Vom im wahrsten Sinn des Wortes freien Markt hätten diese Künstler auf jeden Fall mehr zu erwarten als von den etablierten Kunstinstitutionen, die mehr und mehr den sozial engagierten Werken bisher unterprivilegierter oder unterrepräsentierter Gruppen vorbehalten blieben. Ullrichs Text endet mit der Feststellung, es habe sich im Superkunstjahr 2017 "gezeigt, dass der Markt wichtig ist, um die Vielfalt und Freiheit der Kunst zu garantieren, die sonst zunehmend gefährdet zu sein scheint."
Wie gewohnt argumentiert Ullrich auch in diesem Text dialektisch - so räumt er an mehreren Stellen unmissverständlich die Verwerfungen ein, die im Hochpreissegment des Kunstmarktes mit seinen moralfreien Distinktionsmechanismen entstehen können. Aber genügen diese Hinweise schon zur Binnendifferenzierung der Kategorien Freiheit und Vielfalt, die den Fluchtpunkt der Argumentation bezeichnen? Freiheit meint dann hier doch vor allem die Freiheit des ökonomisch Erfolgreichen. Eine Schlussfolgerung müsste sein, mehr (und nicht weniger) über soziale Differenz zu sprechen, die sich an Kategorien von Ethnie, Geschlecht, und eben nicht zuletzt auch ökonomischer Teilhabe manifestiert.
Dass diese Art der kritischen Differenzforschung gerade für die Kunst und Kunstgeschichte interessante Räume der Erkenntnis eröffnet, die eben nicht dichotomisch/moralisch eindeutig sind, hat zum Beispiel Viktoria Schmidt-Linsenhoff1 schon vor Jahren produktiv gezeigt. Wer auf der letzten Biennale Viva Arte Viva übrigens die Nachbarschaft von Olafur Eliassons "Green light" workshop (Website und Bilder) zu Hassan Sharifs "Supermarket" (Bilder) bewusst wahrgenommen hat, der hat - hoffentlich - zweimal darüber nachgedacht, welche Kunst hier opportunistisch auf politische Buzzwords reagiert, und welche eine genuine und zugleich politisch konnotierte ästhetische Praxis repräsentiert. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Der größte Erkenntnisgewinn entsteht dadurch, dass beides nebeneinander rezipierbar ist.
Um diese Art von Vielfalt aber geht es in Ullrichs Text anscheinend nicht. Auffällig ist die Reihe der überwiegend männlichen, hoch etablierten weißen Künstler, deren verblassender Biennalenruhm konstatiert wird - zumeist Vertreter einer Generation, für die das Jahr 1989 eine entscheidende politische Zäsur dargestellt haben dürfte, die mithin also vom weltweiten Fortschritt der einerseits demokratischen, andererseits neoliberalen Idee auf die eine oder andere Weise geprägt waren und diese oft affirmativ verarbeiteten. Frei von politischer Konnotation war also auch die Kunst der vergangenen Jahrzehnte gewiss nicht.
Angesichts der Krisenstimmung, die derzeit zwischen wirtschaftlicher Globalisierung und aufgeklärtem Demokratieverständnis heraufzieht, haben wir es vielleicht einfach mit einem Ausdruck von Evolution zu tun, wenn die Kunst in Biennalen und Museen sich gleichsam in einer notwendigen Wellenbewegung wieder stärker explizit politisiert, womit idealerweise größere Vielfalt der Stimmen und Kontexte verbunden sein sollte. Interessanterweise formulierte Bazon Brock schon vor mehr als vierzig Jahren einen ähnlichen Gedanken wie Wolfgang Ullrich heute. Wie weit die scheinbare epistemische Macht des Marktes inzwischen akzeptiert ist, erweist sich allerdings im Unterschied der Schlussfolgerungen: So beschreibt Brock 1970 "(...) daß in verstärktem Maße heute Künstler daran arbeiten, einen Bestimmungsrahmen für sich selber und ihre Arbeiten zu gewinnen. Das vermehrte kunsttheoretische und gesellschaftspolitische Spekulieren der Künstler wird von ihnen so verstanden. Der Markt möchte hingegen die Künstler zum Produzieren anhalten und setzt ihnen alte Imperative entgegen: bilde Künstler, rede nicht! Dennoch, die Künstler fangen endlich an zu reden, und sie tun das vornehmlich in Museen."5
Dass bei solchen Prozessen immer wieder unterschiedliche Qualitäten zutage treten und manchmal die Grenze zur Kunst als Sozialpädagogik auf ästhetisch schmerzhafte Weise überschritten wird, ist unbestritten, gehört aber sicherlich dazu (ebenso wie der Markt wohl manches Produkt überbewertet). Möglicherweise sehen wir aber insgesamt gerade einen neuen Aufbruch in eine Gegenwartskunst der "post-greatness",3 in der sich die Bewertungskategorien einfach ändern, womit sich auch die "alten Imperative" zumindest verschieben dürften. Es wird dafür sicherlich noch viele Anläufe brauchen. Wenn auch der Markt so flexibel ist, wie er es von seinen Subjekten erwartet, dann darf er dabei gerne helfen.
Eva-Maria Troelenberg
1Viktoria Schmidt-Linsenhoff: Ästhetik der Differenz. Postkoloniale Perspektiven vom 16. bis 20. Jahrhundert, Marburg 2011.
3Linda Nochlin: Why have there been no great women artists? (1971), in: Linda Nochlin: Women, Art, and Power. And Other Essays, New York 1988, 145-178. Dazu Eva-Maria Troelenberg: Post-Greatness, oder: Zur Epigenetik der Kunstwissenschaft, in: Albert Coers/Alex de Vries (Hrsg.): Faktor X - das Chromosom der Kunst, Haus der Kunst München 2017, 74-80.