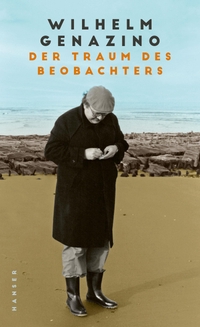Der Traum des Beobachters
Aufzeichnungen 1972-2018
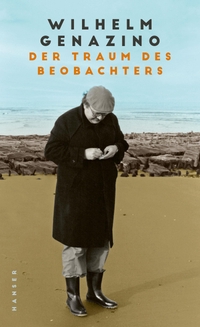
Carl Hanser Verlag, München 2023
ISBN
9783446276208
Gebunden, 464 Seiten, 34,00
EUR
Klappentext
Herausgegeben von Jan Bürger und Friedhelm Marx. Seine Wohnung verließ Wilhelm Genazino nie ohne Stift und Papier. Jahrzehntelang tippte er seine Beobachtungen von unterwegs akribisch ab, aus Furcht, eines Tages könnte ihn das Schreiben selbst verlassen. So entstand ein "Materialcontainer", in dem sich Leben und Fiktion, Ideen und Träume unauflöslich vermischen. Sie zeigen den Autor als verzweifelten Glückssucher, als hochsensiblen Zeitzeugen
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (
Info)
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.06.2023
Rezensent Edo Reents weiß das Schaffen des 2018 gestorbenen Wilhelm Genazino durchaus zu schätzen, doch er muss zugeben, dass er sich mit diesen aus dem Nachlass veröffentlichten Aufzeichnungen ganz schön gelangweilt hat. Allerdings ging ihm das auch bei Thomas Manns Tagebücher so, der den Rezensenten nicht einmal mit einem Eintrag wie "Nachts geschlechtlicher Anfall" belustigen konnte. Genazino ist eben kein Erzähler, meint Reents, sondern ein Beobachter und Grübler, und so schlägt er aus seinem Leben mit dem späten Abitur und dem noch späteren Studium keine erzählerischen Funken, sondern Aphorismen. Auch hier entdeckt Reents viel Banales, aber dann doch auch das, was Genazino so groß gemacht hat: die Fähigkeit sich selbst als "willentlich aus der Zeit gefallen" zu erkennen.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 30.03.2023
Rezensent Rainer Moritz lernt in dieser Zusammenstellung von Notizen des Schrifstellers Wilhelm Genazino vor allem etwas über dessen Schreibpraxis und den Hang zum beobachtenden Flanieren. Die Literaturwissenschaftler Jan Bürger und Friedhelm Marx haben einen kleinen Teil von Genazinos 7000-seitigem "Werktagebuch" herausgegeben, samt instruktivem Nachwort und kurzen Einführungen zu den einzelnen Abschnitten, berichtet der Kritiker. Sehr "lesenswert" findet Moritz Genazinos Reflexionen auf den Literaturbetrieb und die zahlreichen Notizen, die sich der Autor hier während der Entstehung seiner Werke machte. Genazinos Beobachtungen vereinen "Präzision und Komik", das Verdikt der "aphoristischen Qualität" der Herausgeber findet Moritz durchaus gerechtfertigt.
Rezensionsnotiz zu
Deutschlandfunk Kultur, 31.01.2023
Rezensent Helmut Böttiger staunt, wie exakt die Einträge in Wilhelm Genazinos hier auszugsweise veröffentlichten "Werktagebüchern", lauter genaue, kluge Alltagsbeobachtungen, mitunter in das erzählerische Werk des Autors eingingen. Für Böttiger ist das Autofiktion, die über sich selbst hinausgeht, indem sie immer weiser das Spanungsfeld zwischen Melancholie und Komik ausmisst und einen eigenen poetischen Raum herstellt. Einen von existenzieller Dimension, wie Böttiger anerkennend hinzufügt.
Rezensionsnotiz zu
Deutschlandfunk, 25.01.2023
Rezensent Ulrich Rüdenauer schwelgt geradezu in den Aufzeichnungen und Notaten Wilhelm Genazinos, die Jan Bürger und Friedhelm Marx aus 7.000 Seiten in 40 Leitzordnern ausgesucht und auf handliche 450 Seiten reduziert haben. Rüdenauer stößt beim Durchblättern immer wieder auf Ideen, Motive und "Glutkerne" aus den Romanen Genazinos. Dieser hatte beim Spaziergehen immer ein paar Notizzettel dabei, auf denen er Eindrücke und Ideen notierte, die er dann später abtippte, umarbeitete und mit Datum und Nummer versah, lernt Rüdenauer. Ein "System von Erinnerungen" entstand so, das Genazino wohl auch die Angst davor nahm, eines Tages keinen Stoff mehr zu haben. Der dankbare Kritiker folgt mit den Aufzeichnungen dem Entstehungsprozess der Romane, die immer wieder von den Herausgebern mit biografischen Skizzen ergänzt werden. Höchstes Leseglück bieten die kurzen Notate für Rüdenauer, das sich auch einstellt, wenn man keinen einzigen Roman von Genazino gelesen hat, versichert er.
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 21.01.2023
Die Zubereitung eines italienischen Cafés in einem Lokal in Frankfurt: So liebevoll wie genau konnte Wilhelm Genazino alltägliche Momente zu besonderen machen. Entsprechende Notizen und Aufzeichnungen aus dem Nachlass des Schriftstellers haben Jan Bürger und Friedhelm Marx zusammengestellt und Rezensent Eberhard Geisler ist dafür sehr dankbar. Denn diese "Blitzlichtaufnahmen" zeigten sehr eindrücklich, dass Genazino von Theorien aller Art nichts hielt, dafür umso mehr von feinen Beobachtungen, die für Geisler nicht hoch genug geschätzt werden können. Klar mache der Band auch, schreibt der Rezensent, dass Genazino den Roman brauchte, weil er über das Autobiografische zeitlebens nicht sprechen konnte. Die eigenen Verletzungen in denen anderer zu spiegeln und dabei auch noch ein politischer Autor gewesen zu sein - das macht das zum 80. Geburtstag herausgegebene Buch für Geisler unbedingt lesenswert.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 21.01.2023
Rezensent Frank Schäfer freut sich über die Veröffentlichung von Auszügen aus Wilhelm Genazinos Werktagebüchern: kleine Notizen zu Erlebnissen oder Gegenständen, vom Autor selbst als "Prothese des Schreibens" bezeichnet, die er in 38 Ordnern sammelte, wie sich der Kritiker an einen Besuch bei Genazino 2004 erinnert. Um ein geheimes Hauptwerk handele es sich dabei zwar nicht, aber eine besondere "Strahlkraft" geht für den Kritiker trotzdem von den aphoristischen Aufzeichnungen aus - ein Vater mit Baby am Schießstand, ein "Schienenstück, das glänzt wie ein Stück Wasser", wie er Genazino zitiert. Dabei ziehen sich eine grundlegende Skepsis gegenüber dem eigenen Beruf und ein Minderwertigkeitsgefühl wegen des erst sehr spät nachgeholten akademischen Abschlusses durch das Buch, so Schäfer - und eine "leise Vergeblichkeitsmelodie", die gegen Ende sogar in Bitterkeit mündet; lustig werde es nur sehr selten. Das könnte aber auch an der Auswahl der beiden Herausgeber und Germanisten Jan Bürger und Friedhelm Marx liegen, vermutet Schäfer, die dem Leser lobenswerterweise mit einigen Anmerkungen zum Entstehungskontext Orientierung liefern.
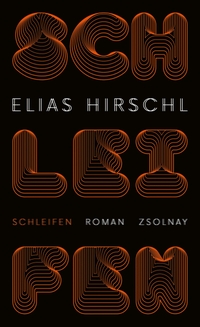 Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen