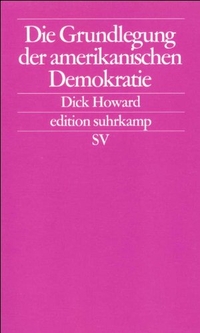Die Grundlegung der amerikanischen Demokratie
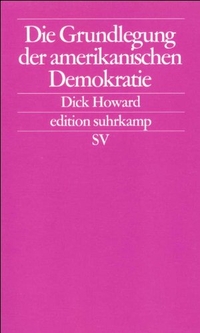
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001
ISBN
9783518121481
Taschenbuch, 387 Seiten, 15,29
EUR
Klappentext
Aus dem Amerikanischen von Ulrich Rödel. Dick Howard erklärt, warum die Amerikanische Revolution nicht wie die Französische oder die Russische in eine totalitäre Katastrophe geführt hat, sondern durch die parallel stattfindende Reflexion der geschichtlichen Ereignisse zur Grundlage einer bis heute stabilen Demokratie werden konnte.
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 21.05.2002
Dick Howard räumt mit der These auf, die amerikanische Revolution zwischen 1763 und 1787 sei ein "unpolitisches Ereignis" gewesen, eine "'gesunde' Form gesellschaftlicher Selbstregierung", schreibt Rezensent Martin Hartmann. Für Howard steht fest, dass die amerikanische Revolution eine "zutiefst politische" war und mit dem Entwurf demokratischer Theorien einherging, referiert der Rezensent: "Anstatt die Freiheit vor der Macht zu schützen, sah sich die souveräne und unabhängige Nation genötigt, Institutionen, Formen der Machtausübung zu erfinden, die Freiheit garantieren würden." Die Gewaltenteilung, so Howard, verlagert das Politische an einen "Ort ohne Macht", der durch den demokratischen Streit die amerikanische Revolution als "unabgeschlossen" und (glücklicherweise) "unabschließbar" ausweist. Hartmann gefällt die "theoretische Eleganz" dieser Lesart, doch er vermisst darin die soziale Frage. Hat vielleicht "eine soziale Gruppe unrechtmäßig die Leerstelle der Macht gefüllt" und so die immer größer werdende "Ungleichheit zwischen Arm und Reich" hervorgebracht? "Howard thematisiert die Gefahren, die der Freiheit durch die Macht drohen, er sagt aber zuwenig über die Gefahren, die der Gleichheit durch die Freiheit (des Marktes) drohen", so Hartmanns abschließendes Urteil.
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 03.04.2002
Mit seinem Buch über die Grundlegung der amerikanische Demokratie hat Dick Howards nach Einschätzung des Rezensenten Dieter Thomä eine recht solide, aber wenig originelle Arbeit vorgelegt. Laut Thomä möchte Howard zeigen, dass die Errungenschaften der amerikanischen Revolution historische Wirkungen hatte, die bis in die Gegenwart reichen. Zunächst zeichnet Thomä die Ausführungen des Autors nach: Howards Ausgangspunkt sei der im Unterschied zur französischen Revolution relativ friedliche Verlauf der amerikanischen Revolution. Daraus resultiere eine Auffassung von Politik, die die Macht des Staates in den Dienst der Freiheit des Individuums stelle. Dieses Primat individueller Freiheit ziehe das Problem der politischen "Repräsentation" nach sich: Einerseits feiere man die staatlichen Repräsentanten als Garanten der Freiheit und einer starken Demokratie, andererseits wollten sich die Amerikaner nicht allzusehr mit diesen Repräsentanten identifizieren und suchten die Entfaltung ihrer Freiheit fern von der Politik. Diese Ambivalenz rückt nach Ansicht des Rezensenten in den Mittelpunkt von Howards Analyse, insofern Howard genau darin das zentrale Motiv der Debatte erblickt, die Ende des 18. Jahrhunderts zwischen Jefferson, Hamilton, Madison und anderen ausgetragen wurde. Zeit für den Rezensenten, Kritik zu üben. Bei allen allgemeinen Fragen, die Howard gelegentlich aufwirft, findet Thomä in Howards Buch "eigentlich nichts anderes als eine minuziöse Rekonstruktion eben jenes Streits". Dabei bemängelt der Rezensent insbesondere, dass Howard die Grundlinien dieser Kontroverse nicht neu koordiniert. So bietet Howards Buch nach Ansicht des Rezensenten nur eine "penible, oft arg umständliche Zusammenfassung, keinen originellen Neuansatz. "
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 08.12.2001
Insgesamt recht überzeugend findet der Rezensent Andreas Bock die Thesen des Philosophen und Politikwissenschaftlers Dick Howard. Der beschäftigt sich in seinem 1986 im Original erschienen Buch mit der Frage, warum der Versuch geglückt ist, in Amerika nach der Trennung von der englischen Krone eine Demokratie zu schaffen. Howard sieht den Grund für das Gelingen dieses Projektes darin, dass private Interessen, der "pursuit of happiness", in dem neuen Staat im Vordergrund standen und dass es beim Ausarbeiten der Verfassung keine klare Vorstellung davon gab, wie der neue Staat auszusehen hat. Somit waren alle Entscheidungen von praktischen Erfahrungen motiviert. Die Art und Weise, wie Howard seine Thesen vertritt, findet Andreas Bock ebenso "belesen wie belehrt". Allerdings vermisst der Rezensent ein paar negative Anmerkungen im Geiste Hannah Arendts zum Thema "pursuit of happiness", weil dieser sich doch eben schnell zu einer hauptsächlich materiellen Doktrin entwickelt habe.
 Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen