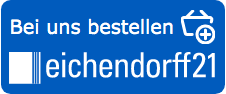Julian Barnes
Nichts, was man fürchten müsste
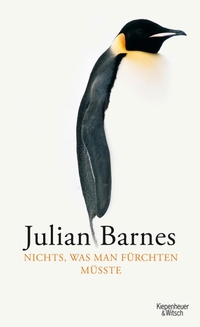
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2010
ISBN 9783462041866
Gebunden, 333 Seiten, 19,95 EUR
ISBN 9783462041866
Gebunden, 333 Seiten, 19,95 EUR
Klappentext
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. "Was soll eigentlich dieses ganze Tamtam um den Tod?", fragt nüchtern Julian Barnes' Mutter. Aber ihr Sohn kann deshalb oft nicht schlafen: "Ich erklärte ihr, mir widerstrebe eben der Gedanke daran." Die Angst vor dem Tod treibt Julian Barnes seit seiner Jugend um, immer wieder umkreist er das Thema in seiner ganzen Unerbittlichkeit und Hoffnungslosigkeit, denn er glaubt nicht an Gott, vermisst ihn aber. Neugierig und um Erkenntnis bemüht sucht er in der Kunst und in der Literatur, in den Naturwissenschaften und in der Musik nach Antworten. Doch Julian Barnes ist Romancier, deshalb entwickelt er seine Gedanken aus Personen und Handlung. Und so erzählt er auch die anekdotenreiche Geschichte vom Leben und Sterben der sehr britisch zugeknöpften Familie Barnes - von den originellen Großeltern, der herrischen Mutter, dem in sich gekehrten Vater, dem besserwisserischen Philosophen-Bruder und dem belesenen, an den Künsten interessierten Julian.
Seine wahren Angehörigen und Vorfahren sind für Julian Barnes allerdings nicht die Mitglieder einer englischen Lehrerfamilie, sondern Schriftsteller und Komponisten wie Stendhal, Flaubert und Strawinsky. Mit ihnen erörtert er scharfsinnig und verängstigt, flapsig und tröstlich, ironisch und ernsthaft die Angst vor dem Treppenlift, den Blick in den Abgrund, das Wie und Wo und Wann.
Seine wahren Angehörigen und Vorfahren sind für Julian Barnes allerdings nicht die Mitglieder einer englischen Lehrerfamilie, sondern Schriftsteller und Komponisten wie Stendhal, Flaubert und Strawinsky. Mit ihnen erörtert er scharfsinnig und verängstigt, flapsig und tröstlich, ironisch und ernsthaft die Angst vor dem Treppenlift, den Blick in den Abgrund, das Wie und Wo und Wann.
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 04.05.2010
Weder die endgültige Beantwortung "letzter Fragen" noch die wirkungsvolle Beschwichtigung von Todesängsten findet Angela Schader in Julian Barnes Buch, sondern eher eine tastende Auseinandersetzung mit dem "Nichts". Die Rezensentin hätte sich aber durchaus etwas mehr Tiefgang gewünscht, wie sie unmissverständlich klar macht. Indem der 1946 geborene britische Autor nämlich locker autobiografische, literarische und kunsthistorische Gedanken mischt und so von Einfall zu Einfall springt, wirkt das auf die Dauer auf Schader doch "ermüdend", wie sie kritisiert. Weil Barnes in seinen Reflexionen "Anekdotisches und Existentielles" auf gleicher Ebene verhandelt, läuft das Ganze Gefahr ins Unverbindliche zu stürzen, beschwert sich die Rezensentin, die sich auch eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den im Text aufgerufenen Autoritäten wie Pascal oder Coleridge gewünscht hätte. So lässt sie dieses Buch trotz seines gewichtigen Themas insgesamt ziemlich kalt, wie sie gesteht. Nur Barnes' Erzählung von der Beziehung zu den Eltern und der besonderen Kühle, die offensichtlich in seinem Elternhaus geherrscht hat, haben die Rezensentin dann doch berührt, was sie allerdings vom Rest dieses "pathosfrei, kritisch-ironisch (post)modern" daher kommendem Buches nicht sagen kann.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.04.2010
Beeindruckt ist Rezensent Tobias Rüther von diesem jüngsten Buch des von ihm als Romancier - wenngleich fürs Früh- mehr als fürs Spätwerk - geschätzten Julian Barnes. Hier geht es essayistisch, in typisch Barnesscher Umkreisungsgeste, um kein geringeres Thema als den Tod. Witzig und gelehrt zugleich schreibe der Autor, das sei man von ihm gewohnt. Dass er nie auf einen Endpunkt und einen finalen Satz kommt, das kenne man von Barnes (und Rüther schätzt es sichtlich, auch wenn man dabei manchmal "wahnsinnig werden" könne) - dem Thema angemessen sei es überdies. Durchaus originell findet der Rezensent das Buch, obwohl es viel aus der Weltliteratur zitiert. Insbesondere die Tatsache, dass das Thema Familie sich ständig in den Vordergrund drängt, leuchtet Rüther in der Sache sehr ein. Die vielen von Barnes zitierten Anekdoten weiß er zu schätzen.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 03.04.2010
Nicht recht froh ist Rezensent Rolf-Bernhard Essig mit diesem Buch geworden. Er beschreibt es als "extrem langen Essay", der die "Sterbekunst" wieder aufleben lassen will. Dies jedoch ist Julian Barnes seiner Ansicht nach nur mäßig gelungen. Am unterhaltsamsten findet Essig noch Barnes' Nachruf auf sich selbst. Insgesamt betrachtet der Kritiker die dargebotenen Details über das Dahinsiechen von Verwandten und Freunden des Autors als nur mäßig aufschlussreich. Denn Barnes bleibe nicht beim Persönlichen und Anekdotischen, sondern betrete auch Gebiete, von denen er augenscheinlich wenig verstehe, wie Hirnforschung, Genetik oder Evolutionsbiologie. Hier tische der Autor seinen Lesern dann immer wieder Halbverstandenes, Banales, Falsches und schlicht Uninteressantes auf, moniert der Rezensent.
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 31.03.2010
Gabriele Killert tut mit diesem Romanessay einen Blick in die "Abgründe" des vor allem für seinen britischen Humor berühmten Julian Barnes. In seinem jüngsten Buch setzt sich der Autor nämlich mit seiner Angst vor dem Tod auseinander, die ihn schon seit Jugendjahren immer wieder ergreift, und lässt seinen Bruder, einen Philosophieprofessor, als seinen Widerpart auftreten, der mit Hinweis auf Montaigne die Todesfurcht negiert, erklärt die Rezensentin. Die gedankliche Auseinandersetzung bringe den Autor auf "immer skurrilere Abwege", findet Killert. Allerdings habe Barnes auch sehr berührende Porträts des Sterbens seiner Eltern sowie eines Managers, der seinen eigenen Tod minutiös plant, eingeschlossen. Ohne die wäre dieses Buch vielleicht auch nur ein überquellender "Zettelkasten" mit einer Fülle von Anekdoten und Zitaten von Barnes literarischen Helden, meint die Rezensentin etwas verhalten. Und so gibt sie zu, dass sie das Buch am Ende auch ganz gern wieder zugeklappt hat.
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 16.03.2010
Lothar Müller lobt Julian Barnes Buch über die eigene Todesfurcht nicht ohne paradoxen Witz als äußerst "lebendige" Biografie einer Obsession. Der Autor, den die Furcht vor dem Tod nach eigenen Angaben schon mit 13 oder 14 Jahren erfasst hat und der er bereits in seinem ersten Roman eindrücklich Ausdruck verlieh, wendet sich gegen die im Titel zitierte gängige Beschwichtigung, erklärt der Rezensent. Barnes schreibe gegen diese Furcht an, neben essayistischen Ausflügen wendet er sich immer wieder an Literaten, denen er sich verwandt fühlt, und von denen er so manche Anekdote zum Thema wiedergibt, so Müller weiter. Zugleich stellt dieser Roman aber auch ein "Selbstporträt" dar, stellt der Rezensent fest, der betont, dass sich Barnes jegliches Pathos verbietet und sich stattdessen mit "Galgenhumor" behilft. Noch "lebendiger" allerdings hätte sich der Roman entwickelt, hätte sich Barnes nicht verführen lassen, sich immer wieder auf das Terrain des Bruders Jonathan Barnes, seines Zeichens Philosoph und Verfechter der im Titel genannten Beruhigung, der Tod sei im Gegensatz zum Sterben nichts, was der Mensch fürchten müsse, zu begeben. Besser hätte er dem Bruder mit den Mitteln des Erzählers beizukommen versuchen sollen, meint der Rezensent, der trotzdem sehr eingenommen von diesem Versuch, die Todesfurcht zu bannen, scheint.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deThemengebiete
Kommentieren