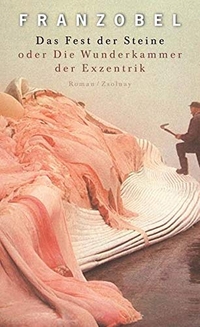Das Fest der Steine
oder Die Wunderkammer der Exzentrik. Roman
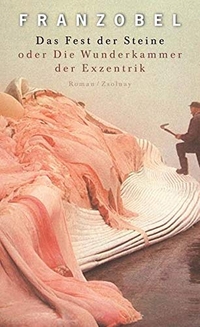
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2005
ISBN
9783552053496
Gebunden, 656 Seiten, 24,90
EUR
Klappentext
Oswald Wuthenau ist ein Schelm und Hochstapler, ein moderner Mephisto, und doch ein verzweifelt Heimatloser. Wie eine Urgewalt bricht diese "Mischung aus Orson Welles, Helmut Qualtinger und Oliver Hardy" Mitte der fünfziger Jahre über Südamerika herein, macht Bekanntschaft mit geflohenen Nazis, gerät in eine ekstatische Orgie, heiratet, errichtet das erste Atomkraftwerk Argentiniens, bekommt in der DDR die Brecht-Medaille überreicht und stellt Wien auf den Kopf.
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 02.03.2006
Von einem bemerkenswerten Erlebnis kann Tanya Lieske berichten - ihrem ersten Franzobel. Gewappnet, alles oder nichts zu erwarten, und mit literaturkritischem Rüstzeug ausgestattet, hat sich die Rezensentin also an die Lektüre des "Sprachwilderers" gemacht, scheint aber auch nach 600 Seiten nicht wirklich schlauer geworden zu sein. Der Plot ist zu abstrus, als dass er zusammengefasst werden könnte: Auftreten werden Zwerge, Nazis und ihre Opfer, der Mossad, ein Möbelfabrikant und seine Schwiegereltern und irgendwie stehen alle in irgendeinem Zusammenhang. Entweder sind sie Geschwister oder sie bringen sich um. Folgen konnte die Rezensentin dem nur halb, als Höhepunkt der Geschichte identifiziert sie aber eindeutig das Titel gebende "Fest der Steine", bei dem es sich tatsächlich um eine Steinigung handelt. Hier, gesteht Lieske, halte Franzobel die "exakte Balanz zwischen sehr grässlich und absolut komisch". Doch alles in allem hat ihr Leseabenteuer keine euphorisierende Wirkung entfaltet. Ihr abschließender Eindruck von Franzobel: "Er könnte gewiss, aber er wollte gar nichts Großes schreiben! Er wollte eigentlich in Ruhe vor sich hin franzobeln, ohne dabei von uns Lesern gestört zu werden!"
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 13.12.2005
Der Sprachspieler Franzobel hat versucht, eine "einfache Geschichte" zu erzählen, und es hat nicht geklappt, seufzt Nico Bleutge. "Hinter seine Rolle als Sprachsportler kann und will Franzobel einfach nicht zurück." Deshalb gerät jede Landschaftsbeschreibung zu einer Übung in Originalität, und auch strukturell gibt es laut Bleutge einige "Blahüngen" zu beklagen. Rund zwanzig Nebenfiguren begleiten den agressiven "Parade-Nazi" Oswald Mephistopheles Wuthenau bei seinem Aufstieg in der argentinischen Gesellschaft. "Heillos überfrachtet", lautet das Fazit Bleutges, der es auch nicht uneingeschränkt goutiert, dass Franzobel in der finalen "Sexorgie" all seine "fäkalischen Register zieht". Und dass am Ende alle Geschichten "artig" aufgelöst werden, stimmt dann wiederum nicht mit dem Rest des Buches überein.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 22.10.2005
Keineswegs überzeugt zeigt sich Rezensent Jörg Magenau von Franzobels neuem Roman. Die Lektüre des Buchs empfindet er als ziemlich mühsam. Er charakterisiert das Werk als einzigen Exzess, als maßlos, überdreht, chaotisch, die Handlung als abstrus. Wer hier nach Sinn und Bedeutung sucht, ist seines Erachtens verloren, Logik oder auch nur Wahrscheinlichkeit interessierten den Autor nicht. Dessen Absicht, den Faschismus als eine "Bauchkrankheit" zu deuten, der rational nicht beizukommen ist, funktioniert für Magenau nicht wirklich. Dass es im Buch geradezu splatterhaft zugeht und in jedes "verfügbare Loch hineingefickt" wird, "auch in rohes Fleisch und Hirnmasse", findet der Rezensent auf Dauer einfach nur ermüdend. Dennoch hat er auch einige lobende Worte für den Autor in Petto, die er freilich gleich wieder einschränkt oder teilweise zurücknimmt. So nennt er den Autor "sprachgewaltig", fügt aber hinzu, er sei kein Erzähler. Begründung: Statt Charakteren schaffe er Kasperlefiguren, statt einer Handlung, die wenigstens in Ansätzen plausibel wäre, sei der Fantasie alles erlaubt. Das Ergebnis erscheint dem Rezensenten ein "merkwürdiges Phänomen": "So saftstrotzend diese Prosa ist, so kraftlos ist sie auch. So potent die Sprache, so schlaff das Resultat. So dick der Roman, so dünn der Erkenntnisgewinn."
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.10.2005
"Ein Idiotenroman, aber kein schlechter", stellt Rezensent Oliver Jungen recht zufrieden fest. Außerdem gibt er zu Protokoll, dass Franzobel in diesem Buch vergleichsweise seriös daherkomme, was Jungen wegen des "gedrosselten" Humors nicht durchgehend erfreut. Mit seinem Roman über den "Diskos von Phaistos", eine mit minoischen Schriftzeichen bedruckte Tonscheibe, versuche Franzobel ein Panorama des zwanzigsten Jahrhunderts zu schaffen, samt einer Hauptfigur, die das Dritte Reich symbolisiert. Jungen lobt die sprachliche Finesse und die kreative, stellenweise surrealistische Handlung, kritisiert aber die Verzettelung und teils übertriebene Schlichtheit des Wortwitzes. Insgesamt findet Jungen das Buch trotz dieser Mängel faszinierend und kreativ überbordend, wenn auch nicht vollständig überzeugend.
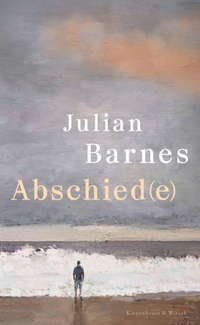 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)