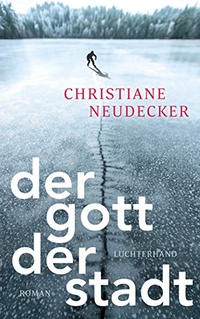Der Gott der Stadt
Roman
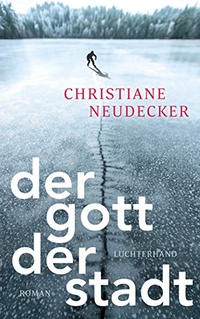
Luchterhand Literaturverlag, München 2019
ISBN
9783630875668
Gebunden, 672 Seiten, 24,00
EUR
Klappentext
Am Anfang steht der Tod. Jemand versinkt zwischen geborstenen Eisschollen und eine Leiche baumelt von der Decke eines Theaters. Die Todesfälle liegen Jahrzehnte auseinander, doch es ist der gleiche Todestag: der 16. Januar. Im Winter 1912 ertrank Georg Heym beim Schlittschuhlaufen, 1995 werden die Novizen einer elitären Schauspielschule im gerade wiedervereinten Berlin auf sein verrätseltes Faust-Fragment angesetzt. Angestachelt von ihrem Professor verstricken sie sich immer tiefer in den Gedankenlabyrinthen des genialischen Dichters. Der psychologische Druck steigt, Konkurrenz entflammt, Wahn und Wirklichkeit beginnen zu verschwimmen. Dann wird ein Toter auf der Probebühne der Schule gefunden. War es Mord, Selbstmord - oder doch ein Teufelspakt?
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (
Info)
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 19.11.2019
Ulrich Seidler urteilt böse über Christiane Neudeckers seiner Meinung nach vermutlich autobiografisch grundierten Roman über eine Schauspielstudentin im Bann eines persönlichkeitsgestörten Dozenten. Die 1995 in Berlin spielende Geschichte ärgert Seidler mit Klischees und "unreifen" Figuren, die dem für Seidler unerträglichen Regieprofessor auf den Leim gehen. Vergisst der Rezensent für einen Moment den ungebrochen, mit viel Fleiß dargestellten Geniekult, kann er dem Buch sogar etwas abgewinnen - als zeithistorischem Großstadtmärchen.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 16.11.2019
Als fünf Regie-Student*innen an einer Ost-Berliner Hochschule die begehrten Plätze im einzigen Seminar des Theatergotts Korbinian Brandner bekommen, entbrennt zwischen ihnen ein gnadenloser Konkurrenzkampf um die Gunst des Star-Regisseurs, fasst Rezensent Carsten Otte den Plot des Buchs zusammen. Dass die Autorin die Student*innen mit ihren Dämonen des Neids und der Berechnung ringen lässt, während sie ausgerechnet ein Faust-Fragment von Georg Heym inszenieren sollen, hält der Kritiker für einen grandiosen Einfall. Außerdem bewundert er die schriftstellerischen Fähigkeiten "dieser Sprachhexe", die laut ihm kunstvoll lyrische und dramatische Elemente in ihren Roman einfließen lässt und damit geschickt zwischen ruhigen, reflektierten, poetischen, spannungsreichen und atemlosen Passagen abwechselt. Noch mehr beeindruckt hat ihn nur Neudeckers Talent für "radikale Charaktere".
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2019
Rezensent Martin Halter annonciert mit Christiane Neudeckers "Der Gott der Stadt" einen neuen "Berlin-Roman" - aber einen, der anders ist als die übrigen. Denn Neudecker, die selbst in den Neunzigern Regie an der Berliner Ernst-Busch-Schauspielschule studierte, taucht noch einmal ab in jenes Milieu, indem sie eine Gruppe junger Regiestudenten um eine einstige DDR-Theaterlegende begleitet, die auf dessen Geheiß Georg Heyms "Faust-Fragment" erstmals inszenieren sollen. Natürlich geht es um die Gruppendynamik, um Konkurrenz, Affären und Leistungsdruck, weiß der Kritiker, der hier aber doch mehr entdeckt: Wenn Neudecker einen von Heym in den Regieanweisungen aufgegriffenen alten Mordfall neu aufrollt, fühlt sich Halter bisweilen an Dan Brown erinnert. Darüber hinaus streunt der Rezensent mit Neudeckers jungen Heym-Adepten gern noch einmal durch das Berlin der Nachwendezeit, durch dunkle Hinterhöfe, leerstehende Schwimmbäder, vorbei an Mauerresten. Dieser kurzweilig erzählten "Heym-Hommage", die auch große Fragen nach Kunst und Genie nicht ausspart, verzeiht Halter auch den ein oder anderen "pathetischen" und "anachronistischen" Moment.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 15.10.2019
In diesem Roman geht es um fünf Regie-Studenten in ihrem ersten Semester in Berlin, die Georg Heyms Faust-Fragment auf die Bühne bringen sollen, erzählt Rezensentin Karin Janker. Da der von ihnen vergötterte Dozent Heym als Genie verklärt und Regie-Arbeit als Berufung begreift, versuchen die Studenten, sich in ähnlich wahnhafte Genies zu verwandeln - eine naive Herangehensweise mit bösen Folgen, so die Kritikerin. Am stärksten findet Janker den Roman dort, wo er das Berlin der 90er beschreibt, durch das sich die autobiografisch an die Autorin angelehnte Erzählerin aus Bayern schlägt. Ebenfalls hat es der Rezensentin gefallen, dass hinter all dem Pathos, mit dem sich die Figuren Heyms Kunst nähern, eine subtile Warnung aufscheint, Kunst nicht zu skandalisieren: "Versenken und Begreifen" müssen bei der Rezeption Hand in Hand gehen, empfiehlt Janker.
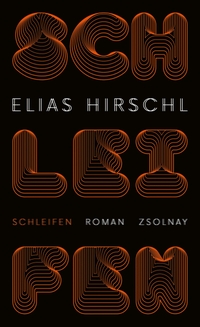 Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen