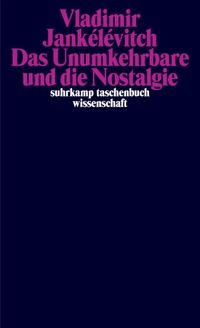BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
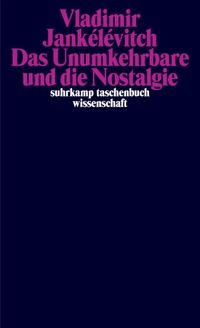
Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Maximilian Oehl: Brand New Bundestag
Die politischen Systeme in unserem Land wirken festgefahren und verstaubt. Sie scheinen kaum in der Lage, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Es ist höchste…

Daniel Bax: Die neue Lust auf links
Die freundliche Revolution "Wir sind die Brandmauer!", schleuderte Heidi Reichinnek Friedrich Merz im Bundestag entgegen, als dieser im Januar 2025 mit den Stimmen der AfD…

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst
Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Außer Atem: Das Berlinale Blog 09.02.2006 […] In mehreren Retrospektiven der letzten Jahre ist immer deutlicher geworden, dass das im Vergleich der Filmkulturen ungefähr so ist, als kennte man zwar Ford und Lang und Hitchcock und Coppola, aber Robert Aldrich nicht und auch nicht Don Siegel oder Robert Wise. […] Von Thekla Dannenberg, Ekkehard Knörer, Christoph Mayerl
Außer Atem: Das Berlinale Blog 09.02.2006 […] In mehreren Retrospektiven der letzten Jahre ist immer deutlicher geworden, dass das im Vergleich der Filmkulturen ungefähr so ist, als kennte man zwar Ford und Lang und Hitchcock und Coppola, aber Robert Aldrich nicht und auch nicht Don Siegel oder Robert Wise. […] Von Thekla Dannenberg, Ekkehard Knörer, Christoph Mayerl