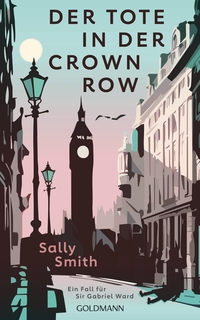BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Charlotte Mew: Alle belebten Dinge halten den Atem an
Aus dem Englischen von Wiebke Meier. Mit einem Nachwort von Norbert Hummelt. Charlotte Mew war eine der herausragenden lyrischen Stimmen ihrer Zeit. In ihren mit den Geschlechterrollen…
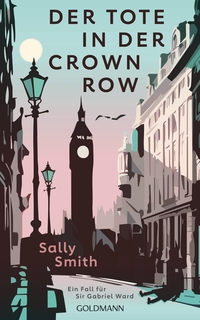
Sally Smith: Der Tote in der Crown Row
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt. London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der…

Martin Warnke: Large Language Kabbala
Nicht Nerds, sondern Schrift-Gelehrte sind es, die das Feld der generativen Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT erklären können: Solche "Large Language Models" wurzeln in…

Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Mia, erfolgreiche Schriftstellerin in Paris, kämpft mit "brain fog", einem Gehirnnebel, der ihre Erinnerungen und ihre Arbeit beeinträchtigt.…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 17.11.2016 […] Statt das Familiendrama als lineare Erzählung weiterzuspinnen, bricht "Continuity" mit dem Realismus und schickt uns in eine Endlosschleife grotesk verzerrter Familienrituale. […] Von Michael Kienzl, Jochen Werner
Im Kino 17.11.2016 […] Statt das Familiendrama als lineare Erzählung weiterzuspinnen, bricht "Continuity" mit dem Realismus und schickt uns in eine Endlosschleife grotesk verzerrter Familienrituale. […] Von Michael Kienzl, Jochen Werner